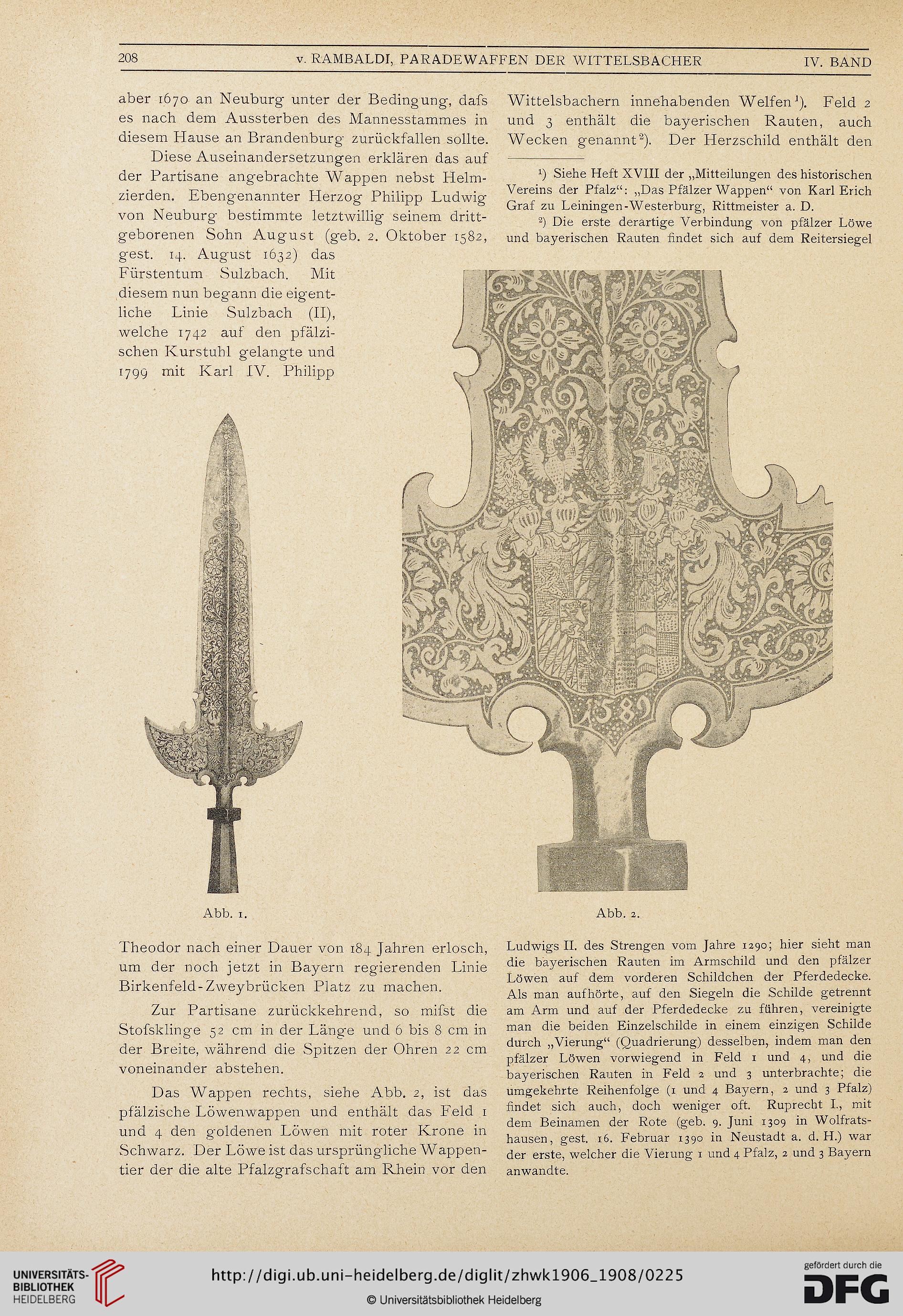208
v. RAMBALDI, PARADEWAFFEN DER WITTELSBACHER
IV. BAND
aber 1670 an Neuburg unter der Bedingung, dafs
es nach dem Aussterben des Mannesstammes in
diesem Hause an Brandenburg zurückfallen sollte.
Diese Auseinandersetzungen erklären das auf
der Partisane angebrachte Wappen nebst Helm-
zierden. Ebengenannter Herzog Philipp Ludwig
von Neuburg bestimmte letztwillig seinem dritt-
geborenen Sohn August (geb. 2. Oktober 1582,
gest. 14. August 1632) das
Fürstentum Sulzbach. Mit
diesem nun begann die eigent-
liche Linie Sulzbach (II),
welche 1742 auf den pfälzi-
schen Kurstuhl gelangte und
1799 mit Karl IV. Philipp
Wittelsbachern innehabenden WelfenJ). Feld 2
und 3 enthält die bayerischen Rauten, auch
Wecken genannt2). Der Herzschild enthält den
1) Siehe Heft XVIII der „Mitteilungen des historischen
Vereins der Pfalz“: „Das Pfälzer Wappen“ von Karl Erich
Graf zu Leiningen-Westerburg, Rittmeister a. D.
2) Die erste derartige Verbindung von pfälzer Löwe
und bayerischen Rauten findet sich auf dem Reitersiegel
Abb. 1.
Abb. 2.
Theodor nach einer Dauer von 184 Jahren erlosch,
um der noch jetzt in Bayern regierenden Linie
Birkenfeld-Zweybrücken Platz zu machen.
Zur Partisane zurückkehrend, so mifst die
Stofsklinge 52 cm in der Länge und 6 bis 8 cm in
der Breite, während die Spitzen der Ohren 22 cm
voneinander abstehen.
Das Wappen rechts, siehe Abb. 2, ist das
pfälzische Löwenwappen und enthält das Feld 1
und 4 den goldenen Löwen mit roter Krone in
Schwarz. Der Löwe ist das ursprüngliche Wappen-
tier der die alte Pfalzgrafschaft am Rhein vor den
Ludwigs II. des Strengen vom Jahre 1290; hier sieht man
die bayerischen Rauten im Arnischild und den pfälzer
Löwen auf dem vorderen Schildchen der Pferdedecke.
Als man auf hörte, auf den Siegeln die Schilde getrennt
am Arm und auf der Pferdedecke zu führen, vereinigte
man die beiden Einzelschilde in einem einzigen Schilde
durch „Vierung“ (Quadrierung) desselben, indem man den
pfälzer Löwen vorwiegend in Feld 1 und 4, und die
bayerischen Rauten in Feld 2 und 3 unterbrachte; die
umgekehrte Reihenfolge (1 und 4 Bayern, 2 und 3 Pfalz)
findet sich auch, doch weniger oft. Ruprecht I., mit
dem Beinamen der Rote (geb. 9. Juni 1309 in Wolfrats-
hausen, gest. 16. Februar 1390 in Neustadt a. d. H.) war
der erste, welcher die Vierung 1 und 4 Pfalz, 2 und 3 Bayern
anwandte.
v. RAMBALDI, PARADEWAFFEN DER WITTELSBACHER
IV. BAND
aber 1670 an Neuburg unter der Bedingung, dafs
es nach dem Aussterben des Mannesstammes in
diesem Hause an Brandenburg zurückfallen sollte.
Diese Auseinandersetzungen erklären das auf
der Partisane angebrachte Wappen nebst Helm-
zierden. Ebengenannter Herzog Philipp Ludwig
von Neuburg bestimmte letztwillig seinem dritt-
geborenen Sohn August (geb. 2. Oktober 1582,
gest. 14. August 1632) das
Fürstentum Sulzbach. Mit
diesem nun begann die eigent-
liche Linie Sulzbach (II),
welche 1742 auf den pfälzi-
schen Kurstuhl gelangte und
1799 mit Karl IV. Philipp
Wittelsbachern innehabenden WelfenJ). Feld 2
und 3 enthält die bayerischen Rauten, auch
Wecken genannt2). Der Herzschild enthält den
1) Siehe Heft XVIII der „Mitteilungen des historischen
Vereins der Pfalz“: „Das Pfälzer Wappen“ von Karl Erich
Graf zu Leiningen-Westerburg, Rittmeister a. D.
2) Die erste derartige Verbindung von pfälzer Löwe
und bayerischen Rauten findet sich auf dem Reitersiegel
Abb. 1.
Abb. 2.
Theodor nach einer Dauer von 184 Jahren erlosch,
um der noch jetzt in Bayern regierenden Linie
Birkenfeld-Zweybrücken Platz zu machen.
Zur Partisane zurückkehrend, so mifst die
Stofsklinge 52 cm in der Länge und 6 bis 8 cm in
der Breite, während die Spitzen der Ohren 22 cm
voneinander abstehen.
Das Wappen rechts, siehe Abb. 2, ist das
pfälzische Löwenwappen und enthält das Feld 1
und 4 den goldenen Löwen mit roter Krone in
Schwarz. Der Löwe ist das ursprüngliche Wappen-
tier der die alte Pfalzgrafschaft am Rhein vor den
Ludwigs II. des Strengen vom Jahre 1290; hier sieht man
die bayerischen Rauten im Arnischild und den pfälzer
Löwen auf dem vorderen Schildchen der Pferdedecke.
Als man auf hörte, auf den Siegeln die Schilde getrennt
am Arm und auf der Pferdedecke zu führen, vereinigte
man die beiden Einzelschilde in einem einzigen Schilde
durch „Vierung“ (Quadrierung) desselben, indem man den
pfälzer Löwen vorwiegend in Feld 1 und 4, und die
bayerischen Rauten in Feld 2 und 3 unterbrachte; die
umgekehrte Reihenfolge (1 und 4 Bayern, 2 und 3 Pfalz)
findet sich auch, doch weniger oft. Ruprecht I., mit
dem Beinamen der Rote (geb. 9. Juni 1309 in Wolfrats-
hausen, gest. 16. Februar 1390 in Neustadt a. d. H.) war
der erste, welcher die Vierung 1 und 4 Pfalz, 2 und 3 Bayern
anwandte.