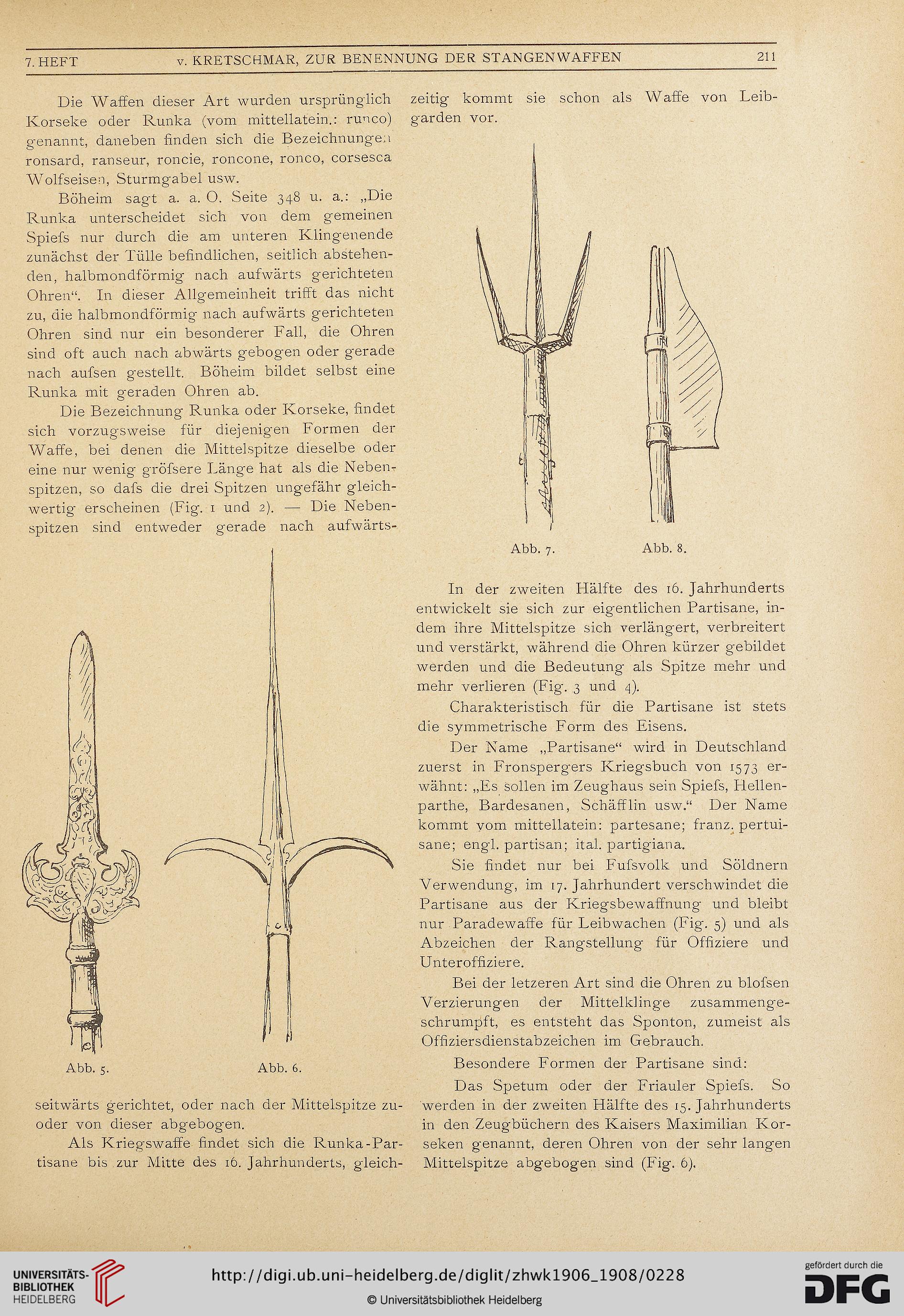7. HEFT
v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGEN WAFFEN
211
Die Waffen dieser Art wurden ursprünglich
Korseke oder Runka (vom mittellatein.: runco)
genannt, daneben finden sich die Bezeichnungen
ronsard, ranseur, roncie, roncone, ronco, corsesca
Wolfseisen, Sturmgabel usw.
Böheim sagt a. a. O. Seite 348 u. a.: „Die
Runka unterscheidet sich von dem gemeinen
Spiefs nur durch die am unteren Klingenende
zunächst der Tülle befindlichen, seitlich abstehen-
den, halbmondförmig nach aufwärts gerichteten
Ohren“. In dieser Allgemeinheit trifft das nicht
zu, die halbmondförmig nach aufwärts gerichteten
Ohren sind nur ein besonderer Fall, die Ohren
sind oft auch nach abwärts gebogen oder gerade
nach aufsen gestellt. Böheim bildet selbst eine
Runka mit geraden Ohren ab.
Die Bezeichnung Runka oder Korseke, findet
sich vorzugsweise für diejenigen Formen der
Waffe, bei denen die Mittelspitze dieselbe oder
eine nur wenig gröfsere Länge hat als die Neben-
spitzen, so dafs die drei Spitzen ungefähr gleich-
wertig erscheinen (Fig. 1 und 2). — Die Neben-
spitzen sind entweder gerade nach aufwärts-
seitwärts gerichtet, oder nach der Mittelspitze zu-
oder von dieser abgebogen.
Als Kriegswaffe findet sich die Runka-Par-
tisane bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, gleich-
zeitig kommt sie schon als Waffe von Leib-
garden vor.
Abb. 8.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
entwickelt sie sich zur eigentlichen Partisane, in-
dem ihre Mittelspitze sich verlängert, verbreitert
und verstärkt, während die Ohren kürzer gebildet
werden und die Bedeutung als Spitze mehr und
mehr verlieren (Fig. 3 und 4).
Charakteristisch für die Partisane ist stets
die symmetrische Form des Eisens.
Der Name „Partisane“ wird in Deutschland
zuerst in Fronspergers Kriegsbuch von 1573 er-
wähnt: „Es sollen im Zeughaus sein Spiefs, Hellen-
parthe, Bardesanen, Schäfflin usw.“ Der Name
kommt vom mittellatein: partesane; franz. pertui-
sane; engl, partisan; ital. partigiana.
Sie findet nur bei Fufsvolk und Soldnern
Verwendung, im 17. Jahrhundert verschwindet die
Partisane aus der Kriegsbewaffnung und bleibt
nur Paradewaffe für Leibwachen (Fig. 5) und als
Abzeichen der Rangstellung für Offiziere und
Unteroffiziere.
Bei der letzeren Art sind die Ohren zu blofsen
Verzierungen der Mittelklinge zusammenge-
schrumpft, es entsteht das Sponton, zumeist als
Offiziersdienstabzeichen im Gebrauch,
Besondere Formen der Partisane sind:
Das Spetum oder der Friauler Spiefs. So
werden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
in den Zeugbüchern des Kaisers Maximilian Kor-
seken genannt, deren Ohren von der sehr langen
Mittelspitze abgebogen sind (Fig. 6).
v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGEN WAFFEN
211
Die Waffen dieser Art wurden ursprünglich
Korseke oder Runka (vom mittellatein.: runco)
genannt, daneben finden sich die Bezeichnungen
ronsard, ranseur, roncie, roncone, ronco, corsesca
Wolfseisen, Sturmgabel usw.
Böheim sagt a. a. O. Seite 348 u. a.: „Die
Runka unterscheidet sich von dem gemeinen
Spiefs nur durch die am unteren Klingenende
zunächst der Tülle befindlichen, seitlich abstehen-
den, halbmondförmig nach aufwärts gerichteten
Ohren“. In dieser Allgemeinheit trifft das nicht
zu, die halbmondförmig nach aufwärts gerichteten
Ohren sind nur ein besonderer Fall, die Ohren
sind oft auch nach abwärts gebogen oder gerade
nach aufsen gestellt. Böheim bildet selbst eine
Runka mit geraden Ohren ab.
Die Bezeichnung Runka oder Korseke, findet
sich vorzugsweise für diejenigen Formen der
Waffe, bei denen die Mittelspitze dieselbe oder
eine nur wenig gröfsere Länge hat als die Neben-
spitzen, so dafs die drei Spitzen ungefähr gleich-
wertig erscheinen (Fig. 1 und 2). — Die Neben-
spitzen sind entweder gerade nach aufwärts-
seitwärts gerichtet, oder nach der Mittelspitze zu-
oder von dieser abgebogen.
Als Kriegswaffe findet sich die Runka-Par-
tisane bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, gleich-
zeitig kommt sie schon als Waffe von Leib-
garden vor.
Abb. 8.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
entwickelt sie sich zur eigentlichen Partisane, in-
dem ihre Mittelspitze sich verlängert, verbreitert
und verstärkt, während die Ohren kürzer gebildet
werden und die Bedeutung als Spitze mehr und
mehr verlieren (Fig. 3 und 4).
Charakteristisch für die Partisane ist stets
die symmetrische Form des Eisens.
Der Name „Partisane“ wird in Deutschland
zuerst in Fronspergers Kriegsbuch von 1573 er-
wähnt: „Es sollen im Zeughaus sein Spiefs, Hellen-
parthe, Bardesanen, Schäfflin usw.“ Der Name
kommt vom mittellatein: partesane; franz. pertui-
sane; engl, partisan; ital. partigiana.
Sie findet nur bei Fufsvolk und Soldnern
Verwendung, im 17. Jahrhundert verschwindet die
Partisane aus der Kriegsbewaffnung und bleibt
nur Paradewaffe für Leibwachen (Fig. 5) und als
Abzeichen der Rangstellung für Offiziere und
Unteroffiziere.
Bei der letzeren Art sind die Ohren zu blofsen
Verzierungen der Mittelklinge zusammenge-
schrumpft, es entsteht das Sponton, zumeist als
Offiziersdienstabzeichen im Gebrauch,
Besondere Formen der Partisane sind:
Das Spetum oder der Friauler Spiefs. So
werden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
in den Zeugbüchern des Kaisers Maximilian Kor-
seken genannt, deren Ohren von der sehr langen
Mittelspitze abgebogen sind (Fig. 6).