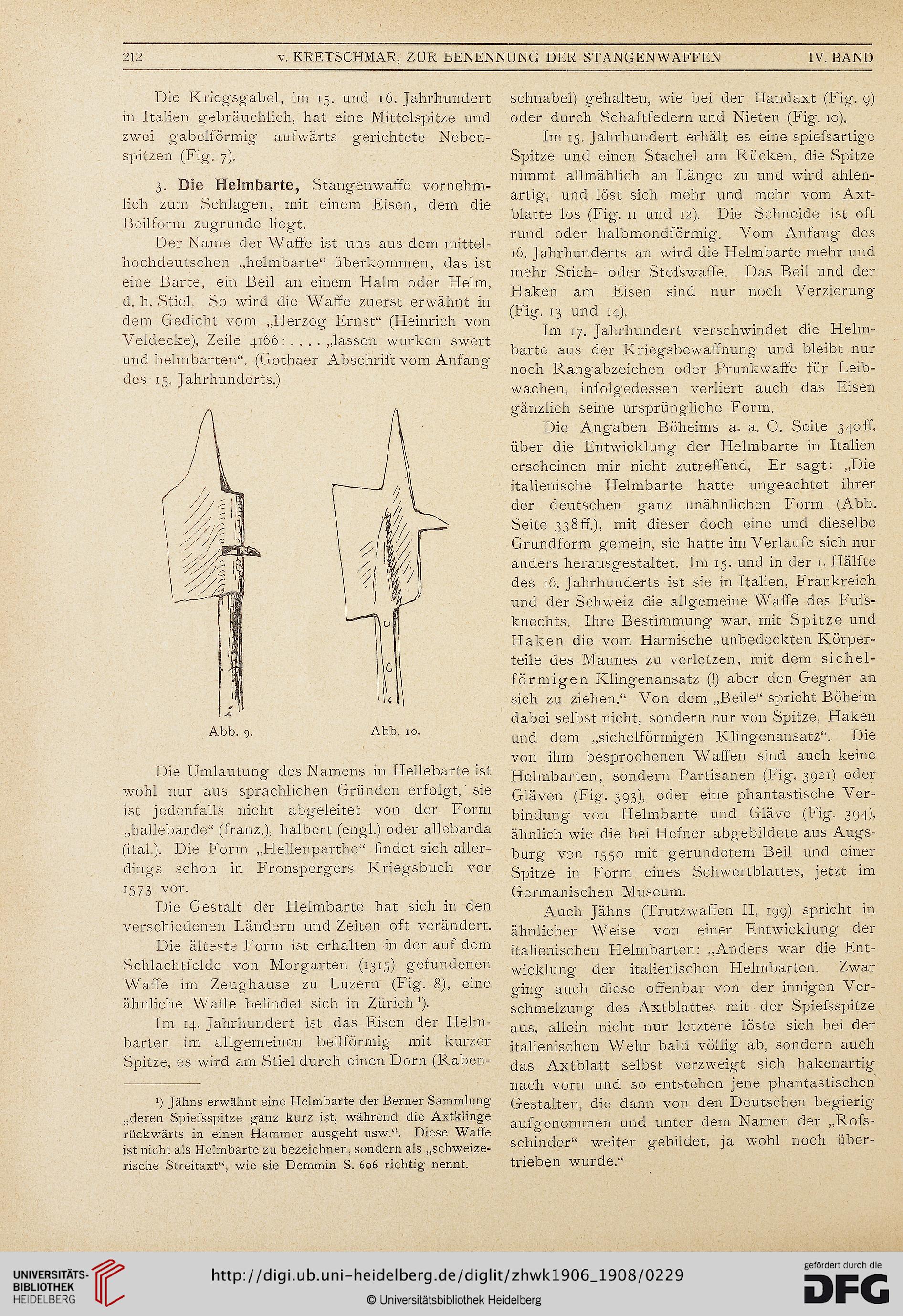212
v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN
IV. BAND
Die Kriegsgabel, im 15. und 16. Jahrhundert
in Italien gebräuchlich, hat eine Mittelspitze und
zwei gabelförmig aufwärts gerichtete Neben-
spitzen (Fig. 7).
3. Die Helmbarte, Stangenwaffe vornehm-
lich zum Schlagen, mit einem Eisen, dem die
Beilform zugrunde liegt.
Der Name der Waffe ist uns aus dem mittel-
hochdeutschen „helmbarte“ überkommen, das ist
eine Barte, ein Beil an einem Halm oder Helm,
d. h. Stiel. So wird die Waffe zuerst erwähnt in
dem Gedicht vom „Herzog Ernst“ (Heinrich von
Veldecke), Zeile 4166: .... „lassen wurken swert
und helmbarten“. (Gothaer Abschrift vom Anfang
des 15. Jahrhunderts.)
Die Umlautung des Namens in Elellebarte ist
wohl nur aus sprachlichen Gründen erfolgt, sie
ist jedenfalls nicht abgeleitet von der Form
„hallebarde“ (franz.), halbert (engl.) oder allebarda
(ital.). Die Form „Hellenparthe“ findet sich aller-
dings schon in Fronspergers Kriegsbuch vor
1573 vor.
Die Gestalt der Helmbarte hat sich in den
verschiedenen Ländern und Zeiten oft verändert.
Die älteste Form ist erhalten in der auf dem
Schlachtfelde von Morgarten (1315) gefundenen
Waffe im Zeughause zu Luzern (Fig. 8), eine
ähnliche Waffe befindet sich in Zürich1).
Im 14. Jahrhundert ist das Eisen der Helm-
barten im allgemeinen beilförmig- mit kurzer
Spitze, es wird am Stiel durch einen Dorn (Raben-
b Jahns erwähnt eine Helmbarte der Berner Sammlung
„deren Spiefsspitze ganz kurz ist, während die Axtklinge
rückwärts in einen Hammer ausgeht usw.“. Diese Waffe
ist nicht als Helmbarte zu bezeichnen, sondern als „schweize-
rische Streitaxt“, wie sie Demmin S. 606 richtig nennt.
schnabel) g-ehalten, wie bei der Handaxt (Fig. 9)
oder durch Schaftfedern und Nieten (Fig. 10).
Im 15. Jahrhundert erhält es eine spiefsartige
Spitze und einen Stachel am Rücken, die Spitze
nimmt allmählich an Läng-e zu und wird ahlen-
artig-, und löst sich mehr und mehr vom Axt-
blatte los (Fig. 11 und 12). Die Schneide ist oft
rund oder halbmondförmig. Vom Anfang des
16. Jahrhunderts an wird die Helmbarte mehr und
mehr Stich- oder Stofswaffe. Das Beil und der
Flaken am Eisen sind nur noch Verzierung
(Fig. 13 und 14).
Im 17. Jahrhundert verschwindet die Helm-
barte aus der Kriegsbewaffnung und bleibt nur
noch Rangabzeichen oder Prunkwaffe für Leib-
wachen, infolgedessen verliert auch das Eisen
gänzlich seine ursprüngliche Form.
Die Angaben Böheims a. a. O. Seite 340ff.
über die Entwicklung der Helmbarte in Italien
erscheinen mir nicht zutreffend, Er sagt: „Die
italienische Helmbarte hatte ungeachtet ihrer
der deutschen ganz unähnlichen Form (Abb.
Seite 338ff.), mit dieser doch eine und dieselbe
Grundform g-emein, sie hatte im Verlaufe sich nur
anders herausgestaltet. Im 15. und in der 1. Hälfte
des 16. Jahrhunderts ist sie in Italien, Frankreich
und der Schweiz die allgemeine Waffe des Fufs-
knechts. Ihre Bestimmung war, mit Spitze und
Haken die vom Harnische unbedeckten Körper-
teile des Mannes zu verletzen, mit dem sichel-
förmigen Klingenansatz (!) aber den Gegner an
sich zu ziehen.“ V011 dem „Beile“ spricht Böheim
dabei selbst nicht, sondern nur von Spitze, Haken
und dem „sichelförmigen Klingenansatz“. Die
von ihm besprochenen W7 affen sind auch keine
Helmbarten, sondern Partisanen (Fig. 3921) oder
Gläven (Fig. 393), oder eine phantastische Ver-
bindung- von Helmbarte und Gläve (Fig. 394),
ähnlich wie die bei Hefner abgebildete aus Augs-
burg- von 1550 mit gerundetem Beil und einer
Spitze in Form eines Schwertblattes, jetzt im
Germanischen Museum.
Auch Jähns (Trutzwaffen II, 199) spricht in
ähnlicher Weise von einer Entwicklung der
italienischen Plelmbarten: „Anders war die Ent-
wicklung der italienischen Helmbarten. Zwar
ging auch diese offenbar von der innigen Ver-
schmelzung des Axtblattes mit der Spiefsspitze
aus, allein nicht nur letztere löste sich bei der
italienischen Wehr bald völlig ab, sondern auch
das Axtblatt selbst verzweigt sich hakenartig
nach vorn und so entstehen jene phantastischen
Gestalten, die dann von den Deutschen begierig
aufg'enommen und unter dem Namen der „Rofs-
schinder“ weiter gebildet, ja wohl noch über-
trieben wurde.“
v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN
IV. BAND
Die Kriegsgabel, im 15. und 16. Jahrhundert
in Italien gebräuchlich, hat eine Mittelspitze und
zwei gabelförmig aufwärts gerichtete Neben-
spitzen (Fig. 7).
3. Die Helmbarte, Stangenwaffe vornehm-
lich zum Schlagen, mit einem Eisen, dem die
Beilform zugrunde liegt.
Der Name der Waffe ist uns aus dem mittel-
hochdeutschen „helmbarte“ überkommen, das ist
eine Barte, ein Beil an einem Halm oder Helm,
d. h. Stiel. So wird die Waffe zuerst erwähnt in
dem Gedicht vom „Herzog Ernst“ (Heinrich von
Veldecke), Zeile 4166: .... „lassen wurken swert
und helmbarten“. (Gothaer Abschrift vom Anfang
des 15. Jahrhunderts.)
Die Umlautung des Namens in Elellebarte ist
wohl nur aus sprachlichen Gründen erfolgt, sie
ist jedenfalls nicht abgeleitet von der Form
„hallebarde“ (franz.), halbert (engl.) oder allebarda
(ital.). Die Form „Hellenparthe“ findet sich aller-
dings schon in Fronspergers Kriegsbuch vor
1573 vor.
Die Gestalt der Helmbarte hat sich in den
verschiedenen Ländern und Zeiten oft verändert.
Die älteste Form ist erhalten in der auf dem
Schlachtfelde von Morgarten (1315) gefundenen
Waffe im Zeughause zu Luzern (Fig. 8), eine
ähnliche Waffe befindet sich in Zürich1).
Im 14. Jahrhundert ist das Eisen der Helm-
barten im allgemeinen beilförmig- mit kurzer
Spitze, es wird am Stiel durch einen Dorn (Raben-
b Jahns erwähnt eine Helmbarte der Berner Sammlung
„deren Spiefsspitze ganz kurz ist, während die Axtklinge
rückwärts in einen Hammer ausgeht usw.“. Diese Waffe
ist nicht als Helmbarte zu bezeichnen, sondern als „schweize-
rische Streitaxt“, wie sie Demmin S. 606 richtig nennt.
schnabel) g-ehalten, wie bei der Handaxt (Fig. 9)
oder durch Schaftfedern und Nieten (Fig. 10).
Im 15. Jahrhundert erhält es eine spiefsartige
Spitze und einen Stachel am Rücken, die Spitze
nimmt allmählich an Läng-e zu und wird ahlen-
artig-, und löst sich mehr und mehr vom Axt-
blatte los (Fig. 11 und 12). Die Schneide ist oft
rund oder halbmondförmig. Vom Anfang des
16. Jahrhunderts an wird die Helmbarte mehr und
mehr Stich- oder Stofswaffe. Das Beil und der
Flaken am Eisen sind nur noch Verzierung
(Fig. 13 und 14).
Im 17. Jahrhundert verschwindet die Helm-
barte aus der Kriegsbewaffnung und bleibt nur
noch Rangabzeichen oder Prunkwaffe für Leib-
wachen, infolgedessen verliert auch das Eisen
gänzlich seine ursprüngliche Form.
Die Angaben Böheims a. a. O. Seite 340ff.
über die Entwicklung der Helmbarte in Italien
erscheinen mir nicht zutreffend, Er sagt: „Die
italienische Helmbarte hatte ungeachtet ihrer
der deutschen ganz unähnlichen Form (Abb.
Seite 338ff.), mit dieser doch eine und dieselbe
Grundform g-emein, sie hatte im Verlaufe sich nur
anders herausgestaltet. Im 15. und in der 1. Hälfte
des 16. Jahrhunderts ist sie in Italien, Frankreich
und der Schweiz die allgemeine Waffe des Fufs-
knechts. Ihre Bestimmung war, mit Spitze und
Haken die vom Harnische unbedeckten Körper-
teile des Mannes zu verletzen, mit dem sichel-
förmigen Klingenansatz (!) aber den Gegner an
sich zu ziehen.“ V011 dem „Beile“ spricht Böheim
dabei selbst nicht, sondern nur von Spitze, Haken
und dem „sichelförmigen Klingenansatz“. Die
von ihm besprochenen W7 affen sind auch keine
Helmbarten, sondern Partisanen (Fig. 3921) oder
Gläven (Fig. 393), oder eine phantastische Ver-
bindung- von Helmbarte und Gläve (Fig. 394),
ähnlich wie die bei Hefner abgebildete aus Augs-
burg- von 1550 mit gerundetem Beil und einer
Spitze in Form eines Schwertblattes, jetzt im
Germanischen Museum.
Auch Jähns (Trutzwaffen II, 199) spricht in
ähnlicher Weise von einer Entwicklung der
italienischen Plelmbarten: „Anders war die Ent-
wicklung der italienischen Helmbarten. Zwar
ging auch diese offenbar von der innigen Ver-
schmelzung des Axtblattes mit der Spiefsspitze
aus, allein nicht nur letztere löste sich bei der
italienischen Wehr bald völlig ab, sondern auch
das Axtblatt selbst verzweigt sich hakenartig
nach vorn und so entstehen jene phantastischen
Gestalten, die dann von den Deutschen begierig
aufg'enommen und unter dem Namen der „Rofs-
schinder“ weiter gebildet, ja wohl noch über-
trieben wurde.“