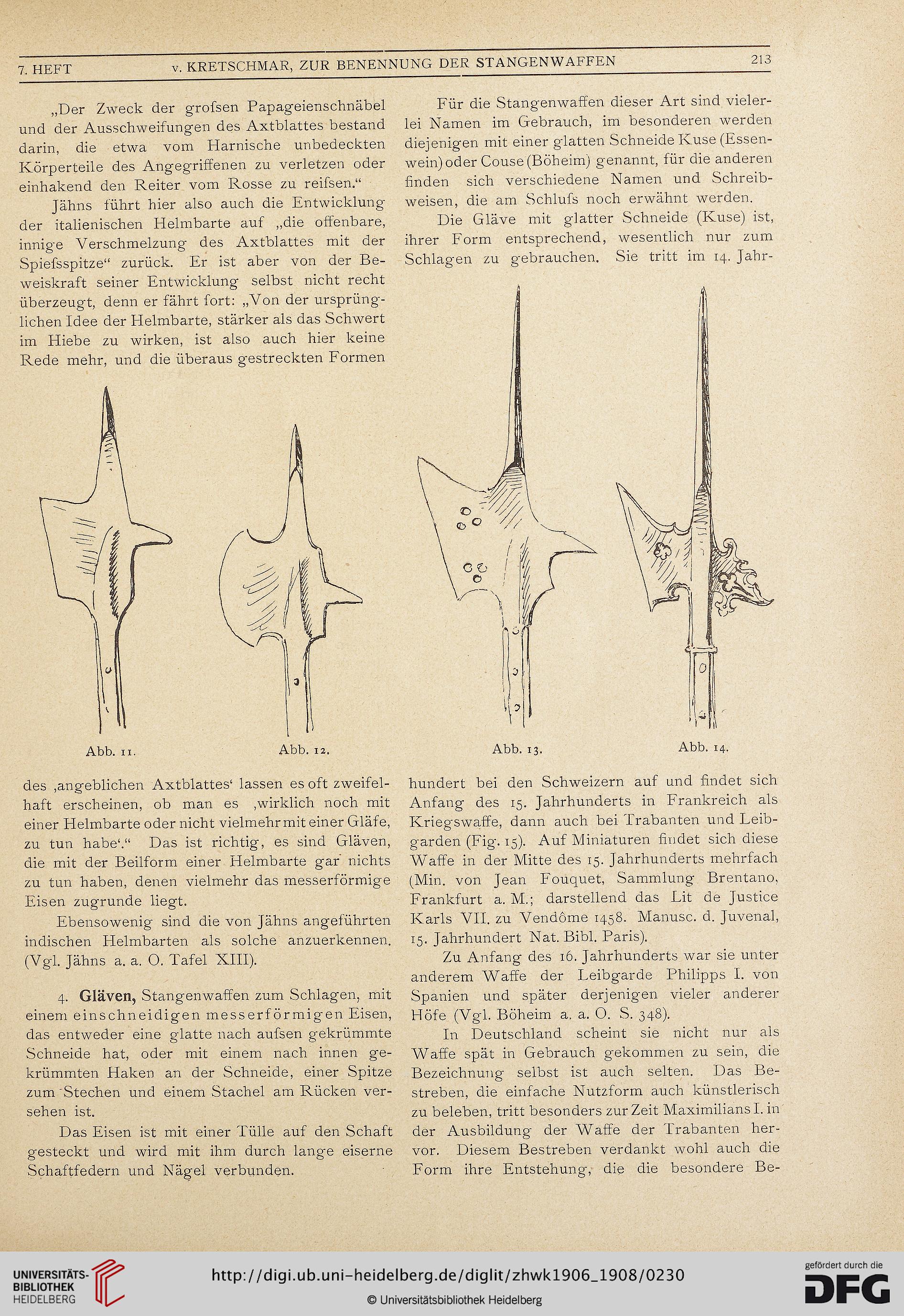7. HEFT
v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN
213
„Der Zweck der grofsen Papageienschnäbel
und der Ausschweifungen des Axtblattes bestand
darin, die etwa vom Harnische unbedeckten
Körperteile des Angegriffenen zu verletzen oder
einhakend den Reiter vom Rosse zu reifsen.“
Jähns führt hier also auch die Entwicklung
der italienischen Helmbarte auf „die offenbare,
innige Verschmelzung des Axtblattes mit der
Spiefsspitze“ zurück. Er ist aber von der Be-
weiskraft seiner Entwicklung selbst nicht recht
überzeugt, denn er fährt fort: „Von der ursprüng-
lichen Idee der Helmbarte, stärker als das Schwert
im Hiebe zu wirken, ist also auch hier keine
Rede mehr, und die überaus gestreckten Formen
des ,angeblichen Axtblattes“ lassen es oft zweifel-
haft erscheinen, ob man es ,wirklich noch mit
einer Helmbarte oder nicht vielmehr mit einer Gläfe,
zu tun habe“.“ Das ist richtig, es sind Gläven,
die mit der Beilform einer Helmbarte gar nichts
zu tun haben, denen vielmehr das messerförmige
Eisen zugrunde liegt.
Ebensowenig sind die von Jähns angeführten
indischen Helmbarten als solche anzuerkennen.
(Vgl. Jähns a. a. O. Tafel XIII).
4. Gläven, Stangenwaffen zum Schlagen, mit
einem einschneidigen messerförmigen Eisen,
das entweder eine glatte nach aufsen gekrümmte
Schneide hat, oder mit einem nach innen ge-
krümmten Haken an der Schneide, einer Spitze
zum 'Stechen und einem Stachel am Rücken ver-
sehen ist.
Das Eisen ist mit einer Tülle auf den Schaft
gesteckt und wird mit ihm durch lang-e eiserne
Schaftfedern und Nägel verbunden.
Für die Stangenwaffen dieser Art sind vieler-
lei Namen im Gebrauch, im besonderen werden
diejenigen mit einer glatten Schneide Kuse (Essen-
wein) oder Couse (Böheim) genannt, für die anderen
finden sich verschiedene Namen und Schreib-
weisen, die am Schlufs noch erwähnt werden.
Die Gläve mit glatter Schneide (Kuse) ist,
ihrer Form entsprechend, wesentlich nur zum
Schlagen zu gebrauchen. Sie tritt im 14. Jahr-
hundert bei den Schweizern auf und findet sich
Anfang des 15. Jahrhunderts in Frankreich als
Krieg'swaffe, dann auch bei Trabanten und Leib-
garden (Fig. 15). Auf Miniaturen findet sich diese
Waffe in der Mitte des 15. Jahrhunderts mehrfach
(Min. von Jean Fouquet, Sammlung Brentano,
Frankfurt a. M.; darstellend das Lit de Justice
Karls VII. zu Vendöme 1458. Manusc. d. Juvenal,
15. Jahrhundert Nat. Bibi. Paris).
Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war sie unter
anderem Waffe der Leibgarde Philipps I. von
Spanien und später derjenigen vieler anderer
Höfe (Vgl. Böheim a, a. O. S. 348).
In Deutschland scheint sie nicht nur als
Waffe spät in Gebrauch gekommen zu sein, die
Bezeichnung selbst ist auch selten. Das Be-
streben, die einfache Nutzform auch künstlerisch
zu beleben, tritt besonders zurZeit Maximilians I. in
der Ausbildung der Waffe der Trabanten her-
vor. Diesem Bestreben verdankt wohl auch die
Form ihre Entstehung, die die besondere Be-
v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN
213
„Der Zweck der grofsen Papageienschnäbel
und der Ausschweifungen des Axtblattes bestand
darin, die etwa vom Harnische unbedeckten
Körperteile des Angegriffenen zu verletzen oder
einhakend den Reiter vom Rosse zu reifsen.“
Jähns führt hier also auch die Entwicklung
der italienischen Helmbarte auf „die offenbare,
innige Verschmelzung des Axtblattes mit der
Spiefsspitze“ zurück. Er ist aber von der Be-
weiskraft seiner Entwicklung selbst nicht recht
überzeugt, denn er fährt fort: „Von der ursprüng-
lichen Idee der Helmbarte, stärker als das Schwert
im Hiebe zu wirken, ist also auch hier keine
Rede mehr, und die überaus gestreckten Formen
des ,angeblichen Axtblattes“ lassen es oft zweifel-
haft erscheinen, ob man es ,wirklich noch mit
einer Helmbarte oder nicht vielmehr mit einer Gläfe,
zu tun habe“.“ Das ist richtig, es sind Gläven,
die mit der Beilform einer Helmbarte gar nichts
zu tun haben, denen vielmehr das messerförmige
Eisen zugrunde liegt.
Ebensowenig sind die von Jähns angeführten
indischen Helmbarten als solche anzuerkennen.
(Vgl. Jähns a. a. O. Tafel XIII).
4. Gläven, Stangenwaffen zum Schlagen, mit
einem einschneidigen messerförmigen Eisen,
das entweder eine glatte nach aufsen gekrümmte
Schneide hat, oder mit einem nach innen ge-
krümmten Haken an der Schneide, einer Spitze
zum 'Stechen und einem Stachel am Rücken ver-
sehen ist.
Das Eisen ist mit einer Tülle auf den Schaft
gesteckt und wird mit ihm durch lang-e eiserne
Schaftfedern und Nägel verbunden.
Für die Stangenwaffen dieser Art sind vieler-
lei Namen im Gebrauch, im besonderen werden
diejenigen mit einer glatten Schneide Kuse (Essen-
wein) oder Couse (Böheim) genannt, für die anderen
finden sich verschiedene Namen und Schreib-
weisen, die am Schlufs noch erwähnt werden.
Die Gläve mit glatter Schneide (Kuse) ist,
ihrer Form entsprechend, wesentlich nur zum
Schlagen zu gebrauchen. Sie tritt im 14. Jahr-
hundert bei den Schweizern auf und findet sich
Anfang des 15. Jahrhunderts in Frankreich als
Krieg'swaffe, dann auch bei Trabanten und Leib-
garden (Fig. 15). Auf Miniaturen findet sich diese
Waffe in der Mitte des 15. Jahrhunderts mehrfach
(Min. von Jean Fouquet, Sammlung Brentano,
Frankfurt a. M.; darstellend das Lit de Justice
Karls VII. zu Vendöme 1458. Manusc. d. Juvenal,
15. Jahrhundert Nat. Bibi. Paris).
Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war sie unter
anderem Waffe der Leibgarde Philipps I. von
Spanien und später derjenigen vieler anderer
Höfe (Vgl. Böheim a, a. O. S. 348).
In Deutschland scheint sie nicht nur als
Waffe spät in Gebrauch gekommen zu sein, die
Bezeichnung selbst ist auch selten. Das Be-
streben, die einfache Nutzform auch künstlerisch
zu beleben, tritt besonders zurZeit Maximilians I. in
der Ausbildung der Waffe der Trabanten her-
vor. Diesem Bestreben verdankt wohl auch die
Form ihre Entstehung, die die besondere Be-