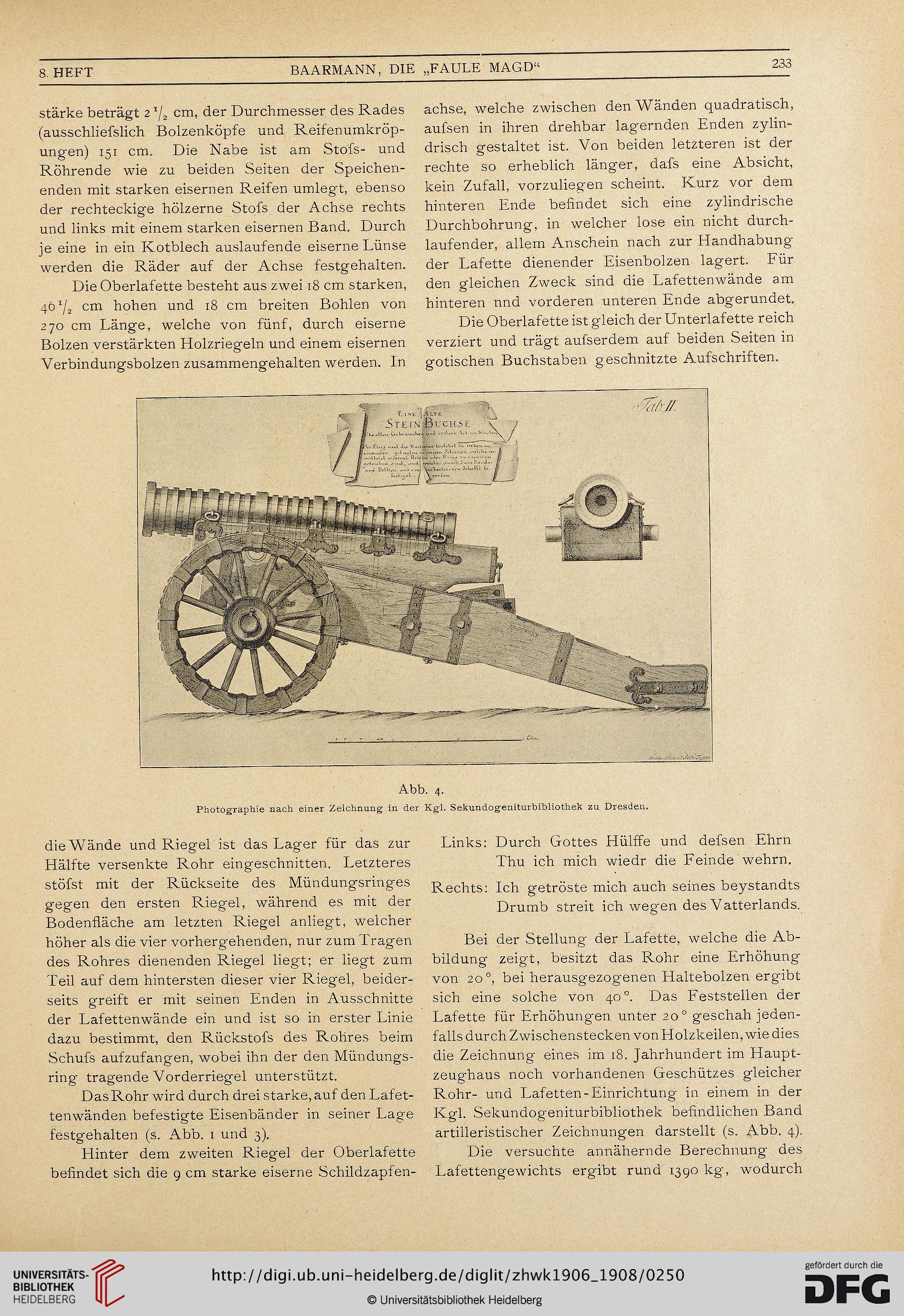8 HEFT
BAARMANN, DIE „FAULE MAGD1
233
stärke beträgt 2 l/2 cm, der Durchmesser des Rades
(ausschliefslich Bolzenköpfe und Reifenumkröp-
ungen) 151 cm. Die Nabe ist am Stofs- und
Röhrende wie zu beiden Seiten der Speichen-
enden mit starken eisernen Reifen umlegt, ebenso
der rechteckige hölzerne Stofs der Achse rechts
und links mit einem starken eisernen Band. Durch
je eine in ein Kotblech auslaufende eiserne Lünse
werden die Räder auf der Achse festgehalten.
Die Oberlafette besteht aus zwei 18 cm starken,
46 72 cm hohen und 18 cm breiten Bohlen von
270 cm Länge, welche von fünf, durch eiserne
Bolzen verstärkten Holzriegeln und einem eisernen
Verbindungsbolzen zusammengehalten werden. In
die Wände und Riegel ist das Lager für das zur
Hälfte versenkte Rohr eingeschnitten. Letzteres
stöfst mit der Rückseite des Mündungsringes
gegen den ersten Riegel, während es mit der
Bodenfläche am letzten Riegel anliegt, welcher
höher als die vier vorhergehenden, nur zum Tragen
des Rohres dienenden Riegel liegt; er liegt zum
Teil auf dem hintersten dieser vier Riegel, beider-
seits greift er mit seinen Enden in Ausschnitte
der Lafettenwände ein und ist so in erster Linie
dazu bestimmt, den Rückstofs des Rohres beim
Behufs aufzufangen, wobei ihn der den Mündungs-
ring tragende Vorderriegel unterstützt.
Das Rohr wird durch drei starke, auf den Lafet-
tenwänden befestigte Eisenbänder in seiner Lage
festgehalten (s. Abb. 1 und 3).
Hinter dem zweiten Riegel der Oberlafette
befindet sich die 9 cm starke eiserne Schildzapfen-
achse, welche zwischen den Wänden quadratisch,
aufsen in ihren drehbar lagernden Enden zylin-
drisch gestaltet ist. Von beiden letzteren ist der
rechte so erheblich länger, dafs eine Absicht,
kein Zufall, vorzuliegen scheint. Kurz vor dem
hinteren Ende befindet sich eine zylindrische
Durchbohrung, in welcher lose ein nicht durch-
laufender, allem Anschein nach zur Handhabung
der Lafette dienender Eisenbolzen lagert. Für
den gleichen Zweck sind die Lafettenwände am
hinteren und vorderen unteren Ende abgerundet.
Die Oberlafette ist gleich der Unterlafette reich
verziert und trägt aufserdem auf beiden Seiten in
gotischen Buchstaben geschnitzte Aufschriften.
Links: Durch Gottes Hülffe und defsen Ehrn
Thu ich mich wiedr die Feinde wehrn.
Rechts: Ich getroste mich auch seines beystandts
Drumb streit ich wegen des Vatterlands.
Bei der Stellung- der Lafette, welche die Ab-
bildung zeigt, besitzt das Rohr eine Erhöhung
von 2o°, bei herausgezogenen Haltebolzen ergibt
sich eine solche von 40 °. Das Feststellen der
Lafette für Erhöhungen unter 200 geschah jeden-
falls durch Zwischenstecken von Holzkeilen, wie dies
die Zeichnung eines im 18. Jahrhundert im Haupt-
zeug-haus noch vorhandenen Geschützes gleicher
Rohr- und Lafetten-Einrichtung in einem in der
Kgl. Sekundogeniturbibliothek befindlichen Band
artilleristischer Zeichnungen darstellt (s. Abb. 4).
Die versuchte annähernde Berechnung des
Lafettengewichts ergibt rund 1390 kg-, wodurch
Abb. 4.
Photographie nach einer Zeichnung in der Kgl. Sekundogeniturbibliothek zu Dresden.
BAARMANN, DIE „FAULE MAGD1
233
stärke beträgt 2 l/2 cm, der Durchmesser des Rades
(ausschliefslich Bolzenköpfe und Reifenumkröp-
ungen) 151 cm. Die Nabe ist am Stofs- und
Röhrende wie zu beiden Seiten der Speichen-
enden mit starken eisernen Reifen umlegt, ebenso
der rechteckige hölzerne Stofs der Achse rechts
und links mit einem starken eisernen Band. Durch
je eine in ein Kotblech auslaufende eiserne Lünse
werden die Räder auf der Achse festgehalten.
Die Oberlafette besteht aus zwei 18 cm starken,
46 72 cm hohen und 18 cm breiten Bohlen von
270 cm Länge, welche von fünf, durch eiserne
Bolzen verstärkten Holzriegeln und einem eisernen
Verbindungsbolzen zusammengehalten werden. In
die Wände und Riegel ist das Lager für das zur
Hälfte versenkte Rohr eingeschnitten. Letzteres
stöfst mit der Rückseite des Mündungsringes
gegen den ersten Riegel, während es mit der
Bodenfläche am letzten Riegel anliegt, welcher
höher als die vier vorhergehenden, nur zum Tragen
des Rohres dienenden Riegel liegt; er liegt zum
Teil auf dem hintersten dieser vier Riegel, beider-
seits greift er mit seinen Enden in Ausschnitte
der Lafettenwände ein und ist so in erster Linie
dazu bestimmt, den Rückstofs des Rohres beim
Behufs aufzufangen, wobei ihn der den Mündungs-
ring tragende Vorderriegel unterstützt.
Das Rohr wird durch drei starke, auf den Lafet-
tenwänden befestigte Eisenbänder in seiner Lage
festgehalten (s. Abb. 1 und 3).
Hinter dem zweiten Riegel der Oberlafette
befindet sich die 9 cm starke eiserne Schildzapfen-
achse, welche zwischen den Wänden quadratisch,
aufsen in ihren drehbar lagernden Enden zylin-
drisch gestaltet ist. Von beiden letzteren ist der
rechte so erheblich länger, dafs eine Absicht,
kein Zufall, vorzuliegen scheint. Kurz vor dem
hinteren Ende befindet sich eine zylindrische
Durchbohrung, in welcher lose ein nicht durch-
laufender, allem Anschein nach zur Handhabung
der Lafette dienender Eisenbolzen lagert. Für
den gleichen Zweck sind die Lafettenwände am
hinteren und vorderen unteren Ende abgerundet.
Die Oberlafette ist gleich der Unterlafette reich
verziert und trägt aufserdem auf beiden Seiten in
gotischen Buchstaben geschnitzte Aufschriften.
Links: Durch Gottes Hülffe und defsen Ehrn
Thu ich mich wiedr die Feinde wehrn.
Rechts: Ich getroste mich auch seines beystandts
Drumb streit ich wegen des Vatterlands.
Bei der Stellung- der Lafette, welche die Ab-
bildung zeigt, besitzt das Rohr eine Erhöhung
von 2o°, bei herausgezogenen Haltebolzen ergibt
sich eine solche von 40 °. Das Feststellen der
Lafette für Erhöhungen unter 200 geschah jeden-
falls durch Zwischenstecken von Holzkeilen, wie dies
die Zeichnung eines im 18. Jahrhundert im Haupt-
zeug-haus noch vorhandenen Geschützes gleicher
Rohr- und Lafetten-Einrichtung in einem in der
Kgl. Sekundogeniturbibliothek befindlichen Band
artilleristischer Zeichnungen darstellt (s. Abb. 4).
Die versuchte annähernde Berechnung des
Lafettengewichts ergibt rund 1390 kg-, wodurch
Abb. 4.
Photographie nach einer Zeichnung in der Kgl. Sekundogeniturbibliothek zu Dresden.