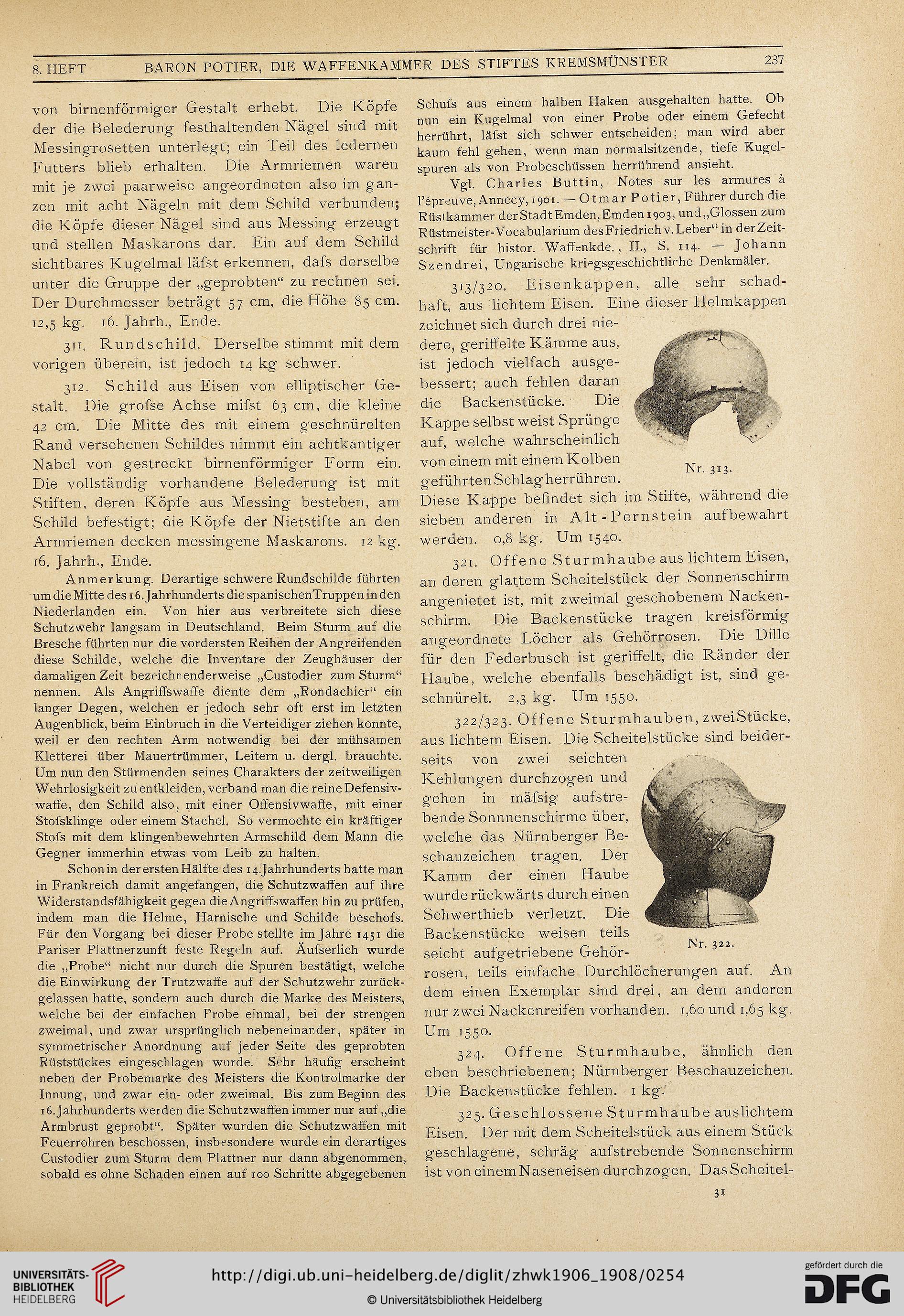8. HEFT
BARON POTIER, DIE WAFFENKAMMRR DES STIFTES KREMSMÜNSTER
237
von birnenförmiger Gestalt erhebt. Die Köpfe
der die Belederung festhaltenden Nägel sind mit
Messingrosetten unterlegt; ein Teil des ledernen
Futters blieb erhalten. Die Armriemen waren
mit je zwei paarweise angeordneten also im gan-
zen mit acht Nägeln mit dem Schild verbunden;
die Köpfe dieser Nägel sind aus Messing erzeugt
und stellen Maskarons dar. Ein auf dem Schild
sichtbares Kugelmal läfst erkennen, dafs derselbe
unter die Gruppe der „geprobten“ zu rechnen sei.
Der Durchmesser beträgt 57 cm, die Höhe 85 cm.
12,5 kg. 16. Jahrh., Ende.
311. Rundschild. Derselbe stimmt mit dem
vorigen überein, ist jedoch 14 kg schwer.
312. Schild aus Eisen von elliptischer Ge-
stalt. Die grofse Achse mifst 63 cm, die kleine
42 cm. Die Mitte des mit einem geschnürelten
Rand versehenen Schildes nimmt ein achtkantiger
Nabel von gestreckt birnenförmiger Form ein.
Die vollständig- vorhandene Belederung ist mit
Stiften, deren Köpfe aus Messing bestehen, am
Schild befestigt; die Köpfe der Nietstifte an den
Armriemen decken messingene Maskarons. 12 kg.
16. Jahrh., Ende.
Anmerkung. Derartige schwere Rundschilde führten
umdieMitte des 16.Jahrhunderts diespanischenTruppeninden
Niederlanden ein. Von hier aus verbreitete sich diese
Schutzwehr langsam in Deutschland. Beim Sturm auf die
Bresche führten nur die vordersten Reihen der Angreifenden
diese Schilde, welche die Inventare der Zeughäuser der
damaligen Zeit bezeichnenderweise „Custodier zum Sturm“
nennen. Als Angriffswaffe diente dem „Rondachier“ ein
langer Degen, welchen er jedoch sehr oft erst im letzten
Augenblick, beim Einbruch in die Verteidiger ziehen konnte,
weil er den rechten Arm notwendig bei der mühsamen
Kletterei über Mauertrümmer, Leitern u. dergl. brauchte.
Um nun den Stürmenden seines Charakters der zeitweiligen
Wehrlosigkeit zu entkleiden, verband man die reine Defensiv-
waffe, den Schild also, mit einer Offensivwaffe, mit einer
Stofsklinge oder einem Stachel. So vermochte ein kräftiger
Stofs mit dem klingenbewehrten Armschild dem Mann die
Gegner immerhin etwas vom Leib zu halten.
Schon in der ersten Hälfte des ^.Jahrhunderts hatte man
in Frankreich damit angefangen, die Schutzwaffen auf ihre
Widerstandsfähigkeit gegen die Angriffswaffen hin zu prüfen,
indem man die Helme, Harnische und Schilde beschofs.
Für den Vorgang bei dieser Probe stellte im Jahre 1451 die
Pariser Piattnerzunft feste Regeln auf. Äufserlich wurde
die „Probe“ nicht nur durch die Spuren bestätigt, welche
die Einwirkung der Trutzwaffe auf der Schutzwehr zurück-
gelassen hatte, sondern auch durch die Marke des Meisters,
welche bei der einfachen Probe einmal, bei der strengen
zweimal, und zwar ursprünglich nebeneinander, später in
symmetrischer Anordnung auf jeder Seite des geprobten
Rüststückes eingeschlagen wurde. Sehr häufig erscheint
neben der Probemarke des Meisters die Kontrolmarke der
Innung, und zwar ein- oder zweimal. Bis zum Beginn des
16. Jahrhunderts werden die Schutzwaffen immer nur auf „die
Armbrust geprobt“. Später wurden die Schutzwaffen mit
Feuerrohren beschossen, insbesondere wurde ein derartiges
Custodier zum Sturm dem Plattner nur dann abgenommen,
sobald es ohne Schaden einen auf 100 Schritte abgegebenen
Schufs aus einem halben Haken ausgehalten hatte. Ob
nun ein Kugelmal von einer Probe oder einem Gefecht
herrührt, läfst sich schwer entscheiden; man wird aber
kaum fehl gehen, wenn man normalsitzende, tiefe Kugel-
spuren als von Probeschüssen herrührend ansieht.
Vgl. Charles Buttin, Notes sur les armures ä
fepreuve, Annecy, 1901. — Otmar Potier,Führer durch die
Rüstkammer derStadtEmden,Emden 1903, und„Glossen zum
Rüstmeister-Vocabularium desFriedrichv. Leber“ in derZeit-
schrift für histor. Waffenkde. , II., S. 114. — Johann
Szendrei, Ungarische kriegsgeschichtlirhe Denkmäler.
313/320. Eisenkappen, alle sehr schad-
haft, aus lichtem Eisen. Eine dieser Helmkappen
zeichnet sich durch drei nie-
dere, geriffelte Kämme aus,
ist jedoch vielfach ausge-
bessert; auch fehlen daran
die Backenstücke. Die
Kappe selbst weist Sprünge
auf, welche wahrscheinlich
von einem mit einem Kolben
geführten Schlag herrühren.
Diese Kappe befindet sich im Stifte, während die
sieben anderen in Alt - Pernstein aufbewahrt
werden. 0,8 kg. Um 1540.
321. Offene Sturmhaube aus lichtem Eisen,
an deren glattem Scheitelstück der Sonnenschirm
angenietet ist, mit zweimal geschobenem Nacken-
schirm. Die Backenstücke tragen kreisförmig
angeordnete Löcher als Gehörrosen. Die Dille
für den Federbusch ist geriffelt, die Ränder der
Haube, welche ebenfalls beschädigt ist, sind ge-
schnürelt. 2,3 kg. Um 1550.
322/323. Offene Sturmhauben, zweiStücke,
aus lichtem Eisen. Die Scheitelstücke sind beider-
seits von zwei seichten
Kehlungen durchzogen und
gehen in mäfsig aufstre-
bende Sonnnenschirme über,
welche das Nürnberger Be-
schauzeichen tragen. Der
Kamm der einen Haube
wurde rückwärts durch einen
Schwerthieb verletzt. Die
Backenstücke weisen teils
seicht aufgetriebene Gehör-
rosen, teils einfache Durchlöcherungen auf. An
dem einen Exemplar sind drei, an dem anderen
nur zwei Nackenreifen vorhanden. 1,60 und 1,65 kg.
Um 1550.
324. Offene Sturmhaube, ähnlich den
eben beschriebenen; Nürnberger Beschauzeichen.
Die Backenstücke fehlen. 1 kg.
325. Geschlossene Sturmhaube auslichtem
Eisen. Der mit dem Scheitelstück aus einem Stück
geschlagene, schräg aufstrebende Sonnenschirm
ist von einem Naseneisen durchzogen. DasScheitel-
Nr. 313.
Nr. 322.
3i
BARON POTIER, DIE WAFFENKAMMRR DES STIFTES KREMSMÜNSTER
237
von birnenförmiger Gestalt erhebt. Die Köpfe
der die Belederung festhaltenden Nägel sind mit
Messingrosetten unterlegt; ein Teil des ledernen
Futters blieb erhalten. Die Armriemen waren
mit je zwei paarweise angeordneten also im gan-
zen mit acht Nägeln mit dem Schild verbunden;
die Köpfe dieser Nägel sind aus Messing erzeugt
und stellen Maskarons dar. Ein auf dem Schild
sichtbares Kugelmal läfst erkennen, dafs derselbe
unter die Gruppe der „geprobten“ zu rechnen sei.
Der Durchmesser beträgt 57 cm, die Höhe 85 cm.
12,5 kg. 16. Jahrh., Ende.
311. Rundschild. Derselbe stimmt mit dem
vorigen überein, ist jedoch 14 kg schwer.
312. Schild aus Eisen von elliptischer Ge-
stalt. Die grofse Achse mifst 63 cm, die kleine
42 cm. Die Mitte des mit einem geschnürelten
Rand versehenen Schildes nimmt ein achtkantiger
Nabel von gestreckt birnenförmiger Form ein.
Die vollständig- vorhandene Belederung ist mit
Stiften, deren Köpfe aus Messing bestehen, am
Schild befestigt; die Köpfe der Nietstifte an den
Armriemen decken messingene Maskarons. 12 kg.
16. Jahrh., Ende.
Anmerkung. Derartige schwere Rundschilde führten
umdieMitte des 16.Jahrhunderts diespanischenTruppeninden
Niederlanden ein. Von hier aus verbreitete sich diese
Schutzwehr langsam in Deutschland. Beim Sturm auf die
Bresche führten nur die vordersten Reihen der Angreifenden
diese Schilde, welche die Inventare der Zeughäuser der
damaligen Zeit bezeichnenderweise „Custodier zum Sturm“
nennen. Als Angriffswaffe diente dem „Rondachier“ ein
langer Degen, welchen er jedoch sehr oft erst im letzten
Augenblick, beim Einbruch in die Verteidiger ziehen konnte,
weil er den rechten Arm notwendig bei der mühsamen
Kletterei über Mauertrümmer, Leitern u. dergl. brauchte.
Um nun den Stürmenden seines Charakters der zeitweiligen
Wehrlosigkeit zu entkleiden, verband man die reine Defensiv-
waffe, den Schild also, mit einer Offensivwaffe, mit einer
Stofsklinge oder einem Stachel. So vermochte ein kräftiger
Stofs mit dem klingenbewehrten Armschild dem Mann die
Gegner immerhin etwas vom Leib zu halten.
Schon in der ersten Hälfte des ^.Jahrhunderts hatte man
in Frankreich damit angefangen, die Schutzwaffen auf ihre
Widerstandsfähigkeit gegen die Angriffswaffen hin zu prüfen,
indem man die Helme, Harnische und Schilde beschofs.
Für den Vorgang bei dieser Probe stellte im Jahre 1451 die
Pariser Piattnerzunft feste Regeln auf. Äufserlich wurde
die „Probe“ nicht nur durch die Spuren bestätigt, welche
die Einwirkung der Trutzwaffe auf der Schutzwehr zurück-
gelassen hatte, sondern auch durch die Marke des Meisters,
welche bei der einfachen Probe einmal, bei der strengen
zweimal, und zwar ursprünglich nebeneinander, später in
symmetrischer Anordnung auf jeder Seite des geprobten
Rüststückes eingeschlagen wurde. Sehr häufig erscheint
neben der Probemarke des Meisters die Kontrolmarke der
Innung, und zwar ein- oder zweimal. Bis zum Beginn des
16. Jahrhunderts werden die Schutzwaffen immer nur auf „die
Armbrust geprobt“. Später wurden die Schutzwaffen mit
Feuerrohren beschossen, insbesondere wurde ein derartiges
Custodier zum Sturm dem Plattner nur dann abgenommen,
sobald es ohne Schaden einen auf 100 Schritte abgegebenen
Schufs aus einem halben Haken ausgehalten hatte. Ob
nun ein Kugelmal von einer Probe oder einem Gefecht
herrührt, läfst sich schwer entscheiden; man wird aber
kaum fehl gehen, wenn man normalsitzende, tiefe Kugel-
spuren als von Probeschüssen herrührend ansieht.
Vgl. Charles Buttin, Notes sur les armures ä
fepreuve, Annecy, 1901. — Otmar Potier,Führer durch die
Rüstkammer derStadtEmden,Emden 1903, und„Glossen zum
Rüstmeister-Vocabularium desFriedrichv. Leber“ in derZeit-
schrift für histor. Waffenkde. , II., S. 114. — Johann
Szendrei, Ungarische kriegsgeschichtlirhe Denkmäler.
313/320. Eisenkappen, alle sehr schad-
haft, aus lichtem Eisen. Eine dieser Helmkappen
zeichnet sich durch drei nie-
dere, geriffelte Kämme aus,
ist jedoch vielfach ausge-
bessert; auch fehlen daran
die Backenstücke. Die
Kappe selbst weist Sprünge
auf, welche wahrscheinlich
von einem mit einem Kolben
geführten Schlag herrühren.
Diese Kappe befindet sich im Stifte, während die
sieben anderen in Alt - Pernstein aufbewahrt
werden. 0,8 kg. Um 1540.
321. Offene Sturmhaube aus lichtem Eisen,
an deren glattem Scheitelstück der Sonnenschirm
angenietet ist, mit zweimal geschobenem Nacken-
schirm. Die Backenstücke tragen kreisförmig
angeordnete Löcher als Gehörrosen. Die Dille
für den Federbusch ist geriffelt, die Ränder der
Haube, welche ebenfalls beschädigt ist, sind ge-
schnürelt. 2,3 kg. Um 1550.
322/323. Offene Sturmhauben, zweiStücke,
aus lichtem Eisen. Die Scheitelstücke sind beider-
seits von zwei seichten
Kehlungen durchzogen und
gehen in mäfsig aufstre-
bende Sonnnenschirme über,
welche das Nürnberger Be-
schauzeichen tragen. Der
Kamm der einen Haube
wurde rückwärts durch einen
Schwerthieb verletzt. Die
Backenstücke weisen teils
seicht aufgetriebene Gehör-
rosen, teils einfache Durchlöcherungen auf. An
dem einen Exemplar sind drei, an dem anderen
nur zwei Nackenreifen vorhanden. 1,60 und 1,65 kg.
Um 1550.
324. Offene Sturmhaube, ähnlich den
eben beschriebenen; Nürnberger Beschauzeichen.
Die Backenstücke fehlen. 1 kg.
325. Geschlossene Sturmhaube auslichtem
Eisen. Der mit dem Scheitelstück aus einem Stück
geschlagene, schräg aufstrebende Sonnenschirm
ist von einem Naseneisen durchzogen. DasScheitel-
Nr. 313.
Nr. 322.
3i