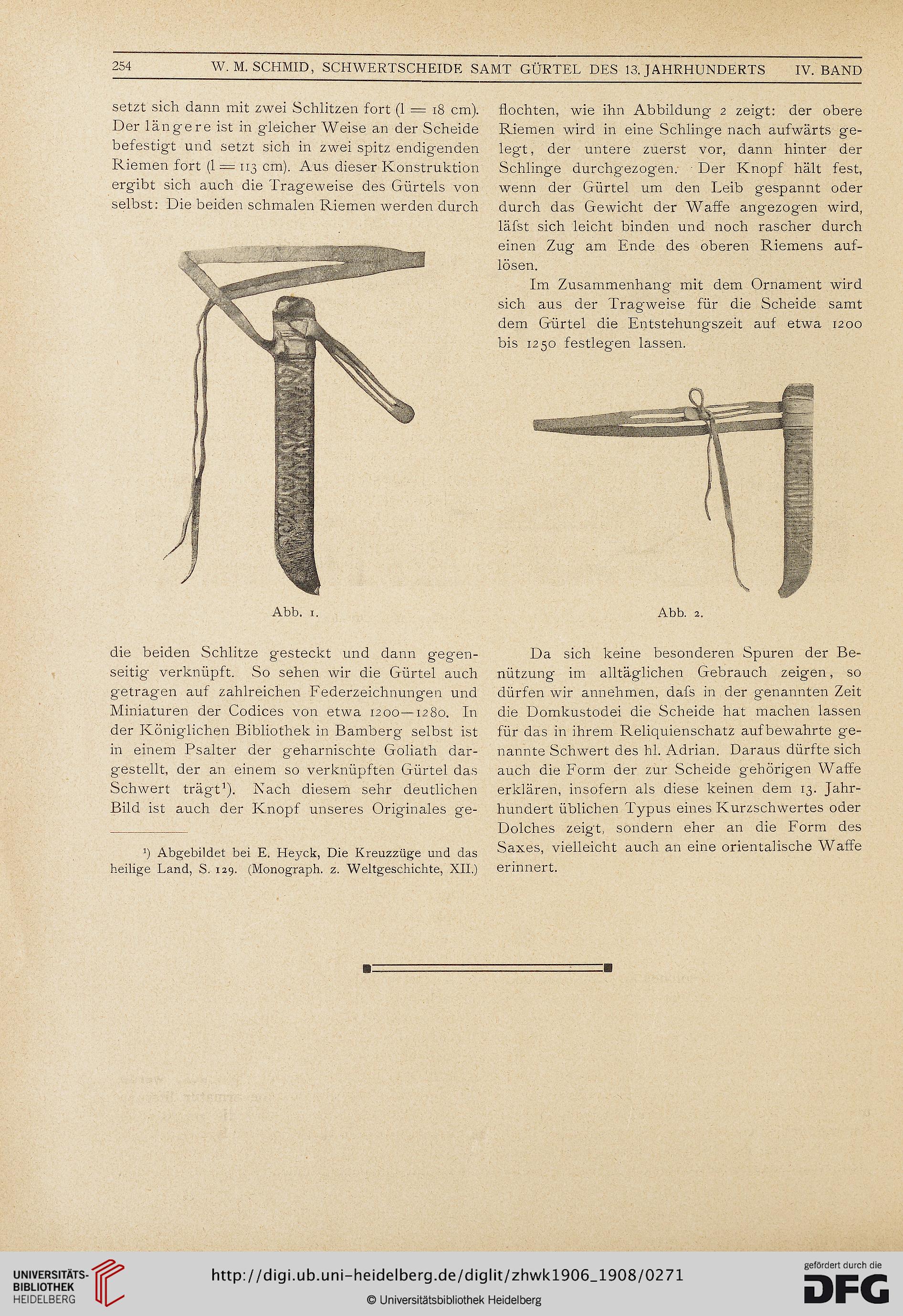254
W. M. SCHMID, SCHWERTSCHEIDE SAMT GÜRTEL DES 13. JAHRHUNDERTS IV. BAND
setzt sich dann mit zwei Schlitzen fort (1 = 18 cm).
Der längere ist in gleicher Weise an der Scheide
befestigt und setzt sich in zwei spitz endigenden
Riemen fort (1 = 113 cm). Aus dieser Konstruktion
ergibt sich auch die Trageweise des Gürtels von
selbst: Die beiden schmalen Riemen werden durch
die beiden Schlitze gesteckt und dann gegen-
seitig verknüpft. So sehen wir die Gürtel auch
getragen auf zahlreichen Federzeichnungen und
Miniaturen der Codices von etwa 1200—1280. In
der Königlichen Bibliothek in Bamberg selbst ist
in einem Psalter der geharnischte Goliath dar-
gestellt, der an einem so verknüpften Gürtel das
Schwert trägt1). Nach diesem sehr deutlichen
Bild ist auch der Knopf unseres Originales ge-
Ü Abgebildet bei E. Heyck, Die Kreuzzüge und das
heilige Land, S. 129. (Monograph, z. Weltgeschichte, XII.)
flochten, wie ihn Abbildung 2 zeigt: der obere
Riemen wird in eine Schlinge nach aufwärts ge-
legt , der untere zuerst vor, dann hinter der
Schlinge durchgezogen. Der Knopf hält fest,
wenn der Gürtel um den Leib gespannt oder
durch das Gewicht der Waffe angezogen wird,
läfst sich leicht binden und noch rascher durch
einen Zug am Ende des oberen Riemens auf-
lösen.
Im Zusammenhang mit dem Ornament wird
sich aus der Tragweise für die Scheide samt
dem Gürtel die Entstehungszeit auf etwa 1200
bis 1250 festlegen lassen.
Abb. 2.
Da sich keine besonderen Spuren der Be-
nützung im alltäglichen Gebrauch zeigen, so
dürfen wir annehmen, dafs in der genannten Zeit
die Domkustodei die Scheide hat machen lassen
für das in ihrem Reliquienschatz aufbewahrte ge-
nannte Schwert des hl. Adrian. Daraus dürfte sich
auch die Form der zur Scheide gehörigen Waffe
erklären, insofern als diese keinen dem 13. Jahr-
hundert üblichen Typus eines Kurzschwertes oder
Dolches zeigt, sondern eher an die Form des
Saxes, vielleicht auch an eine orientalische Waffe
erinnert.
W. M. SCHMID, SCHWERTSCHEIDE SAMT GÜRTEL DES 13. JAHRHUNDERTS IV. BAND
setzt sich dann mit zwei Schlitzen fort (1 = 18 cm).
Der längere ist in gleicher Weise an der Scheide
befestigt und setzt sich in zwei spitz endigenden
Riemen fort (1 = 113 cm). Aus dieser Konstruktion
ergibt sich auch die Trageweise des Gürtels von
selbst: Die beiden schmalen Riemen werden durch
die beiden Schlitze gesteckt und dann gegen-
seitig verknüpft. So sehen wir die Gürtel auch
getragen auf zahlreichen Federzeichnungen und
Miniaturen der Codices von etwa 1200—1280. In
der Königlichen Bibliothek in Bamberg selbst ist
in einem Psalter der geharnischte Goliath dar-
gestellt, der an einem so verknüpften Gürtel das
Schwert trägt1). Nach diesem sehr deutlichen
Bild ist auch der Knopf unseres Originales ge-
Ü Abgebildet bei E. Heyck, Die Kreuzzüge und das
heilige Land, S. 129. (Monograph, z. Weltgeschichte, XII.)
flochten, wie ihn Abbildung 2 zeigt: der obere
Riemen wird in eine Schlinge nach aufwärts ge-
legt , der untere zuerst vor, dann hinter der
Schlinge durchgezogen. Der Knopf hält fest,
wenn der Gürtel um den Leib gespannt oder
durch das Gewicht der Waffe angezogen wird,
läfst sich leicht binden und noch rascher durch
einen Zug am Ende des oberen Riemens auf-
lösen.
Im Zusammenhang mit dem Ornament wird
sich aus der Tragweise für die Scheide samt
dem Gürtel die Entstehungszeit auf etwa 1200
bis 1250 festlegen lassen.
Abb. 2.
Da sich keine besonderen Spuren der Be-
nützung im alltäglichen Gebrauch zeigen, so
dürfen wir annehmen, dafs in der genannten Zeit
die Domkustodei die Scheide hat machen lassen
für das in ihrem Reliquienschatz aufbewahrte ge-
nannte Schwert des hl. Adrian. Daraus dürfte sich
auch die Form der zur Scheide gehörigen Waffe
erklären, insofern als diese keinen dem 13. Jahr-
hundert üblichen Typus eines Kurzschwertes oder
Dolches zeigt, sondern eher an die Form des
Saxes, vielleicht auch an eine orientalische Waffe
erinnert.