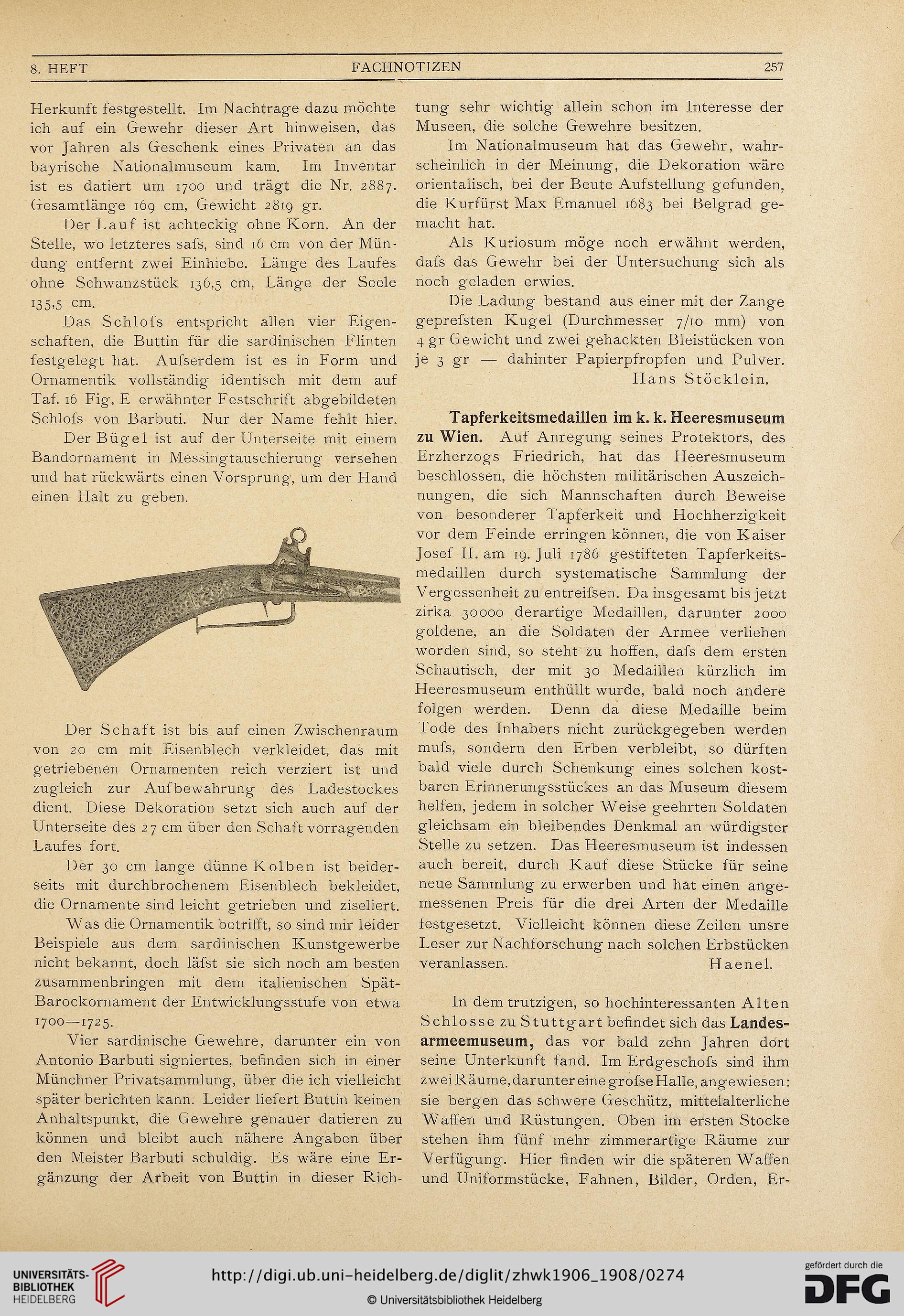8. HEFT
FACHNOTIZEN
257
Herkunft festgestellt. Im Nachtrage dazu möchte
ich auf ein Gewehr dieser Art hinweisen, das
vor Jahren als Geschenk eines Privaten an das
bayrische Nationalmuseum kam. Im Inventar
ist es datiert um 1700 und trägt die Nr. 2887.
Gesamtlänge 169 cm, Gewicht 2819 gr.
Der Lauf ist achteckig ohne Korn. An der
Stelle, wo letzteres safs, sind 16 cm von der Mün-
dung entfernt zwei Einhiebe. Länge des Laufes
ohne Schwanzstück 136,5 cm, Länge der Seele
H5>5 cm.
Das Schlofs entspricht allen vier Eigen-
schaften, die Buttin für die sardinischen Flinten
festgelegt hat. Aufserdem ist es in Form und
Ornamentik vollständig identisch mit dem auf
Taf. 16 Fig. E erwähnter Festschrift abgebildeten
Schlofs von Barbuti. Nur der Name fehlt hier.
Der Bügel ist auf der Unterseite mit einem
Bandornament in Messingtauschierung versehen
und hat rückwärts einen Vorsprung-, um der Hand
einen Halt zu geben.
Der Schaft ist bis auf einen Zwischenraum
von 20 cm mit Eisenblech verkleidet, das mit
getriebenen Ornamenten reich verziert ist und
zugleich zur Aufbewahrung des Ladestockes
dient. Diese Dekoration setzt sich auch auf der
Unterseite des 27 cm über den Schaft vorragenden
Laufes fort.
Der 30 cm lange dünne Kolben ist beider-
seits mit durchbrochenem Eisenblech bekleidet,
die Ornamente sind leicht getrieben und ziseliert.
Was die Ornamentik betrifft, so sind mir leider
Beispiele aus dem sardinischen Kunstgewerbe
nicht bekannt, doch läfst sie sich noch am besten
zusammenbringen mit dem italienischen Spät-
Barockornament der Entwicklungsstufe von etwa
1700—1725.
Vier sardinische Gewehre, darunter ein von
Antonio Barbuti signiertes, befinden sich in einer
Münchner Privatsammlung, über die ich vielleicht
später berichten kann. Leider liefert Buttin keinen
Anhaltspunkt, die Gewehre genauer datieren zu
können und bleibt auch nähere Angaben über
den Meister Barbuti schuldig. Es wäre eine Er-
gänzung der Arbeit von Buttin in dieser Rich-
tung sehr wichtig allein schon im Interesse der
Museen, die solche Gewehre besitzen.
Im Nationalmuseum hat das Gewehr, wahr-
scheinlich in der Meinung, die Dekoration wäre
orientalisch, bei der Beute Aufstellung gefunden,
die Kurfürst Max Emanuel 1683 bei Belgrad ge-
macht hat.
Als Kuriosum möge noch erwähnt werden,
dafs das Gewehr bei der Untersuchung sich als
noch geladen erwies.
Die Ladung bestand aus einer mit der Zange
geprefsten Kugel (Durchmesser 7/10 mm) von
4 gr Gewicht und zwei gehackten Bleistücken von
je 3 gr — dahinter Papierpfropfen und Pulver.
Hans Stöcklein.
Tapferkeitsmedaillen im k. k. Heeresmuseum
zu Wien. Auf Anregung seines Protektors, des
Erzherzogs Friedrich, hat das Heeresmuseum
beschlossen, die höchsten militärischen Auszeich-
nungen, die sich Mannschaften durch Beweise
von besonderer Tapferkeit und Hochherzigkeit
vor dem Feinde erringen können, die von Kaiser
Josef II. am 19. Juli 1786 gestifteten Tapferkeits-
medaillen durch systematische Sammlung der
Vergessenheit zu entreifsen. Da insgesamt bis jetzt
zirka 30000 derartige Medaillen, darunter 2000
goldene, an die Soldaten der Armee verliehen
worden sind, so steht zu hoffen, dafs dem ersten
Schautisch, der mit 30 Medaillen kürzlich im
Heeresmuseum enthüllt wurde, bald noch andere
folgen werden. Denn da diese Medaille beim
lode des Inhabers nicht zurückgegeben werden
mufs, sondern den Erben verbleibt, so dürften
bald viele durch Schenkung eines solchen kost-
baren Erinnerungsstückes an das Museum diesem
helfen, jedem in solcher Weise geehrten Soldaten
gleichsam ein bleibendes Denkmal an würdigster
Stelle zu setzen. Das Heeresmuseum ist indessen
auch bereit, durch Kauf diese Stücke für seine
neue Sammlung zu erwerben und hat einen ange-
messenen Preis für die drei Arten der Medaille
festgesetzt. Vielleicht können diese Zeilen unsre
Leser zur Nachforschung nach solchen Erbstücken
veranlassen. Haenel.
In dem trutzigen, so hochinteressanten Alten
Schlosse zu Stuttgart befindet sich das Landes-
armeemuseum, das vor bald zehn Jahren dort
seine Unterkunft fand. Im Erdgeschofs sind ihm
zwei Räume, darunter eine grofse Halle, angewiesen:
sie bergen das schwere Geschütz, mittelalterliche
Waffen und Rüstungen. Oben im ersten Stocke
stehen ihm fünf mehr zimmerartige Räume zur
Verfügung-. Hier finden wir die späteren Waffen
und Uniformstücke, Fahnen, Bilder, Orden, Er-
FACHNOTIZEN
257
Herkunft festgestellt. Im Nachtrage dazu möchte
ich auf ein Gewehr dieser Art hinweisen, das
vor Jahren als Geschenk eines Privaten an das
bayrische Nationalmuseum kam. Im Inventar
ist es datiert um 1700 und trägt die Nr. 2887.
Gesamtlänge 169 cm, Gewicht 2819 gr.
Der Lauf ist achteckig ohne Korn. An der
Stelle, wo letzteres safs, sind 16 cm von der Mün-
dung entfernt zwei Einhiebe. Länge des Laufes
ohne Schwanzstück 136,5 cm, Länge der Seele
H5>5 cm.
Das Schlofs entspricht allen vier Eigen-
schaften, die Buttin für die sardinischen Flinten
festgelegt hat. Aufserdem ist es in Form und
Ornamentik vollständig identisch mit dem auf
Taf. 16 Fig. E erwähnter Festschrift abgebildeten
Schlofs von Barbuti. Nur der Name fehlt hier.
Der Bügel ist auf der Unterseite mit einem
Bandornament in Messingtauschierung versehen
und hat rückwärts einen Vorsprung-, um der Hand
einen Halt zu geben.
Der Schaft ist bis auf einen Zwischenraum
von 20 cm mit Eisenblech verkleidet, das mit
getriebenen Ornamenten reich verziert ist und
zugleich zur Aufbewahrung des Ladestockes
dient. Diese Dekoration setzt sich auch auf der
Unterseite des 27 cm über den Schaft vorragenden
Laufes fort.
Der 30 cm lange dünne Kolben ist beider-
seits mit durchbrochenem Eisenblech bekleidet,
die Ornamente sind leicht getrieben und ziseliert.
Was die Ornamentik betrifft, so sind mir leider
Beispiele aus dem sardinischen Kunstgewerbe
nicht bekannt, doch läfst sie sich noch am besten
zusammenbringen mit dem italienischen Spät-
Barockornament der Entwicklungsstufe von etwa
1700—1725.
Vier sardinische Gewehre, darunter ein von
Antonio Barbuti signiertes, befinden sich in einer
Münchner Privatsammlung, über die ich vielleicht
später berichten kann. Leider liefert Buttin keinen
Anhaltspunkt, die Gewehre genauer datieren zu
können und bleibt auch nähere Angaben über
den Meister Barbuti schuldig. Es wäre eine Er-
gänzung der Arbeit von Buttin in dieser Rich-
tung sehr wichtig allein schon im Interesse der
Museen, die solche Gewehre besitzen.
Im Nationalmuseum hat das Gewehr, wahr-
scheinlich in der Meinung, die Dekoration wäre
orientalisch, bei der Beute Aufstellung gefunden,
die Kurfürst Max Emanuel 1683 bei Belgrad ge-
macht hat.
Als Kuriosum möge noch erwähnt werden,
dafs das Gewehr bei der Untersuchung sich als
noch geladen erwies.
Die Ladung bestand aus einer mit der Zange
geprefsten Kugel (Durchmesser 7/10 mm) von
4 gr Gewicht und zwei gehackten Bleistücken von
je 3 gr — dahinter Papierpfropfen und Pulver.
Hans Stöcklein.
Tapferkeitsmedaillen im k. k. Heeresmuseum
zu Wien. Auf Anregung seines Protektors, des
Erzherzogs Friedrich, hat das Heeresmuseum
beschlossen, die höchsten militärischen Auszeich-
nungen, die sich Mannschaften durch Beweise
von besonderer Tapferkeit und Hochherzigkeit
vor dem Feinde erringen können, die von Kaiser
Josef II. am 19. Juli 1786 gestifteten Tapferkeits-
medaillen durch systematische Sammlung der
Vergessenheit zu entreifsen. Da insgesamt bis jetzt
zirka 30000 derartige Medaillen, darunter 2000
goldene, an die Soldaten der Armee verliehen
worden sind, so steht zu hoffen, dafs dem ersten
Schautisch, der mit 30 Medaillen kürzlich im
Heeresmuseum enthüllt wurde, bald noch andere
folgen werden. Denn da diese Medaille beim
lode des Inhabers nicht zurückgegeben werden
mufs, sondern den Erben verbleibt, so dürften
bald viele durch Schenkung eines solchen kost-
baren Erinnerungsstückes an das Museum diesem
helfen, jedem in solcher Weise geehrten Soldaten
gleichsam ein bleibendes Denkmal an würdigster
Stelle zu setzen. Das Heeresmuseum ist indessen
auch bereit, durch Kauf diese Stücke für seine
neue Sammlung zu erwerben und hat einen ange-
messenen Preis für die drei Arten der Medaille
festgesetzt. Vielleicht können diese Zeilen unsre
Leser zur Nachforschung nach solchen Erbstücken
veranlassen. Haenel.
In dem trutzigen, so hochinteressanten Alten
Schlosse zu Stuttgart befindet sich das Landes-
armeemuseum, das vor bald zehn Jahren dort
seine Unterkunft fand. Im Erdgeschofs sind ihm
zwei Räume, darunter eine grofse Halle, angewiesen:
sie bergen das schwere Geschütz, mittelalterliche
Waffen und Rüstungen. Oben im ersten Stocke
stehen ihm fünf mehr zimmerartige Räume zur
Verfügung-. Hier finden wir die späteren Waffen
und Uniformstücke, Fahnen, Bilder, Orden, Er-