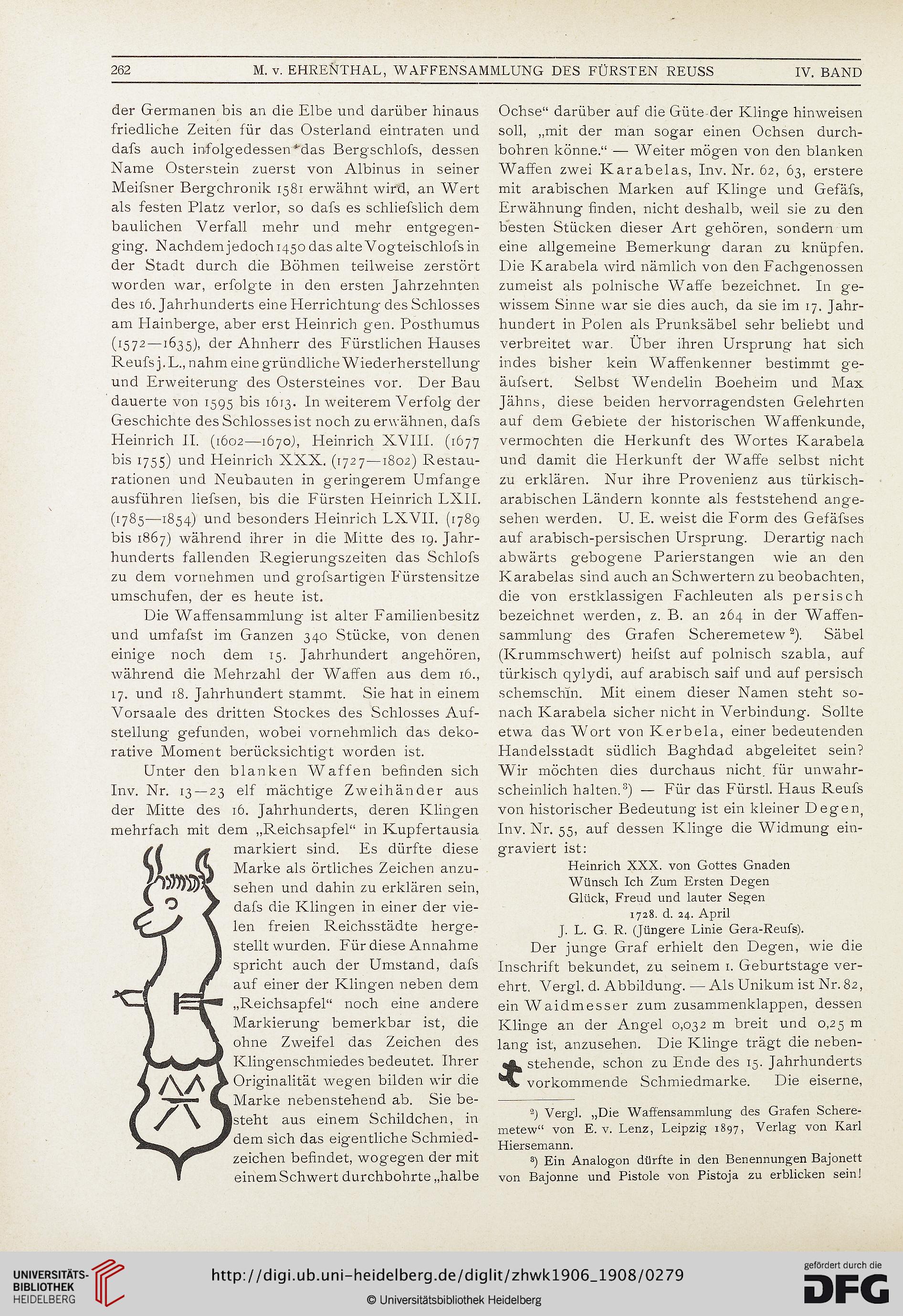262
M. v. EHRENTHAL, WAFFENSAMMLUNG DES FÜRSTEN REUSS
IV. BAND
der Germanen bis an die Elbe und darüber hinaus
friedliche Zeiten für das Osterland eintraten und
dafs auch infolgedessen Mas Bergschlofs, dessen
Name Osterstein zuerst von Albinus in seiner
Meifsner Bergchronik 1581 erwähnt wird, an Wert
als festen Platz verlor, so dafs es schliefslich dem
baulichen Verfall mehr und mehr entgegen-
ging. Nachdemjedoch.1450 das alte Vogteischlofs in
der Stadt durch die Böhmen teilweise zerstört
worden war, erfolgte in den ersten Jahrzehnten
des 16. Jahrhunderts eine Herrichtung des Schlosses
am Plainberge, aber erst Heinrich gen. Posthumus
(1572 —1635), der Ahnherr des Fürstlichen Hauses
Reufs j.L., nahm eine gründliche Wiederherstellung
und Erweiterung des Ostersteines vor. Der Bau
dauerte von 1595 bis 1613. In weiterem Verfolg der
Geschichte des Schlosses ist noch zu erwähnen, dafs
Pleinrich I.I. (1602—1670.), Heinrich XVIII. (1677
bis U55) und Heinrich XXX. (1727—1802) Restau-
rationen und Neubauten in geringerem Umfange
ausführen liefsen, bis die Fürsten Heinrich LXII.
(r785—1854) und besonders Heinrich LXVII. (1789
bis 1867) während ihrer in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts fallenden Regierungszeiten das Schlofs
zu dem vornehmen und grofsartigen Fürstensitze
umschufen, der es heute ist.
Die Waffensammlung ist alter Familienbesitz
und umfafst im Ganzen 340 Stücke, von denen
einige noch dem 15. Jahrhundert angehören,
während die Mehrzahl der Waffen aus dem 16.,
17. und 18. Jahrhundert stammt. Sie hat in einem
Vorsaale des dritten Stockes des Schlosses Auf-
stellung gefunden, wobei vornehmlich das deko-
rative Moment berücksichtiget worden ist.
Unter den blanken Waffen befinden sich
Inv. Nr. 13 — 23 elf mächtige Zweihänder aus
der Mitte des 16. Jahrhunderts, deren Klingen
mehrfach mit dem „Reichsapfel“ in Kupfertausia
si jk markiert sind. Es dürfte diese
S| Marke als örtliches Zeichen anzu-
sehen und dahin zu erklären sein,
dafs die Klingen in einer der vie-
len freien Reichsstädte herge-
stellt wurden. Für diese Annahme
spricht auch der Umstand, dafs
auf einer der Klingen neben dem
„Reichsapfel“ noch eine andere
Markierung bemerkbar ist, die
ohne Zweifel das Zeichen des
Klingenschmiedes bedeutet. Ihrer
Originalität wegen bilden wir die
Marke nebenstehend ab. Sie be-
Isteht aus einem Schildchen, in
dem sich das eigentliche Schmied-
zeichen befindet, wogegen der mit
einemSchwert durchbohrte „halbe
Ochse“ darüber auf die Güte der Klinge hinweisen
soll, „mit der man sogar einen Ochsen durch-
bohren könne.“ — Weiter mögen von den blanken
Waffen zwei Karabelas, Inv. Nr. 62, 63, erstere
mit arabischen Marken auf Klinge und Gefäfs,
Erwähnung finden, nicht deshalb, weil sie zu den
besten Stücken dieser Art gehören, sondern um
eine allgemeine Bemerkung daran zu knüpfen.
Die Karabela wird nämlich von den Fachgenossen
zumeist als polnische Waffe bezeichnet. In ge-
wissem Sinne war sie dies auch, da sie im 17. Jahr-
hundert in Polen als Prunksäbel sehr beliebt und
verbreitet war. Über ihren Ursprung hat sich
indes bisher kein Waffenkenner bestimmt ge-
äufsert. Selbst Wendelin Boeheim und Max
Jähns, diese beiden hervorragendsten Gelehrten
auf dem Gebiete der historischen Waffenkunde,
vermochten die Herkunft des Wortes Karabela
und damit die Herkunft der Waffe selbst nicht
zu erklären. Nur ihre Provenienz aus türkisch-
arabischen Ländern konnte als feststehend ange-
sehen werden. U. E. weist die Form des Gefäfses
auf arabisch-persischen Ursprung. Derartig nach
abwärts gebogene Parierstangen wie an den
Karabelas sind auch an Schwertern zu beobachten,
die von erstklassigen Fachleuten als persisch
bezeichnet werden, z. B. an 264 in der Waffen-
sammlung des Grafen Scheremetew2). Säbel
(Krummschwert) heifst auf polnisch szabla, auf
türkisch qylydi, auf arabisch saif und auf persisch
schemschin. Mit einem dieser Namen steht so-
nach Karabela sicher nicht in Verbindung. Sollte
etwa das Wort von Kerbela, einer bedeutenden
Handelsstadt südlich Baghdad abgeleitet sein?
Wir möchten dies durchaus nicht, für unwahr-
scheinlich halten.3) — Für das Fürstl. Haus Reufs
von historischer Bedeutung ist ein kleiner Degen
Inv. Nr. 55, auf dessen Klinge die Widmung ein-
graviert ist:
Heinrich XXX. von Gottes Gnaden
Wünsch Ich Zum Ersten Degen
Glück, Freud und lauter Segen
1728. d. 24. April
J. L. G. R. (Jüngere Linie Gera-Reufs).
Der junge Graf erhielt den Degen, wie die
Inschrift bekundet, zu seinem 1. Geburtstage ver-
ehrt. Vergl. d. Abbildung. — Als Unikum ist Nr. 82,
ein Waidmesser zum zusammenklappen, dessen
Klinge an der Angel 0,032 m breit und 0,25 m
lang ist, anzusehen. Die Klinge trägt die neben-
stehende, schon zu Ende des 15. Jahrhunderts
vorkommende Schmiedmarke. Die eiserne,
2) Vergl. „Die Waffensammlung des Grafen Schere-
metew“ von E. v. Lenz, Leipzig 1897, Verlag von Karl
Hiersemann.
3) Ein Analogon dürfte in den Benennungen Bajonett
von Bajonne und Pistole von Pistoja zu erblicken sein!
M. v. EHRENTHAL, WAFFENSAMMLUNG DES FÜRSTEN REUSS
IV. BAND
der Germanen bis an die Elbe und darüber hinaus
friedliche Zeiten für das Osterland eintraten und
dafs auch infolgedessen Mas Bergschlofs, dessen
Name Osterstein zuerst von Albinus in seiner
Meifsner Bergchronik 1581 erwähnt wird, an Wert
als festen Platz verlor, so dafs es schliefslich dem
baulichen Verfall mehr und mehr entgegen-
ging. Nachdemjedoch.1450 das alte Vogteischlofs in
der Stadt durch die Böhmen teilweise zerstört
worden war, erfolgte in den ersten Jahrzehnten
des 16. Jahrhunderts eine Herrichtung des Schlosses
am Plainberge, aber erst Heinrich gen. Posthumus
(1572 —1635), der Ahnherr des Fürstlichen Hauses
Reufs j.L., nahm eine gründliche Wiederherstellung
und Erweiterung des Ostersteines vor. Der Bau
dauerte von 1595 bis 1613. In weiterem Verfolg der
Geschichte des Schlosses ist noch zu erwähnen, dafs
Pleinrich I.I. (1602—1670.), Heinrich XVIII. (1677
bis U55) und Heinrich XXX. (1727—1802) Restau-
rationen und Neubauten in geringerem Umfange
ausführen liefsen, bis die Fürsten Heinrich LXII.
(r785—1854) und besonders Heinrich LXVII. (1789
bis 1867) während ihrer in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts fallenden Regierungszeiten das Schlofs
zu dem vornehmen und grofsartigen Fürstensitze
umschufen, der es heute ist.
Die Waffensammlung ist alter Familienbesitz
und umfafst im Ganzen 340 Stücke, von denen
einige noch dem 15. Jahrhundert angehören,
während die Mehrzahl der Waffen aus dem 16.,
17. und 18. Jahrhundert stammt. Sie hat in einem
Vorsaale des dritten Stockes des Schlosses Auf-
stellung gefunden, wobei vornehmlich das deko-
rative Moment berücksichtiget worden ist.
Unter den blanken Waffen befinden sich
Inv. Nr. 13 — 23 elf mächtige Zweihänder aus
der Mitte des 16. Jahrhunderts, deren Klingen
mehrfach mit dem „Reichsapfel“ in Kupfertausia
si jk markiert sind. Es dürfte diese
S| Marke als örtliches Zeichen anzu-
sehen und dahin zu erklären sein,
dafs die Klingen in einer der vie-
len freien Reichsstädte herge-
stellt wurden. Für diese Annahme
spricht auch der Umstand, dafs
auf einer der Klingen neben dem
„Reichsapfel“ noch eine andere
Markierung bemerkbar ist, die
ohne Zweifel das Zeichen des
Klingenschmiedes bedeutet. Ihrer
Originalität wegen bilden wir die
Marke nebenstehend ab. Sie be-
Isteht aus einem Schildchen, in
dem sich das eigentliche Schmied-
zeichen befindet, wogegen der mit
einemSchwert durchbohrte „halbe
Ochse“ darüber auf die Güte der Klinge hinweisen
soll, „mit der man sogar einen Ochsen durch-
bohren könne.“ — Weiter mögen von den blanken
Waffen zwei Karabelas, Inv. Nr. 62, 63, erstere
mit arabischen Marken auf Klinge und Gefäfs,
Erwähnung finden, nicht deshalb, weil sie zu den
besten Stücken dieser Art gehören, sondern um
eine allgemeine Bemerkung daran zu knüpfen.
Die Karabela wird nämlich von den Fachgenossen
zumeist als polnische Waffe bezeichnet. In ge-
wissem Sinne war sie dies auch, da sie im 17. Jahr-
hundert in Polen als Prunksäbel sehr beliebt und
verbreitet war. Über ihren Ursprung hat sich
indes bisher kein Waffenkenner bestimmt ge-
äufsert. Selbst Wendelin Boeheim und Max
Jähns, diese beiden hervorragendsten Gelehrten
auf dem Gebiete der historischen Waffenkunde,
vermochten die Herkunft des Wortes Karabela
und damit die Herkunft der Waffe selbst nicht
zu erklären. Nur ihre Provenienz aus türkisch-
arabischen Ländern konnte als feststehend ange-
sehen werden. U. E. weist die Form des Gefäfses
auf arabisch-persischen Ursprung. Derartig nach
abwärts gebogene Parierstangen wie an den
Karabelas sind auch an Schwertern zu beobachten,
die von erstklassigen Fachleuten als persisch
bezeichnet werden, z. B. an 264 in der Waffen-
sammlung des Grafen Scheremetew2). Säbel
(Krummschwert) heifst auf polnisch szabla, auf
türkisch qylydi, auf arabisch saif und auf persisch
schemschin. Mit einem dieser Namen steht so-
nach Karabela sicher nicht in Verbindung. Sollte
etwa das Wort von Kerbela, einer bedeutenden
Handelsstadt südlich Baghdad abgeleitet sein?
Wir möchten dies durchaus nicht, für unwahr-
scheinlich halten.3) — Für das Fürstl. Haus Reufs
von historischer Bedeutung ist ein kleiner Degen
Inv. Nr. 55, auf dessen Klinge die Widmung ein-
graviert ist:
Heinrich XXX. von Gottes Gnaden
Wünsch Ich Zum Ersten Degen
Glück, Freud und lauter Segen
1728. d. 24. April
J. L. G. R. (Jüngere Linie Gera-Reufs).
Der junge Graf erhielt den Degen, wie die
Inschrift bekundet, zu seinem 1. Geburtstage ver-
ehrt. Vergl. d. Abbildung. — Als Unikum ist Nr. 82,
ein Waidmesser zum zusammenklappen, dessen
Klinge an der Angel 0,032 m breit und 0,25 m
lang ist, anzusehen. Die Klinge trägt die neben-
stehende, schon zu Ende des 15. Jahrhunderts
vorkommende Schmiedmarke. Die eiserne,
2) Vergl. „Die Waffensammlung des Grafen Schere-
metew“ von E. v. Lenz, Leipzig 1897, Verlag von Karl
Hiersemann.
3) Ein Analogon dürfte in den Benennungen Bajonett
von Bajonne und Pistole von Pistoja zu erblicken sein!