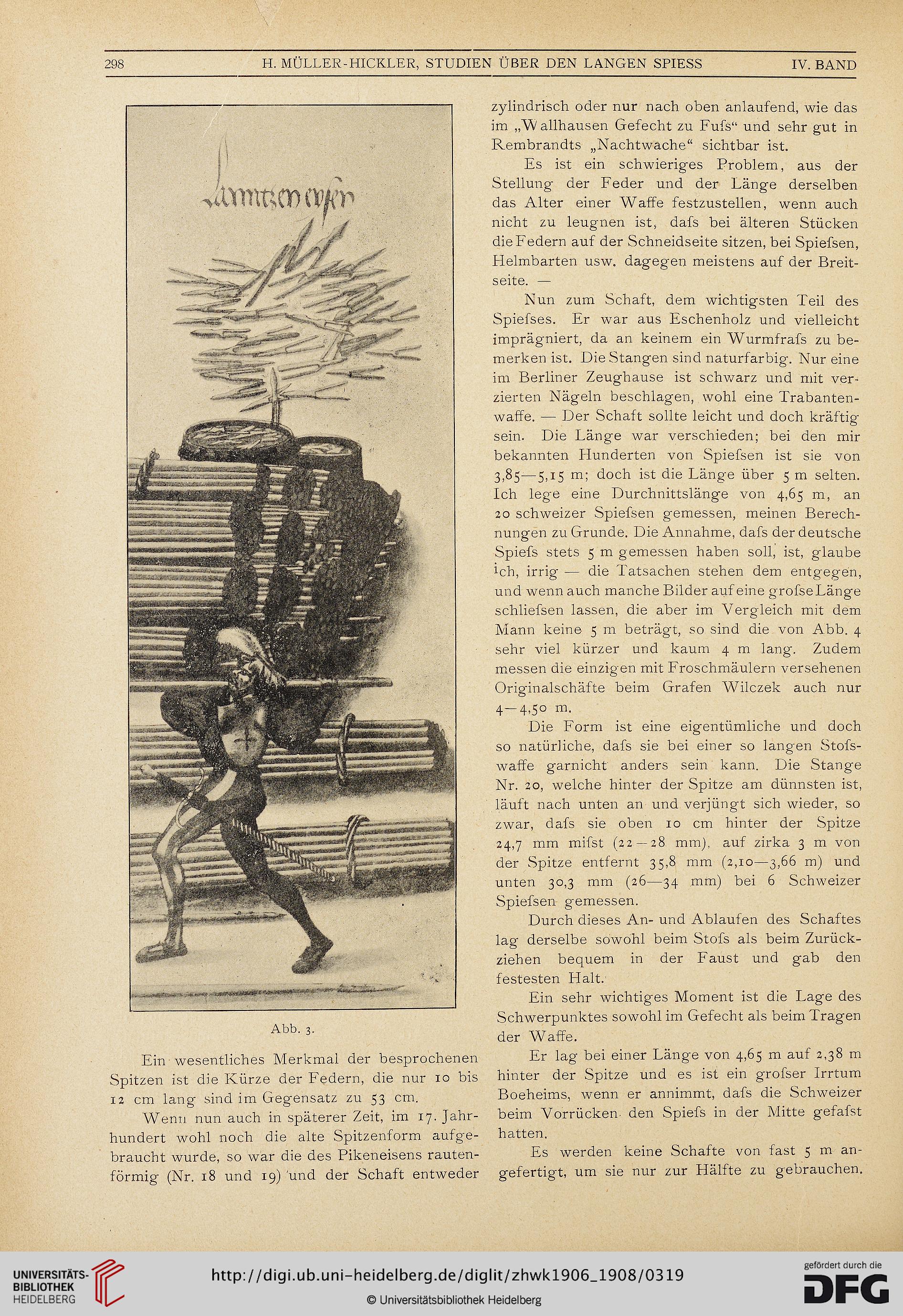298
H. MÜLLER-HICKLER, STUDIEN ÜBER DEN LANGEN SPIESS
IV. BAND
Abb. 3.
Ein wesentliches Merkmal der besprochenen
Spitzen ist die Kürze der Federn, die nur 10 bis
12 cm lang- sind im Gegensatz zu 53 cm-
Wenn nun auch in späterer Zeit, im 17. Jahr-
hundert wohl noch die alte Spitzenform aufge-
braucht wurde, so war die des Pikeneisens rauten-
förmig (Nr. 18 und 19) und der Schaft entweder
zylindrisch oder nur nach oben anlaufend, wie das
im „Wallhausen Gefecht zu Fufs“ und sehr gut in
Rembrandts „Nachtwache“ sichtbar ist.
Es ist ein schwieriges Problem, aus der
Stellung der Feder und der Länge derselben
das Alter einer Waffe festzustellen, wenn auch
nicht zu leugnen ist, dafs bei älteren Stücken
die Federn auf der Schneidseite sitzen, bei Spiefsen,
Helmbarten usw. dagegen meistens auf der Breit-
seite. —
Nun zum Schaft, dem wichtigsten Teil des
Spiefses. Er war aus Eschenholz und vielleicht
imprägniert, da an keinem ein Wurmfrafs zu be-
merken ist. Die Stangen sind naturfarbig. Nur eine
im Berliner Zeughause ist schwarz und mit ver-
zierten Nägeln beschlagen, wohl eine Trabanten-
waffe. —• Der Schaft sollte leicht und doch kräftig
sein. Die Länge war verschieden; bei den mir
bekannten Hunderten von Spiefsen ist sie von
3,85—5,15 m; doch ist die Länge über 5 m selten.
Ich lege eine Durchnittslänge von 4,65 m, an
20 schweizer Spiefsen gemessen, meinen Berech-
nungen zu Grunde. Die Annahme, dafs der deutsche
Spiefs stets 5 m gemessen haben soll, ist, glaube
ich, irrig — die Tatsachen stehen dem entgegen,
und wenn auch manche Bilder auf eine grofse Länge
schliefsen lassen, die aber im Vergleich mit dem
Mann keine 5 m beträgt, so sind die von Abb. 4
sehr viel kürzer und kaum 4 m lang. Zudem
messen die einzigen mit Froschmäulern versehenen
Originalschäfte beim Grafen Wilczek auch nur
4—4,5° m.
Die Form ist eine eigentümliche und doch
so natürliche, dafs sie bei einer so langen Stofs-
waffe garnicht anders sein kann. Die Stang'e
Nr. 20, welche hinter der Spitze am dünnsten ist,
läuft nach unten an und verjüngt sich wieder, so
zwar, dafs sie oben 10 cm hinter der Spitze
24,7 mm mifst (22 — 28 mm), auf zirka 3 m von
der Spitze entfernt 35,8 mm (2,10—3,66 m) und
unten 30,3 mm (26—34 mm) bei 6 Schweizer
Spiefsen g-emessen.
Durch dieses An- und Ablaufen des Schaftes
lag derselbe sowohl beim Stofs als beim Zurück-
ziehen bequem in der Faust und gab den
festesten Halt.
Ein sehr wichtiges Moment ist die Lage des
Schwerpunktes sowohl im Gefecht als beim Tragen
der Waffe.
Er lag bei einer Länge von 4,65 m auf 2,38 m
hinter der Spitze und es ist ein grofser Irrtum
Boeheims, wenn er annimmt, dafs die Schweizer
beim Vorrücken, den Spiefs in der Mitte gefafst
hatten.
Es werden keine Schafte von fast 5 m an-
gefertigt, um sie nur zur Hälfte zu gebrauchen.
H. MÜLLER-HICKLER, STUDIEN ÜBER DEN LANGEN SPIESS
IV. BAND
Abb. 3.
Ein wesentliches Merkmal der besprochenen
Spitzen ist die Kürze der Federn, die nur 10 bis
12 cm lang- sind im Gegensatz zu 53 cm-
Wenn nun auch in späterer Zeit, im 17. Jahr-
hundert wohl noch die alte Spitzenform aufge-
braucht wurde, so war die des Pikeneisens rauten-
förmig (Nr. 18 und 19) und der Schaft entweder
zylindrisch oder nur nach oben anlaufend, wie das
im „Wallhausen Gefecht zu Fufs“ und sehr gut in
Rembrandts „Nachtwache“ sichtbar ist.
Es ist ein schwieriges Problem, aus der
Stellung der Feder und der Länge derselben
das Alter einer Waffe festzustellen, wenn auch
nicht zu leugnen ist, dafs bei älteren Stücken
die Federn auf der Schneidseite sitzen, bei Spiefsen,
Helmbarten usw. dagegen meistens auf der Breit-
seite. —
Nun zum Schaft, dem wichtigsten Teil des
Spiefses. Er war aus Eschenholz und vielleicht
imprägniert, da an keinem ein Wurmfrafs zu be-
merken ist. Die Stangen sind naturfarbig. Nur eine
im Berliner Zeughause ist schwarz und mit ver-
zierten Nägeln beschlagen, wohl eine Trabanten-
waffe. —• Der Schaft sollte leicht und doch kräftig
sein. Die Länge war verschieden; bei den mir
bekannten Hunderten von Spiefsen ist sie von
3,85—5,15 m; doch ist die Länge über 5 m selten.
Ich lege eine Durchnittslänge von 4,65 m, an
20 schweizer Spiefsen gemessen, meinen Berech-
nungen zu Grunde. Die Annahme, dafs der deutsche
Spiefs stets 5 m gemessen haben soll, ist, glaube
ich, irrig — die Tatsachen stehen dem entgegen,
und wenn auch manche Bilder auf eine grofse Länge
schliefsen lassen, die aber im Vergleich mit dem
Mann keine 5 m beträgt, so sind die von Abb. 4
sehr viel kürzer und kaum 4 m lang. Zudem
messen die einzigen mit Froschmäulern versehenen
Originalschäfte beim Grafen Wilczek auch nur
4—4,5° m.
Die Form ist eine eigentümliche und doch
so natürliche, dafs sie bei einer so langen Stofs-
waffe garnicht anders sein kann. Die Stang'e
Nr. 20, welche hinter der Spitze am dünnsten ist,
läuft nach unten an und verjüngt sich wieder, so
zwar, dafs sie oben 10 cm hinter der Spitze
24,7 mm mifst (22 — 28 mm), auf zirka 3 m von
der Spitze entfernt 35,8 mm (2,10—3,66 m) und
unten 30,3 mm (26—34 mm) bei 6 Schweizer
Spiefsen g-emessen.
Durch dieses An- und Ablaufen des Schaftes
lag derselbe sowohl beim Stofs als beim Zurück-
ziehen bequem in der Faust und gab den
festesten Halt.
Ein sehr wichtiges Moment ist die Lage des
Schwerpunktes sowohl im Gefecht als beim Tragen
der Waffe.
Er lag bei einer Länge von 4,65 m auf 2,38 m
hinter der Spitze und es ist ein grofser Irrtum
Boeheims, wenn er annimmt, dafs die Schweizer
beim Vorrücken, den Spiefs in der Mitte gefafst
hatten.
Es werden keine Schafte von fast 5 m an-
gefertigt, um sie nur zur Hälfte zu gebrauchen.