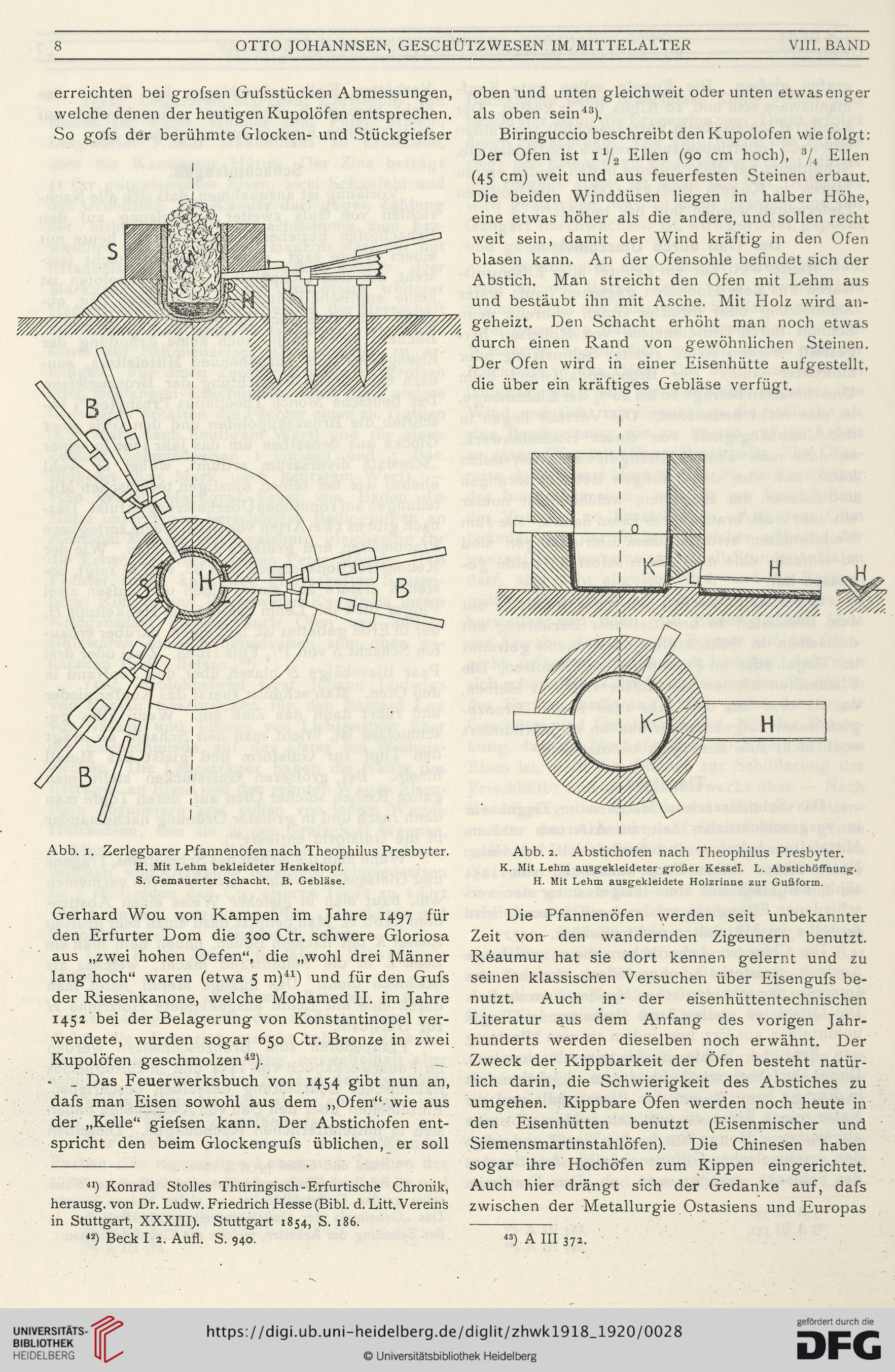8
OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER
VIII. BAND
erreichten bei grofsen Gufsstücken Abmessungen,
welche denen der heutigen Kupolöfen entsprechen.
So gofs der berühmte Glocken- und Stückgiefser
Abb. i. Zerlegbarer Pfannenofen nach Theophilus Presbyter.
H. Mit Lehm bekleideter Henkeltopf.
S. Gemauerter Schacht. B. Gebläse.
oben und unten gleich weit oder unten etwas enger
als oben sein43).
Biringuccio beschreibt den Kupolofen wie folgt:
Der Ofen ist 1*/2 Ellen (90 cm hoch), 3/4 Ellen
(45 cm) weit und aus feuerfesten Steinen erbaut.
Die beiden Winddüsen liegen in halber Höhe,
eine etwas höher als die andere, und sollen recht
weit sein, damit der Wind kräftig in den Ofen
blasen kann. An der Ofensohle befindet sich der
Abstich. Man streicht den Ofen mit Lehm aus
und bestäubt ihn mit Asche. Mit Holz wird an-
geheizt. Den Schacht erhöht man noch etwas
durch einen Rand von gewöhnlichen Steinen.
Der Ofen wird in einer Eisenhütte aufgestellt,
die über ein kräftiges Gebläse verfügt.
Abb. 2. Abstichofen nach Theophilus Presbyter.
K. Mit Lehm ausgekleideter-großer Kessel. L. Abstichöffnung.
H. Mit Lehm ausgekleidete Holzrinne zur Gußform.
Gerhard Wou von Kämpen im Jahre 1497 für
den Erfurter Dom die 300 Ctr. schwere Gloriosa
aus „zwei hohen Oefen“, die „wohl drei Männer
lang hoch“ waren (etwa 5 m)41) und für den Gufs
der Riesenkanone, welche Mohamed II. im Jahre
1452 bei der Belagerung von Konstantinopel ver-
wendete, wurden sogar 650 Ctr. Bronze in zwei
Kupolöfen geschmolzen42). _
- _ Das Feuerwerksbuch von 1454 gibt nun an,
dafs man Eisen sowohl aus dem ,,Ofen“- wie aus
der „Kelle“ giefsen kann. Der Abstichofen ent-
spricht den beim Glockengufs üblichen, er soll
41) Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik,
herausg. von Dr. Ludw. Friedrich Hesse (Bibi. d. Litt. Vereins
in Stuttgart, XXXIII). Stuttgart 1854, S. 186.
42) Beck I 2. Aufl. S. 940.
Die Pfannenöfen werden seit unbekannter
Zeit von- den wandernden Zigeunern benutzt.
Reaumur hat sie dort kennen gelernt und zu
seinen klassischen Versuchen über Eisengufs be-
nutzt. Auch in* der eisenhüttentechnischen
Literatur aus dem Anfang des vorigen Jahr-
hunderts werden dieselben noch erwähnt. Der
Zweck der Kippbarkeit der Öfen besteht natür-
lich darin, die Schwierigkeit des Abstiches zu
umgehen. Kippbare Öfen werden noch heute in
den Eisenhütten benutzt (Eisenmischer und
Siemensmartinstahlöfen). Die Chinesen haben
sogar ihre Hochöfen zum Kippen eingerichtet.
Auch hier drängt sich der Gedanke auf, dafs
zwischen der Metallurgie Ostasiens und Europas
43) A III372.
OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER
VIII. BAND
erreichten bei grofsen Gufsstücken Abmessungen,
welche denen der heutigen Kupolöfen entsprechen.
So gofs der berühmte Glocken- und Stückgiefser
Abb. i. Zerlegbarer Pfannenofen nach Theophilus Presbyter.
H. Mit Lehm bekleideter Henkeltopf.
S. Gemauerter Schacht. B. Gebläse.
oben und unten gleich weit oder unten etwas enger
als oben sein43).
Biringuccio beschreibt den Kupolofen wie folgt:
Der Ofen ist 1*/2 Ellen (90 cm hoch), 3/4 Ellen
(45 cm) weit und aus feuerfesten Steinen erbaut.
Die beiden Winddüsen liegen in halber Höhe,
eine etwas höher als die andere, und sollen recht
weit sein, damit der Wind kräftig in den Ofen
blasen kann. An der Ofensohle befindet sich der
Abstich. Man streicht den Ofen mit Lehm aus
und bestäubt ihn mit Asche. Mit Holz wird an-
geheizt. Den Schacht erhöht man noch etwas
durch einen Rand von gewöhnlichen Steinen.
Der Ofen wird in einer Eisenhütte aufgestellt,
die über ein kräftiges Gebläse verfügt.
Abb. 2. Abstichofen nach Theophilus Presbyter.
K. Mit Lehm ausgekleideter-großer Kessel. L. Abstichöffnung.
H. Mit Lehm ausgekleidete Holzrinne zur Gußform.
Gerhard Wou von Kämpen im Jahre 1497 für
den Erfurter Dom die 300 Ctr. schwere Gloriosa
aus „zwei hohen Oefen“, die „wohl drei Männer
lang hoch“ waren (etwa 5 m)41) und für den Gufs
der Riesenkanone, welche Mohamed II. im Jahre
1452 bei der Belagerung von Konstantinopel ver-
wendete, wurden sogar 650 Ctr. Bronze in zwei
Kupolöfen geschmolzen42). _
- _ Das Feuerwerksbuch von 1454 gibt nun an,
dafs man Eisen sowohl aus dem ,,Ofen“- wie aus
der „Kelle“ giefsen kann. Der Abstichofen ent-
spricht den beim Glockengufs üblichen, er soll
41) Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik,
herausg. von Dr. Ludw. Friedrich Hesse (Bibi. d. Litt. Vereins
in Stuttgart, XXXIII). Stuttgart 1854, S. 186.
42) Beck I 2. Aufl. S. 940.
Die Pfannenöfen werden seit unbekannter
Zeit von- den wandernden Zigeunern benutzt.
Reaumur hat sie dort kennen gelernt und zu
seinen klassischen Versuchen über Eisengufs be-
nutzt. Auch in* der eisenhüttentechnischen
Literatur aus dem Anfang des vorigen Jahr-
hunderts werden dieselben noch erwähnt. Der
Zweck der Kippbarkeit der Öfen besteht natür-
lich darin, die Schwierigkeit des Abstiches zu
umgehen. Kippbare Öfen werden noch heute in
den Eisenhütten benutzt (Eisenmischer und
Siemensmartinstahlöfen). Die Chinesen haben
sogar ihre Hochöfen zum Kippen eingerichtet.
Auch hier drängt sich der Gedanke auf, dafs
zwischen der Metallurgie Ostasiens und Europas
43) A III372.