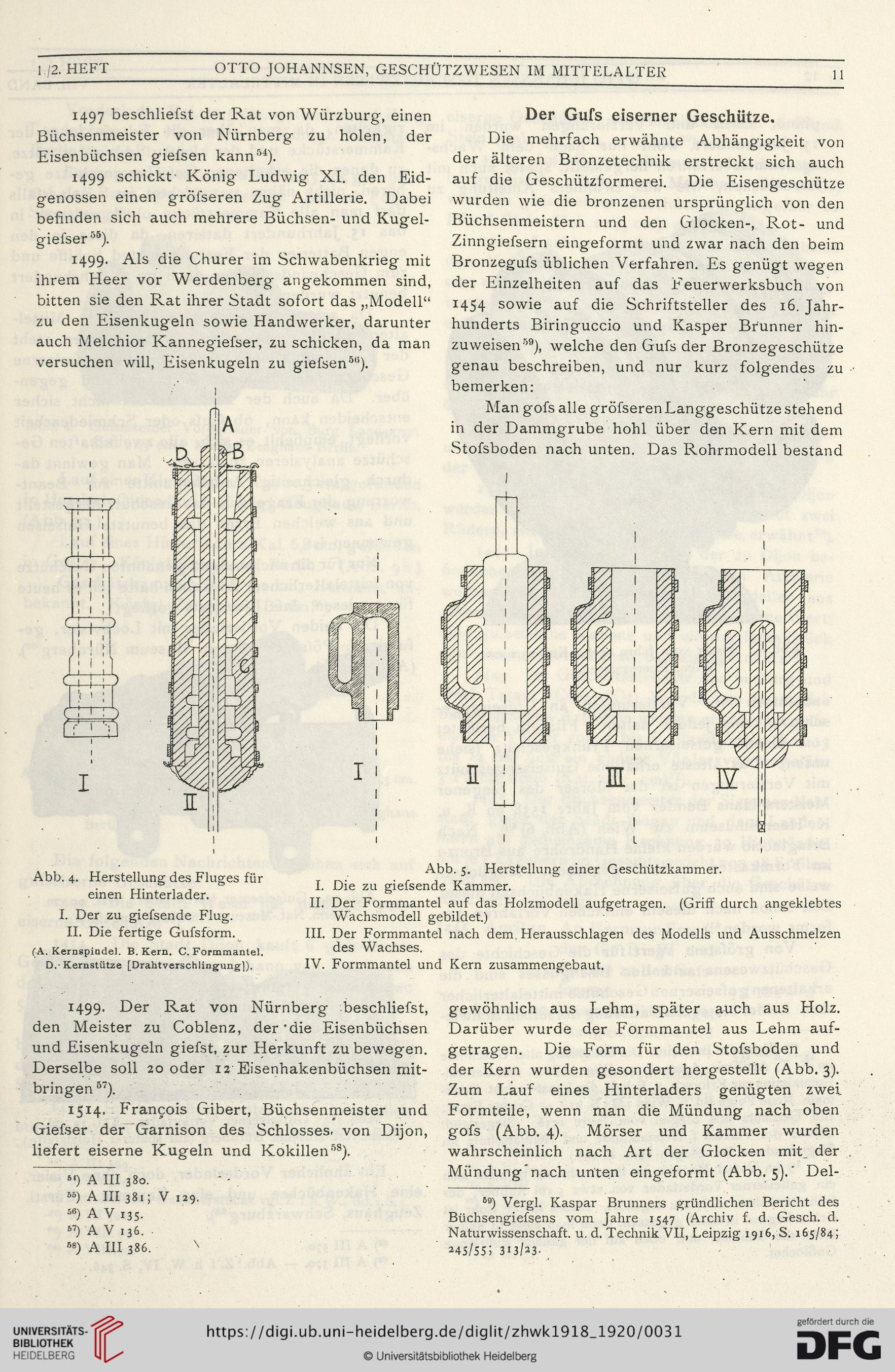1/2. HEFT
OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER
11
1497 beschliefst der Rat von Würzburg, einen
Büchsenmeister von Nürnberg zu holen, der
Eisenbüchsen giefsen kann51).
1499 schickt' König Ludwig XI. den Eid-
genossen einen gröiseren Zug Artillerie. Dabei
befinden sich auch mehrere Büchsen- und Kugel-
giefser* 55).
1499. Als die Churer im Schwabenkrieg mit
ihrem Heer vor Werdenberg angekommen sind,
bitten sie den Rat ihrer Stadt sofort das „Modell“
zu den Eisenkugeln sowie Handwerker, darunter
auch Melchior Kannegiefser, zu schicken, da man
versuchen will, Eisenkugeln zu giefsen56).
Der Gufs eiserner Geschütze.
Die mehrfach erwähnte Abhängigkeit von
der älteren Bronzetechnik erstreckt sich auch
auf die Geschützformerei. Die Eisengeschütze
wurden wie die bronzenen ursprünglich von den
Büchsenmeistern und den Glocken-, Rot- und
Zinngiefsern eingeformt und zwar nach den beim
Bronzegufs üblichen Verfahren. Es genügt wegen
der Einzelheiten auf das Feuerwerksbuch von
1454 sowie auf die Schriftsteller des 16. Jahr-
hunderts Biringuccio und Kasper Brunner hin-
zuweisen59), welche den Gufs der Bronzegeschütze
genau beschreiben, und nur kurz folgendes zu
bemerken:
Man gofs alle gröfseren Langgeschütze stehend
in der Dammgrube hohl über den Kern mit dem
Stofsboden nach unten. Das Rohrmodell bestand
Abb. 4. Herstellung des Fluges für
einen Hinterlader.
I. Der zu giefsende Flug.
II. Die fertige Gufsform.
(A. Kernspindel. B. Kern. C. Formmantel.
D.- Kernstütze [Drahtverschlingung]).
Abb. 5. Herstellung einer Geschützkammer.
I. Die zu giefsende Kammer.
II. Der Formmantel auf das Holzmodell aufgetragen. (Griff durch angeklebtes
Wächsmodell gebildet.)
III. Der Formmantel nach dem Herausschlagen des Modells und Ausschmelzen
des Wachses.
IV. Formmantel und Kern zusammengebaut.
1499. Der Rat von Nürnberg beschliefst,
den Meister zu Coblenz, der "die Eisenbüchsen
und Eisenkugeln giefst, zur Herkunft zu bewegen.
Derselbe soll 20 oder 12 Eisenhakenbüchsen mit-
bringen57 *).
1514. Francois Gibert, Büchsenmeister und
Giefser der Garnison des Schlosses, von Dijon,
liefert eiserne Kugeln und Kokillen5S).
5‘) A III 380. ' - . .
55) A III 381; V 129.
58) A V 135.
s1) A V 13 6.
fi8) A III 386. x
gewöhnlich aus Lehm, später auch aus Holz.
Darüber wurde der Formmantel aus Lehm auf-
getragen. Die Form für den Stofsboden und
der Kern wurden gesondert hergestellt (Abb. 3).
Zum Lauf eines Hinterladers genügten zwei.
Formteile, wenn man die Mündung nach oben
gofs (Abb. 4). Mörser und Kammer wurden
wahrscheinlich nach Art der Glocken mit. der
Mündung nach unten eingeformt (Abb. 5).' Del-
69) Vergl. Kaspar Brunners gründlichen Bericht des
Büchsengiefsens vom Jahre 1547 (Archiv f. d. Gesch. d.
Naturwissenschaft, u. d. Technik VII, Leipzig 1916, S. 165/84;
245/55; 313/23.
OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER
11
1497 beschliefst der Rat von Würzburg, einen
Büchsenmeister von Nürnberg zu holen, der
Eisenbüchsen giefsen kann51).
1499 schickt' König Ludwig XI. den Eid-
genossen einen gröiseren Zug Artillerie. Dabei
befinden sich auch mehrere Büchsen- und Kugel-
giefser* 55).
1499. Als die Churer im Schwabenkrieg mit
ihrem Heer vor Werdenberg angekommen sind,
bitten sie den Rat ihrer Stadt sofort das „Modell“
zu den Eisenkugeln sowie Handwerker, darunter
auch Melchior Kannegiefser, zu schicken, da man
versuchen will, Eisenkugeln zu giefsen56).
Der Gufs eiserner Geschütze.
Die mehrfach erwähnte Abhängigkeit von
der älteren Bronzetechnik erstreckt sich auch
auf die Geschützformerei. Die Eisengeschütze
wurden wie die bronzenen ursprünglich von den
Büchsenmeistern und den Glocken-, Rot- und
Zinngiefsern eingeformt und zwar nach den beim
Bronzegufs üblichen Verfahren. Es genügt wegen
der Einzelheiten auf das Feuerwerksbuch von
1454 sowie auf die Schriftsteller des 16. Jahr-
hunderts Biringuccio und Kasper Brunner hin-
zuweisen59), welche den Gufs der Bronzegeschütze
genau beschreiben, und nur kurz folgendes zu
bemerken:
Man gofs alle gröfseren Langgeschütze stehend
in der Dammgrube hohl über den Kern mit dem
Stofsboden nach unten. Das Rohrmodell bestand
Abb. 4. Herstellung des Fluges für
einen Hinterlader.
I. Der zu giefsende Flug.
II. Die fertige Gufsform.
(A. Kernspindel. B. Kern. C. Formmantel.
D.- Kernstütze [Drahtverschlingung]).
Abb. 5. Herstellung einer Geschützkammer.
I. Die zu giefsende Kammer.
II. Der Formmantel auf das Holzmodell aufgetragen. (Griff durch angeklebtes
Wächsmodell gebildet.)
III. Der Formmantel nach dem Herausschlagen des Modells und Ausschmelzen
des Wachses.
IV. Formmantel und Kern zusammengebaut.
1499. Der Rat von Nürnberg beschliefst,
den Meister zu Coblenz, der "die Eisenbüchsen
und Eisenkugeln giefst, zur Herkunft zu bewegen.
Derselbe soll 20 oder 12 Eisenhakenbüchsen mit-
bringen57 *).
1514. Francois Gibert, Büchsenmeister und
Giefser der Garnison des Schlosses, von Dijon,
liefert eiserne Kugeln und Kokillen5S).
5‘) A III 380. ' - . .
55) A III 381; V 129.
58) A V 135.
s1) A V 13 6.
fi8) A III 386. x
gewöhnlich aus Lehm, später auch aus Holz.
Darüber wurde der Formmantel aus Lehm auf-
getragen. Die Form für den Stofsboden und
der Kern wurden gesondert hergestellt (Abb. 3).
Zum Lauf eines Hinterladers genügten zwei.
Formteile, wenn man die Mündung nach oben
gofs (Abb. 4). Mörser und Kammer wurden
wahrscheinlich nach Art der Glocken mit. der
Mündung nach unten eingeformt (Abb. 5).' Del-
69) Vergl. Kaspar Brunners gründlichen Bericht des
Büchsengiefsens vom Jahre 1547 (Archiv f. d. Gesch. d.
Naturwissenschaft, u. d. Technik VII, Leipzig 1916, S. 165/84;
245/55; 313/23.