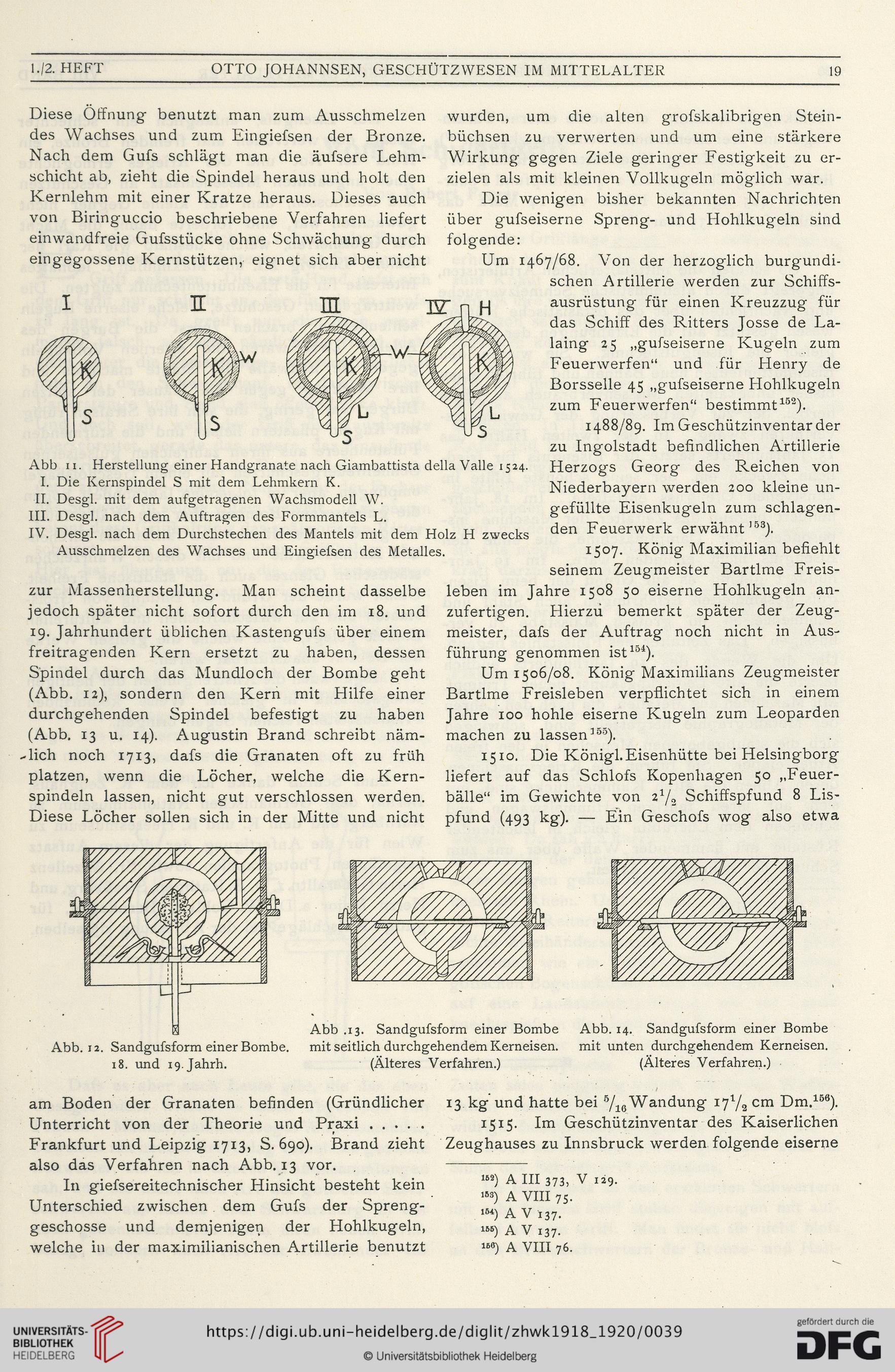1.12. HEFT
OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER
19
Diese Öffnung benutzt man zum Ausschmelzen
des Wachses und zum Eingiefsen der Bronze.
zur Massenherstellung. Man scheint dasselbe
jedoch später nicht sofort durch den im 18. und
19. Jahrhundert üblichen Kastengufs über einem
freitragenden Kern ersetzt zu haben, dessen
Spindel durch das Mundloch der Bombe geht
(Abb. 12), sondern den Kern mit Hilfe einer
durchgehenden Spindel befestigt zu haben
(Abb. 13 u. 14). Augustin Brand schreibt näm-
lich noch 1713, dafs die Granaten oft zu früh
platzen, wenn die Löcher, welche die Kern-
spindeln lassen, nicht gut verschlossen werden.
Diese Löcher sollen sich in der Mitte und nicht
wurden, um die alten grofskalibrigen Stein-
büchsen zu verwerten und um eine stärkere
Wirkung gegen Ziele geringer Festigkeit zu er-
zielen als mit kleinen Vollkugeln möglich war.
Die wenigen bisher bekannten Nachrichten
über gufseiserne Spreng- und Hohlkugeln sind
folgende:
1467/68. Von der herzoglich burgundi-
schen Artillerie werden zur Schiffs-
ausrüstung für einen Kreuzzug für
das Schiff des Ritters Josse de La-
laing 25 „gufseiserne Kugeln zum
Feuerwerfen“ und für Henry de
Borsseile 45 „gufseiserne Hohlkugeln
zum Feuer werfen“ bestimmt152 153).
1488/89. Im Geschützinventar der
zu Ingolstadt befindlichen Artillerie
Herzogs Georg des Reichen von
Niederbayern werden 200 kleine un-
gefüllte Eisenkugeln zum schlagen-
den Feuerwerk erwähnt’83).
1507. König Maximilian befiehlt
seinem Zeugmeister Bartlme Freis¬
ieben im Jahre 1508 50 eiserne Hohlkugeln an-
zufertigen. Hierzu bemerkt später der Zeug-
meister, dafs der Auftrag noch nicht in Aus-
führung genommen ist154).
Um 1506/08. König Maximilians Zeugmeister
Bartlme Freisieben verpflichtet sich in einem
Jahre 100 hohle eiserne Kugeln zum Leoparden
machen zu lassen155 *).
1510. Die Königl. Eisenhütte bei Helsingborg
liefert auf das Schlofs Kopenhagen 50 „Feuer-
bälle“ im Gewichte von 2^ Schiffspfund 8 Lis-
pfund (493 kg). — Ein Geschofs wog also etwa
Nach dem Gufs schlägt man die äufsere Lehm¬
schicht ab, zieht die Spindel heraus und holt den
Kernlehm mit einer Kratze heraus. Dieses -auch
von Biringuccio beschriebene Verfahren liefert
einwandfreie Gufsstücke ohne Schwächung durch
eingegossene Kernstützen, eignet sich aber nicht Um
I
z
s
J
Abb 11. Herstellung einer Handgranate nach Giambattista della Valle 1524.
I. Die Kernspindel S mit dem Lehmkern K.
II. Desgl. mit dem aufgetragenen Wachsmodell W.
III. Desgl. nach dem Aufträgen des Formmantels L.
IV. Desgl. nach dem Durchstechen des Mantels mit dem Holz H zwecks
Ausschmelzen des Wachses und Eingiefsen des Metalles.
Abb. 12. Sandgufsform einer Bombe.
18. und 19-Jahrh.
Abb .13. Sandgufsform einer Bombe
mit seitlich durchgehendem Kerneisen.
(Älteres Verfahren.)
Abb. 14. Sandgufsform einer Bombe
mit unten durchgehendem Kerneisen.
(Älteres Verfahren.)
am Boden der Granaten befinden (Gründlicher
Unterricht von der Theorie und Praxi.
Frankfurt und Leipzig 1713, S. 690). Brand zieht
also das Verfahren nach Abb. 13 vor.
In giefsereitechnischer Hinsicht besteht kein
Unterschied zwischen dem Gufs der Spreng-
geschosse und demjenigen der Hohlkugeln,
welche in der maximilianischen Artillerie benutzt
13 kg und hatte bei 5/10 Wandung i71/2 cm Dm.158).
1515. Im Geschützinventar des Kaiserlichen
Zeughauses zu Innsbruck werden folgende eiserne
162) A III373, V 129.
153) A VIII 75.
1W) A V 137.
15B) A V 137.
««) A VIII 76.
OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER
19
Diese Öffnung benutzt man zum Ausschmelzen
des Wachses und zum Eingiefsen der Bronze.
zur Massenherstellung. Man scheint dasselbe
jedoch später nicht sofort durch den im 18. und
19. Jahrhundert üblichen Kastengufs über einem
freitragenden Kern ersetzt zu haben, dessen
Spindel durch das Mundloch der Bombe geht
(Abb. 12), sondern den Kern mit Hilfe einer
durchgehenden Spindel befestigt zu haben
(Abb. 13 u. 14). Augustin Brand schreibt näm-
lich noch 1713, dafs die Granaten oft zu früh
platzen, wenn die Löcher, welche die Kern-
spindeln lassen, nicht gut verschlossen werden.
Diese Löcher sollen sich in der Mitte und nicht
wurden, um die alten grofskalibrigen Stein-
büchsen zu verwerten und um eine stärkere
Wirkung gegen Ziele geringer Festigkeit zu er-
zielen als mit kleinen Vollkugeln möglich war.
Die wenigen bisher bekannten Nachrichten
über gufseiserne Spreng- und Hohlkugeln sind
folgende:
1467/68. Von der herzoglich burgundi-
schen Artillerie werden zur Schiffs-
ausrüstung für einen Kreuzzug für
das Schiff des Ritters Josse de La-
laing 25 „gufseiserne Kugeln zum
Feuerwerfen“ und für Henry de
Borsseile 45 „gufseiserne Hohlkugeln
zum Feuer werfen“ bestimmt152 153).
1488/89. Im Geschützinventar der
zu Ingolstadt befindlichen Artillerie
Herzogs Georg des Reichen von
Niederbayern werden 200 kleine un-
gefüllte Eisenkugeln zum schlagen-
den Feuerwerk erwähnt’83).
1507. König Maximilian befiehlt
seinem Zeugmeister Bartlme Freis¬
ieben im Jahre 1508 50 eiserne Hohlkugeln an-
zufertigen. Hierzu bemerkt später der Zeug-
meister, dafs der Auftrag noch nicht in Aus-
führung genommen ist154).
Um 1506/08. König Maximilians Zeugmeister
Bartlme Freisieben verpflichtet sich in einem
Jahre 100 hohle eiserne Kugeln zum Leoparden
machen zu lassen155 *).
1510. Die Königl. Eisenhütte bei Helsingborg
liefert auf das Schlofs Kopenhagen 50 „Feuer-
bälle“ im Gewichte von 2^ Schiffspfund 8 Lis-
pfund (493 kg). — Ein Geschofs wog also etwa
Nach dem Gufs schlägt man die äufsere Lehm¬
schicht ab, zieht die Spindel heraus und holt den
Kernlehm mit einer Kratze heraus. Dieses -auch
von Biringuccio beschriebene Verfahren liefert
einwandfreie Gufsstücke ohne Schwächung durch
eingegossene Kernstützen, eignet sich aber nicht Um
I
z
s
J
Abb 11. Herstellung einer Handgranate nach Giambattista della Valle 1524.
I. Die Kernspindel S mit dem Lehmkern K.
II. Desgl. mit dem aufgetragenen Wachsmodell W.
III. Desgl. nach dem Aufträgen des Formmantels L.
IV. Desgl. nach dem Durchstechen des Mantels mit dem Holz H zwecks
Ausschmelzen des Wachses und Eingiefsen des Metalles.
Abb. 12. Sandgufsform einer Bombe.
18. und 19-Jahrh.
Abb .13. Sandgufsform einer Bombe
mit seitlich durchgehendem Kerneisen.
(Älteres Verfahren.)
Abb. 14. Sandgufsform einer Bombe
mit unten durchgehendem Kerneisen.
(Älteres Verfahren.)
am Boden der Granaten befinden (Gründlicher
Unterricht von der Theorie und Praxi.
Frankfurt und Leipzig 1713, S. 690). Brand zieht
also das Verfahren nach Abb. 13 vor.
In giefsereitechnischer Hinsicht besteht kein
Unterschied zwischen dem Gufs der Spreng-
geschosse und demjenigen der Hohlkugeln,
welche in der maximilianischen Artillerie benutzt
13 kg und hatte bei 5/10 Wandung i71/2 cm Dm.158).
1515. Im Geschützinventar des Kaiserlichen
Zeughauses zu Innsbruck werden folgende eiserne
162) A III373, V 129.
153) A VIII 75.
1W) A V 137.
15B) A V 137.
««) A VIII 76.