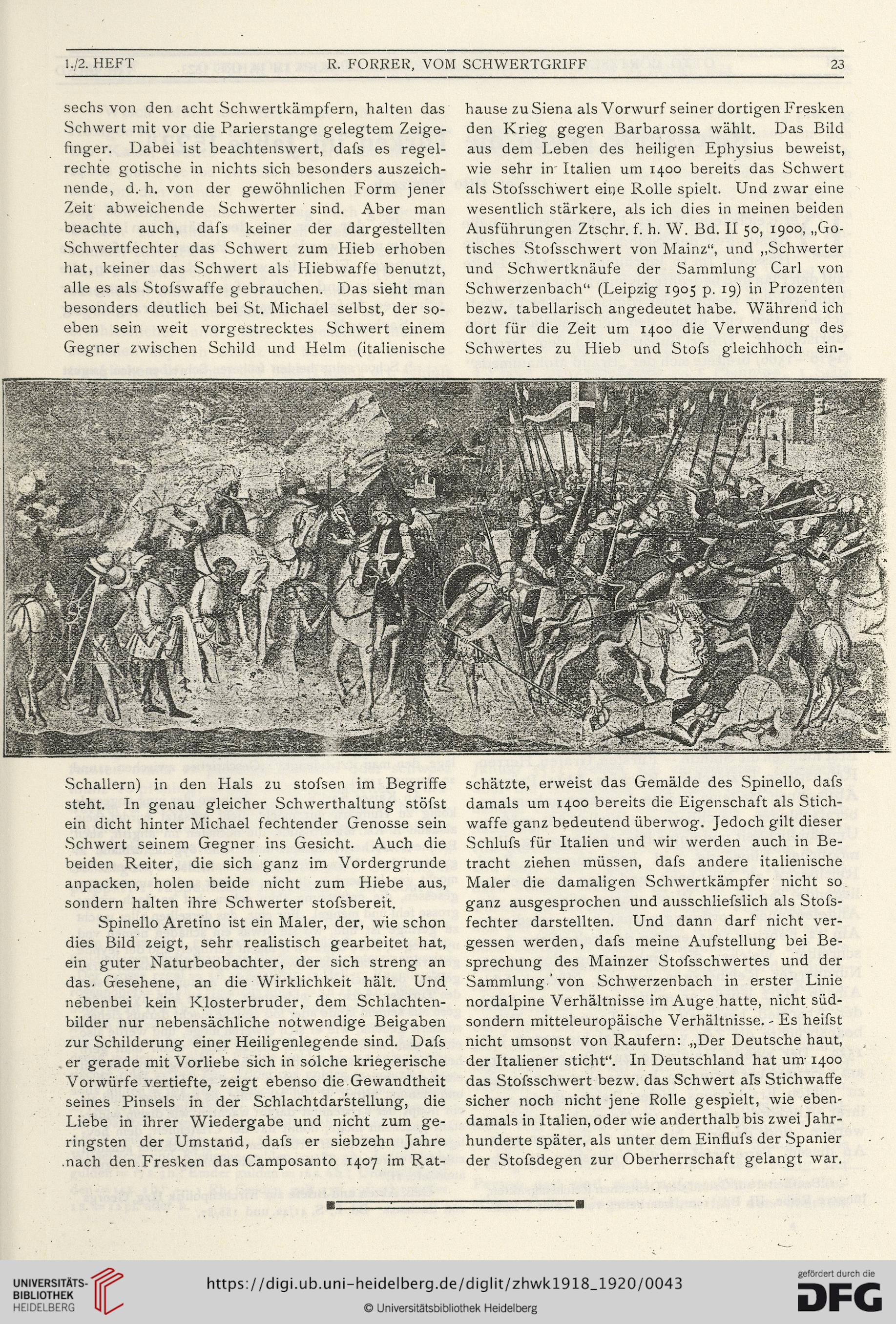R. FORRER, VOM SCHWERTGRIFF
23
sechs von den acht Schwertkämpfern, halten das
Schwert mit vor die Parierstange gelegtem Zeige-
finger. Dabei ist beachtenswert, dafs es regel-
rechte gotische in nichts sich besonders auszeich-
nende, d. h. von der gewöhnlichen Form jener
Zeit abweichende Schwerter sind. Aber man
beachte auch, dafs keiner der dargestellten
Schwertfechter das Schwert zum Hieb erhoben
hat, keiner das Schwert als Hiebwaffe benutzt,
alle es als Stofswaffe gebrauchen. Das sieht man
besonders deutlich bei St. Michael selbst, der so-
eben sein weit vorgestrecktes Schwert einem
Gegner zwischen Schild und Helm (italienische
hause zu Siena als Vorwurf seiner dortigen Fresken
den Krieg gegen Barbarossa wählt. Das Bild
aus dem Leben des heiligen Ephysius beweist,
wie sehr im Italien um 1400 bereits das Schwert
als Stofsschwert eine Rolle spielt. Und zwar eine
wesentlich stärkere, als ich dies in meinen beiden
Ausführungen Ztschr. f. h. W. Bd. II 50, 1900, „Go-
tisches Stofsschwert von Mainz“, und ,.Schwerter
und Schwertknäufe der Sammlung Carl von
Schwerzenbach“ (Leipzig 1905 p. 19) in Prozenten
bezw. tabellarisch angedeutet habe. Während ich
dort für die Zeit um 1400 die Verwendung des
Schwertes zu Hieb und Stofs gleichhoch ein-
Schallern) in den Hals zu stofsen im Begriffe
steht. In genau gleicher Schwerthaltung stöfst
ein dicht hinter Michael fechtender Genosse sein
Schwert seinem Gegner ins Gesicht. Auch die
beiden Reiter, die sich ganz im Vordergründe
anpacken, holen beide nicht zum Hiebe aus,
sondern halten ihre Schwerter stofsbereit.
Spinello Aretino ist ein Maler, der, wie schon
dies Bild zeigt, sehr realistisch gearbeitet hat,
ein guter Naturbeobachter, der sich streng an
das- Gesehene, an die Wirklichkeit hält. Und
nebenbei kein Klosterbruder, dem Schlachten-
bilder nur nebensächliche notwendige Beigaben
zur Schilderung einer Heiligenlegende sind. Dafs
er gerade mit Vorliebe sich in solche kriegerische
Vorwürfe vertiefte, zeigt ebenso die Gewandtheit
seines Pinsels in der Schlachtdarstellung, die
Liebe in ihrer Wiedergabe und nicht zum ge-
ringsten der Umstand, dafs er siebzehn Jahre
.nach den.Fresken das Camposanto 1407 im Rat-
schätzte, erweist das Gemälde des Spinello, dafs
damals um 1400 bereits die Eigenschaft als Stich-
waffe ganz bedeutend überwog. Jedoch gilt dieser
Schlufs für Italien und wir werden auch in Be-
tracht ziehen müssen, dafs andere italienische
Maler die damaligen Schwertkämpfer nicht so
ganz ausgesprochen und ausschliefslich als Stofs-
fechter darstellten. Und dann darf nicht ver-
gessen werden, dafs meine Aufstellung bei Be-
sprechung des Mainzer Stofsschwertes und der
Sammlung ' von Schwerzenbach in erster Linie
nordalpine Verhältnisse im Auge hatte, nicht süd-
sondern mitteleuropäische Verhältnisse. - Es heifst
nicht umsonst von Raufern: „Der Deutsche haut,
der Italiener sticht“. In Deutschland hat um-1400
das Stofsschwert bezw. das Schwert als Stichwaffe
sicher noch nicht jene Rolle gespielt, wie eben-
damals in Italien, oder wie anderthalb bis zwei Jahr-
hunderte später, als unter dem Einflufs der Spanier
der Stofsdegen zur Oberherrschaft gelangt war.
23
sechs von den acht Schwertkämpfern, halten das
Schwert mit vor die Parierstange gelegtem Zeige-
finger. Dabei ist beachtenswert, dafs es regel-
rechte gotische in nichts sich besonders auszeich-
nende, d. h. von der gewöhnlichen Form jener
Zeit abweichende Schwerter sind. Aber man
beachte auch, dafs keiner der dargestellten
Schwertfechter das Schwert zum Hieb erhoben
hat, keiner das Schwert als Hiebwaffe benutzt,
alle es als Stofswaffe gebrauchen. Das sieht man
besonders deutlich bei St. Michael selbst, der so-
eben sein weit vorgestrecktes Schwert einem
Gegner zwischen Schild und Helm (italienische
hause zu Siena als Vorwurf seiner dortigen Fresken
den Krieg gegen Barbarossa wählt. Das Bild
aus dem Leben des heiligen Ephysius beweist,
wie sehr im Italien um 1400 bereits das Schwert
als Stofsschwert eine Rolle spielt. Und zwar eine
wesentlich stärkere, als ich dies in meinen beiden
Ausführungen Ztschr. f. h. W. Bd. II 50, 1900, „Go-
tisches Stofsschwert von Mainz“, und ,.Schwerter
und Schwertknäufe der Sammlung Carl von
Schwerzenbach“ (Leipzig 1905 p. 19) in Prozenten
bezw. tabellarisch angedeutet habe. Während ich
dort für die Zeit um 1400 die Verwendung des
Schwertes zu Hieb und Stofs gleichhoch ein-
Schallern) in den Hals zu stofsen im Begriffe
steht. In genau gleicher Schwerthaltung stöfst
ein dicht hinter Michael fechtender Genosse sein
Schwert seinem Gegner ins Gesicht. Auch die
beiden Reiter, die sich ganz im Vordergründe
anpacken, holen beide nicht zum Hiebe aus,
sondern halten ihre Schwerter stofsbereit.
Spinello Aretino ist ein Maler, der, wie schon
dies Bild zeigt, sehr realistisch gearbeitet hat,
ein guter Naturbeobachter, der sich streng an
das- Gesehene, an die Wirklichkeit hält. Und
nebenbei kein Klosterbruder, dem Schlachten-
bilder nur nebensächliche notwendige Beigaben
zur Schilderung einer Heiligenlegende sind. Dafs
er gerade mit Vorliebe sich in solche kriegerische
Vorwürfe vertiefte, zeigt ebenso die Gewandtheit
seines Pinsels in der Schlachtdarstellung, die
Liebe in ihrer Wiedergabe und nicht zum ge-
ringsten der Umstand, dafs er siebzehn Jahre
.nach den.Fresken das Camposanto 1407 im Rat-
schätzte, erweist das Gemälde des Spinello, dafs
damals um 1400 bereits die Eigenschaft als Stich-
waffe ganz bedeutend überwog. Jedoch gilt dieser
Schlufs für Italien und wir werden auch in Be-
tracht ziehen müssen, dafs andere italienische
Maler die damaligen Schwertkämpfer nicht so
ganz ausgesprochen und ausschliefslich als Stofs-
fechter darstellten. Und dann darf nicht ver-
gessen werden, dafs meine Aufstellung bei Be-
sprechung des Mainzer Stofsschwertes und der
Sammlung ' von Schwerzenbach in erster Linie
nordalpine Verhältnisse im Auge hatte, nicht süd-
sondern mitteleuropäische Verhältnisse. - Es heifst
nicht umsonst von Raufern: „Der Deutsche haut,
der Italiener sticht“. In Deutschland hat um-1400
das Stofsschwert bezw. das Schwert als Stichwaffe
sicher noch nicht jene Rolle gespielt, wie eben-
damals in Italien, oder wie anderthalb bis zwei Jahr-
hunderte später, als unter dem Einflufs der Spanier
der Stofsdegen zur Oberherrschaft gelangt war.