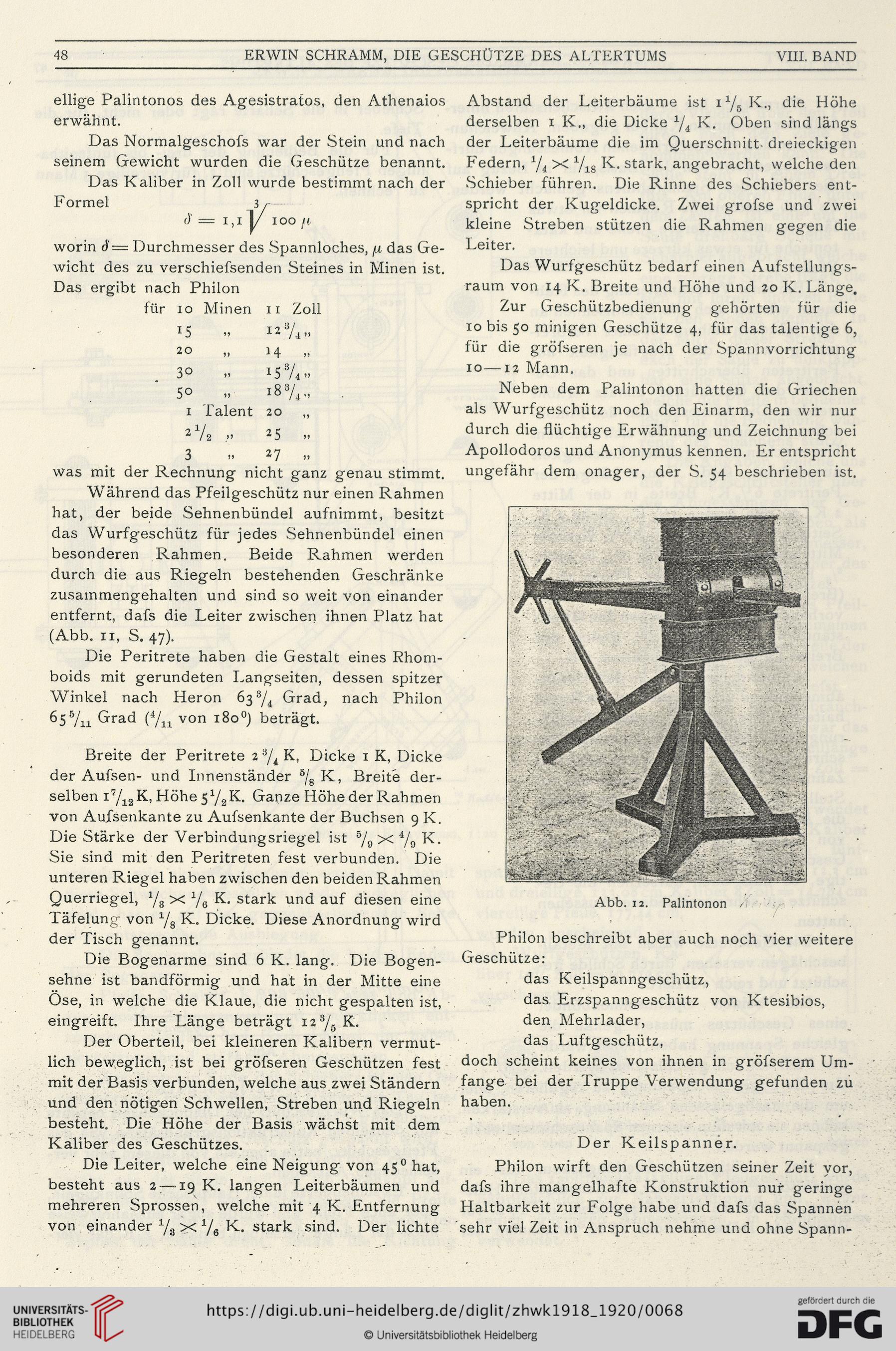48
ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS
VIII. BAND
eilige Palintonos des Agesistratos, den Athenaios
erwähnt.
Das Normalgeschofs war der Stein und nach
seinem Gewicht wurden die Geschütze benannt.
Das Kaliber in Zoll wurde bestimmt nach der
Abstand der Leiterbäume ist 1% K., die Höhe
derselben i K., die Dicke 4/4 K. Oben sind längs
der Leiterbäume die im Querschnitt- dreieckigen
Federn, 4/4 X x/18 K. stark, angebracht, welche den
Schieber führen. Die Rinne des Schiebers ent-
Formel
worin Durchmesser des Spannloches, 71 das Ge-
wicht des zu verschiefsenden Steines in Minen ist.
spricht der Kugeldicke. Zwei grofse und zwei
kleine Streben stützen die Rahmen gegen die
Leiter.
Das Wurfgeschütz bedarf einen Aufstellungs-
Das ergibt nach Philon
für 10 Minen
11 Zoll
45
12 7i»
20
14 »
3°
!574»
5°
1 Talent
20 „
272 n
25 »
3
27 >>
was mit der Rechnung nicht ganz genau stimmt.
raum von 14 K. Breite und Höhe und 20 K. Länge,
Zur Geschützbedienung gehörten für die
10 bis 50 minigen Geschütze 4, für das talentige 6,
für die gröfseren je nach der Spannvorrichtung
10—12 Mann.
Neben dem Palintonon hatten die Griechen
als Wurfgeschütz noch den Einarm, den wir nur
durch die flüchtige Erwähnung und Zeichnung bei
Apollodoros und Anonymus kennen. Er entspricht
ungefähr dem onager, der S. 54 beschrieben ist.
Während das Pfeilgeschütz nur einen Rahmen
hat, der beide Sehnenbündel aufnimmt, besitzt
das Wurfgeschütz für jedes Sehnenbündel einen
besonderen Rahmen. Beide Rahmen werden
durch die aus Riegeln bestehenden Geschränke
zusammengehalten und sind so weit von einander
entfernt, dafs die Leiter zwischen ihnen Platz hat
(Abb. 11, S. 47).
Die Peritrete haben die Gestalt eines Rhom-
boids mit gerundeten Langseiten, dessen spitzer
Winkel nach Heron 63% Grad, nach Philon
Ö55/h Grad (4/41 von 1800) beträgt.
Breite der Peritrete 2 3/4 K, Dicke 1 K, Dicke
der Aufsen- und Innenständer ö/8 K, Breite der-
selben i7/12K, Höhe 51/«,K. Ganze Höhe der Rahmen
von Aufsenkante zu Aufsenkante der Buchsen 9 K.
Die Stärke der Verbindungsriegel ist ö/öx4/0K.
Sie sind mit den Peritreten fest verbunden. Die
unteren Riegel haben zwischen den beiden Rahmen
Querriegel, 4/8 x % K. stark und auf diesen eine
Täfelung von 4/8 K. Dicke. Diese Anordnung wird
der Tisch genannt.
Die Bogenarme sind 6 K. lang.. Die Bogen-
sehne ist bandförmig und hat in der Mitte eine
Öse, in welche die Klaue, die nicht gespalten ist,
eingreift. Ihre Länge beträgt i23/5K.
Der Oberteil, bei kleineren Kalibern vermut-
lich beweglich, ist bei gröfseren Geschützen fest
mit der Basis verbunden, welche aus zwei Ständern
und den nötigen Schwellen, Streben und Riegeln
besteht. Die Höhe der Basis wächst mit dem
Kaliber des Geschützes.
Die Leiter, welche eine Neigung von 45° hat,
besteht aus 2-—19 K. langen Leiterbäumen und
mehreren Sprossen, welche mit 4 K. Entfernung
von einander 4/3 X */6 K. stark sind. Der lichte
Philon beschreibt aber auch noch vier weitere
Geschütze:
das Keilspanngeschütz,
das. Erzspanngeschütz von Ktesibios,
den Mehrlader,
das Luftgeschütz,
doch scheint keines von ihnen in gröfserem Um-
fange bei der Truppe Verwendung gefunden zu
haben.
Der Keilspanner.
Philon wirft den Geschützen seiner Zeit vor,
dafs ihre mangelhafte Konstruktion nur geringe
Haltbarkeit zur Folge habe und dafs das Spannen
sehr viel Zeit in Anspruch nehme und ohne Spann-
ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS
VIII. BAND
eilige Palintonos des Agesistratos, den Athenaios
erwähnt.
Das Normalgeschofs war der Stein und nach
seinem Gewicht wurden die Geschütze benannt.
Das Kaliber in Zoll wurde bestimmt nach der
Abstand der Leiterbäume ist 1% K., die Höhe
derselben i K., die Dicke 4/4 K. Oben sind längs
der Leiterbäume die im Querschnitt- dreieckigen
Federn, 4/4 X x/18 K. stark, angebracht, welche den
Schieber führen. Die Rinne des Schiebers ent-
Formel
worin Durchmesser des Spannloches, 71 das Ge-
wicht des zu verschiefsenden Steines in Minen ist.
spricht der Kugeldicke. Zwei grofse und zwei
kleine Streben stützen die Rahmen gegen die
Leiter.
Das Wurfgeschütz bedarf einen Aufstellungs-
Das ergibt nach Philon
für 10 Minen
11 Zoll
45
12 7i»
20
14 »
3°
!574»
5°
1 Talent
20 „
272 n
25 »
3
27 >>
was mit der Rechnung nicht ganz genau stimmt.
raum von 14 K. Breite und Höhe und 20 K. Länge,
Zur Geschützbedienung gehörten für die
10 bis 50 minigen Geschütze 4, für das talentige 6,
für die gröfseren je nach der Spannvorrichtung
10—12 Mann.
Neben dem Palintonon hatten die Griechen
als Wurfgeschütz noch den Einarm, den wir nur
durch die flüchtige Erwähnung und Zeichnung bei
Apollodoros und Anonymus kennen. Er entspricht
ungefähr dem onager, der S. 54 beschrieben ist.
Während das Pfeilgeschütz nur einen Rahmen
hat, der beide Sehnenbündel aufnimmt, besitzt
das Wurfgeschütz für jedes Sehnenbündel einen
besonderen Rahmen. Beide Rahmen werden
durch die aus Riegeln bestehenden Geschränke
zusammengehalten und sind so weit von einander
entfernt, dafs die Leiter zwischen ihnen Platz hat
(Abb. 11, S. 47).
Die Peritrete haben die Gestalt eines Rhom-
boids mit gerundeten Langseiten, dessen spitzer
Winkel nach Heron 63% Grad, nach Philon
Ö55/h Grad (4/41 von 1800) beträgt.
Breite der Peritrete 2 3/4 K, Dicke 1 K, Dicke
der Aufsen- und Innenständer ö/8 K, Breite der-
selben i7/12K, Höhe 51/«,K. Ganze Höhe der Rahmen
von Aufsenkante zu Aufsenkante der Buchsen 9 K.
Die Stärke der Verbindungsriegel ist ö/öx4/0K.
Sie sind mit den Peritreten fest verbunden. Die
unteren Riegel haben zwischen den beiden Rahmen
Querriegel, 4/8 x % K. stark und auf diesen eine
Täfelung von 4/8 K. Dicke. Diese Anordnung wird
der Tisch genannt.
Die Bogenarme sind 6 K. lang.. Die Bogen-
sehne ist bandförmig und hat in der Mitte eine
Öse, in welche die Klaue, die nicht gespalten ist,
eingreift. Ihre Länge beträgt i23/5K.
Der Oberteil, bei kleineren Kalibern vermut-
lich beweglich, ist bei gröfseren Geschützen fest
mit der Basis verbunden, welche aus zwei Ständern
und den nötigen Schwellen, Streben und Riegeln
besteht. Die Höhe der Basis wächst mit dem
Kaliber des Geschützes.
Die Leiter, welche eine Neigung von 45° hat,
besteht aus 2-—19 K. langen Leiterbäumen und
mehreren Sprossen, welche mit 4 K. Entfernung
von einander 4/3 X */6 K. stark sind. Der lichte
Philon beschreibt aber auch noch vier weitere
Geschütze:
das Keilspanngeschütz,
das. Erzspanngeschütz von Ktesibios,
den Mehrlader,
das Luftgeschütz,
doch scheint keines von ihnen in gröfserem Um-
fange bei der Truppe Verwendung gefunden zu
haben.
Der Keilspanner.
Philon wirft den Geschützen seiner Zeit vor,
dafs ihre mangelhafte Konstruktion nur geringe
Haltbarkeit zur Folge habe und dafs das Spannen
sehr viel Zeit in Anspruch nehme und ohne Spann-