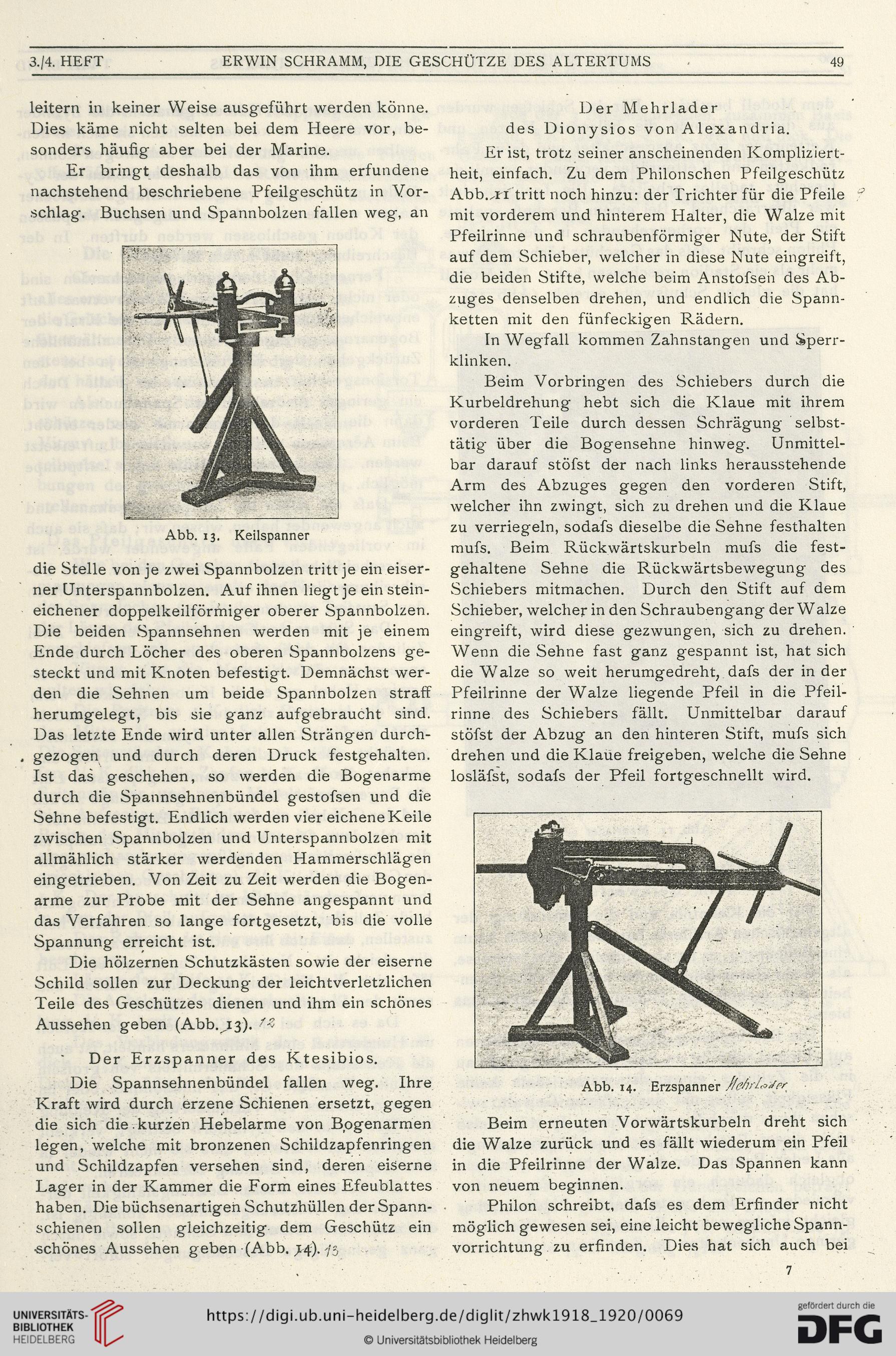3.)4. HEFT
ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS
49
leitern in keiner Weise ausgeführt werden könne.
Dies käme nicht selten bei dem Heere vor, be-
sonders häufig aber bei der Marine.
Er bringt deshalb das von ihm erfundene
nachstehend beschriebene Pfeilgeschütz in Vor-
schlag. Buchsen und Spannbolzen fallen weg, an
die Stelle von je zwei Spannbolzen tritt je ein eiser-
ner Unterspannbolzen. Auf ihnen liegt je ein stein-
eichener doppelkeilförmiger oberer Spannbolzen.
Die beiden Spannsehnen werden mit je einem
Ende durch Löcher des oberen Spannbolzens ge-
steckt und mit Knoten befestigt. Demnächst wer-
den die Sehnen um beide Spannbolzen straff
herumgelegt, bis sie ganz aufgebraucht sind.
Das letzte Ende wird unter allen Strängen durch-
gezogen und durch deren Druck festgehalten.
Ist das geschehen, so werden die Bogenarme
durch die Spannsehnenbündel gestofsen und die
Sehne befestigt. Endlich werden vier eichene Keile
zwischen Spannbolzen und Unterspannbolzen mit
allmählich stärker werdenden Hammerschlägen
eingetrieben. Von Zeit zu Zeit werden die Bogen-
arme zur Probe mit der Sehne angespannt und
das Verfahren so lange fortgesetzt, bis die volle
Spannung erreicht ist.
Die hölzernen Schutzkästen sowie der eiserne
Schild sollen zur Deckung der leichtverletzlichen
Teile des Geschützes dienen und ihm ein schönes
Aussehen geben (Abb.^13).
Der Erzspanner des Ktesibios.
Die Spannsehnenbündel fallen weg. Ihre
Kraft wird durch erzene Schienen ersetzt, gegen
die sich die . kurzen Hebelarme von Bogenarmen
legen, welche mit bronzenen Schildzapfenringen
und Schildzapfen versehen sind, deren eiserne
Lager in der Kammer die Form eines Efeublattes
haben. Die büchsenartigen Schutzhüllen der Spann-
schienen sollen gleichzeitig dem Geschütz ein
-schönes Aussehen geben (Abb. U4'). 73
Der Mehrlader
des Dionysios von Alexandria.
Er ist, trotz seiner anscheinenden Kompliziert-
heit, einfach. Zu dem Philonschen Pfeilgeschütz
Abb.xFi tritt noch hinzu: der Trichter für die Pfeile
mit vorderem und hinterem Halter, die Walze mit
Pfeilrinne und schraubenförmiger Nute, der Stift
auf dem Schieber, welcher in diese Nute eingreift,
die beiden Stifte, welche beim Anstofseii des Ab-
zuges denselben drehen, und endlich die Spann-
ketten mit den fünfeckigen Rädern.
In Wegfall kommen Zahnstangen und Sperr-
klinken.
Beim Vorbringen des Schiebers durch die
Kurbeldrehung hebt sich die Klaue mit ihrem
vorderen Teile durch dessen Schrägung selbst-
tätig über die Bogensehne hinweg. Unmittel-
bar darauf stöfst der nach links herausstehende
Arm des Abzuges gegen den vorderen Stift,
welcher ihn zwingt, sich zu drehen und die Klaue
zu verriegeln, sodafs dieselbe die Sehne festhalten
mufs. Beim Rückwärtskurbeln mufs die fest-
gehaltene Sehne die Rückwärtsbewegung des
Schiebers mitmachen. Durch den Stift auf dem
Schieber, welcher in den Schraubengang der Walze
eingreift, wird diese gezwungen, sich zu drehen.
Wenn die Sehne fast ganz gespannt ist, hat sich
die Walze so weit herumgedreht, dafs der in der
Pfeilrinne der Walze liegende Pfeil in die Pfeil-
rinne des Schiebers fällt. Unmittelbar darauf
stöfst der Abzug an den hinteren Stift, mufs sich
drehen und die Klaue freigeben, welche die Sehne
losläfst, sodafs der Pfeil fortgeschnellt wird.
Abb. 14. Erzspanner //e/irl&Jer
Beim erneuten Vorwärtskurbeln dreht sich
die Walze zurück und es fällt wiederum ein Pfeil
in die Pfeilrinne der Walze. Das Spannen kann
von neuem beginnen.
Philon schreibt, dafs es dem Erfinder nicht
möglich gewesen sei, eine leicht bewegliche Spann-
vorrichtung zu erfinden. Dies hat sich auch bei
7
ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS
49
leitern in keiner Weise ausgeführt werden könne.
Dies käme nicht selten bei dem Heere vor, be-
sonders häufig aber bei der Marine.
Er bringt deshalb das von ihm erfundene
nachstehend beschriebene Pfeilgeschütz in Vor-
schlag. Buchsen und Spannbolzen fallen weg, an
die Stelle von je zwei Spannbolzen tritt je ein eiser-
ner Unterspannbolzen. Auf ihnen liegt je ein stein-
eichener doppelkeilförmiger oberer Spannbolzen.
Die beiden Spannsehnen werden mit je einem
Ende durch Löcher des oberen Spannbolzens ge-
steckt und mit Knoten befestigt. Demnächst wer-
den die Sehnen um beide Spannbolzen straff
herumgelegt, bis sie ganz aufgebraucht sind.
Das letzte Ende wird unter allen Strängen durch-
gezogen und durch deren Druck festgehalten.
Ist das geschehen, so werden die Bogenarme
durch die Spannsehnenbündel gestofsen und die
Sehne befestigt. Endlich werden vier eichene Keile
zwischen Spannbolzen und Unterspannbolzen mit
allmählich stärker werdenden Hammerschlägen
eingetrieben. Von Zeit zu Zeit werden die Bogen-
arme zur Probe mit der Sehne angespannt und
das Verfahren so lange fortgesetzt, bis die volle
Spannung erreicht ist.
Die hölzernen Schutzkästen sowie der eiserne
Schild sollen zur Deckung der leichtverletzlichen
Teile des Geschützes dienen und ihm ein schönes
Aussehen geben (Abb.^13).
Der Erzspanner des Ktesibios.
Die Spannsehnenbündel fallen weg. Ihre
Kraft wird durch erzene Schienen ersetzt, gegen
die sich die . kurzen Hebelarme von Bogenarmen
legen, welche mit bronzenen Schildzapfenringen
und Schildzapfen versehen sind, deren eiserne
Lager in der Kammer die Form eines Efeublattes
haben. Die büchsenartigen Schutzhüllen der Spann-
schienen sollen gleichzeitig dem Geschütz ein
-schönes Aussehen geben (Abb. U4'). 73
Der Mehrlader
des Dionysios von Alexandria.
Er ist, trotz seiner anscheinenden Kompliziert-
heit, einfach. Zu dem Philonschen Pfeilgeschütz
Abb.xFi tritt noch hinzu: der Trichter für die Pfeile
mit vorderem und hinterem Halter, die Walze mit
Pfeilrinne und schraubenförmiger Nute, der Stift
auf dem Schieber, welcher in diese Nute eingreift,
die beiden Stifte, welche beim Anstofseii des Ab-
zuges denselben drehen, und endlich die Spann-
ketten mit den fünfeckigen Rädern.
In Wegfall kommen Zahnstangen und Sperr-
klinken.
Beim Vorbringen des Schiebers durch die
Kurbeldrehung hebt sich die Klaue mit ihrem
vorderen Teile durch dessen Schrägung selbst-
tätig über die Bogensehne hinweg. Unmittel-
bar darauf stöfst der nach links herausstehende
Arm des Abzuges gegen den vorderen Stift,
welcher ihn zwingt, sich zu drehen und die Klaue
zu verriegeln, sodafs dieselbe die Sehne festhalten
mufs. Beim Rückwärtskurbeln mufs die fest-
gehaltene Sehne die Rückwärtsbewegung des
Schiebers mitmachen. Durch den Stift auf dem
Schieber, welcher in den Schraubengang der Walze
eingreift, wird diese gezwungen, sich zu drehen.
Wenn die Sehne fast ganz gespannt ist, hat sich
die Walze so weit herumgedreht, dafs der in der
Pfeilrinne der Walze liegende Pfeil in die Pfeil-
rinne des Schiebers fällt. Unmittelbar darauf
stöfst der Abzug an den hinteren Stift, mufs sich
drehen und die Klaue freigeben, welche die Sehne
losläfst, sodafs der Pfeil fortgeschnellt wird.
Abb. 14. Erzspanner //e/irl&Jer
Beim erneuten Vorwärtskurbeln dreht sich
die Walze zurück und es fällt wiederum ein Pfeil
in die Pfeilrinne der Walze. Das Spannen kann
von neuem beginnen.
Philon schreibt, dafs es dem Erfinder nicht
möglich gewesen sei, eine leicht bewegliche Spann-
vorrichtung zu erfinden. Dies hat sich auch bei
7