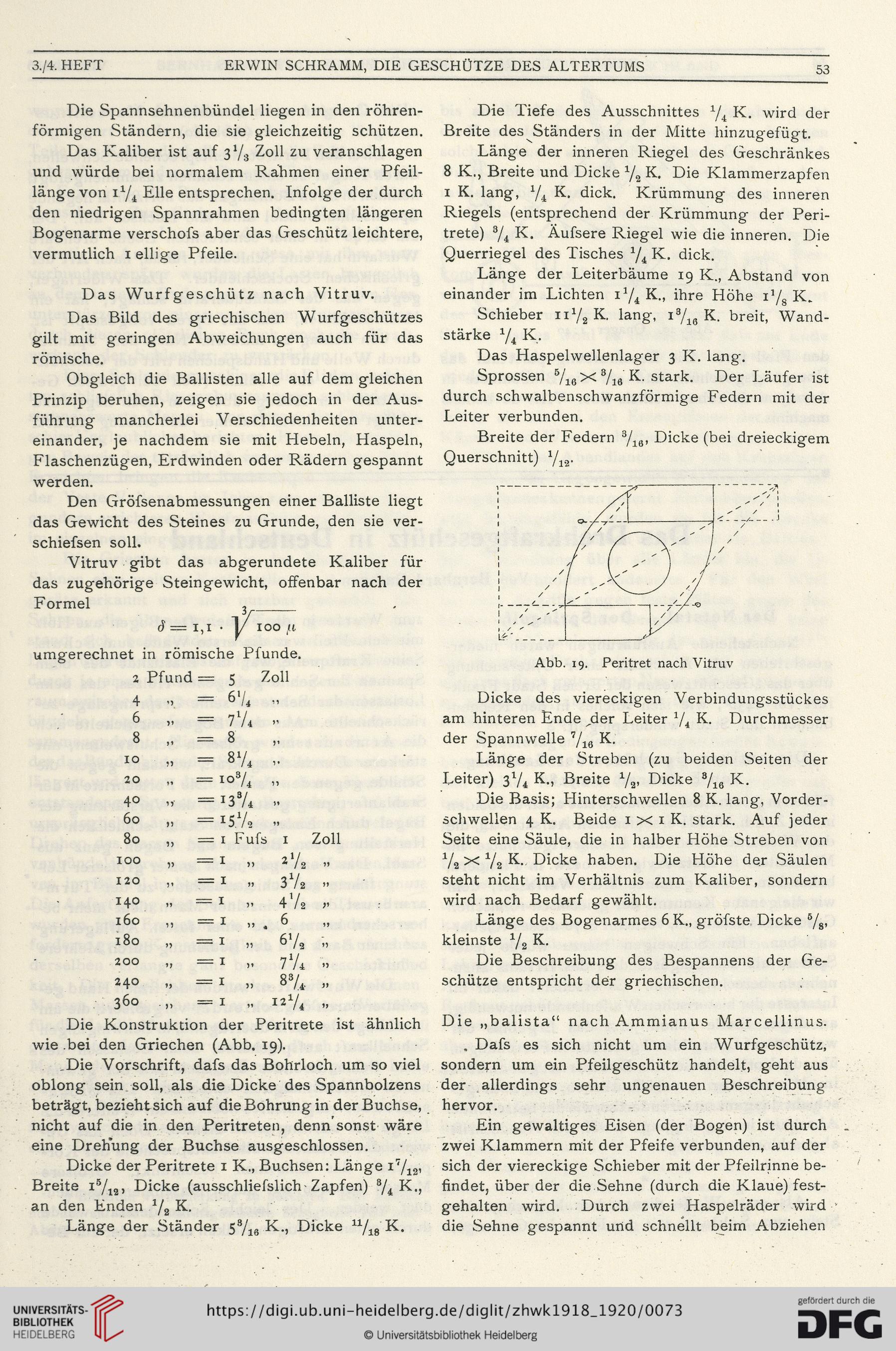3./4. HEFT
ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS
53
Die Spannsehnenbündel liegen in den röhren-
förmigen Ständern, die sie gleichzeitig schützen.
Das Kaliber ist auf 373 Zoll zu veranschlagen
und würde bei normalem Rahmen einer Pfeil-
länge von i1/^ Elle entsprechen. Infolge der durch
den niedrigen Spannrahmen bedingten längeren
Bogenarme verschofs aber das Geschütz leichtere,
vermutlich i eilige Pfeile.
Das Wurfgeschütz nach Vitruv.
Das Bild des griechischen Wurfgeschützes
gilt mit geringen Abweichungen auch für das
römische.
Obgleich die Ballisten alle auf dem gleichen
Prinzip beruhen, zeigen sie jedoch in der Aus-
führung mancherlei Verschiedenheiten unter-
einander, je nachdem sie mit Hebeln, Haspeln,
Flaschenzügen, Erdwinden oder Rädern gespannt
werden.
Den Gröfsenabmessungen einer Bailiste liegt
das Gewicht des Steines zu Grunde, den sie ver-
schiefsen soll.
Vitruv gibt das abgerundete Kaliber für
das zugehörige Steingewicht, offenbar nach der
Formel 3 _
4 — 1,1 • "|/ ioo /t
umgerechnet in römische Pfunde.
2 Pfund =
5
Zoll
4
=
67.
6
=
8
=
8
p
IO
n
=
1 ♦
20
=
i°3/4
n
4°
=
*33/4
5»
60
n
=
80
n
=
1 Fufs 1
Zoll
IOO
P
=
1 ,,
*72
120
V
=
1 „
372
140
=
1 H
472
P
160
—
1 »
6
«
180
—
1 »
6%
n
200
u
—
1
77i
n
240
—
1 »
360
• n
=
1 „
I274
Die Konstruktion der Peritrete ist ähnlich
wie .bei den Griechen (Abb. 19).
_Die Vorschrift, dafs das Bohrloch um so viel
oblong sein soll, als die Dicke des Spannbolzens
beträgt, beziehtsich auf die Bohrung in der Buchse,
nicht auf die in den Peritreten, denn’sonst wäre
eine Drehung der Buchse ausgeschlossen.
Dicke der Peritrete 1 K., Buchsen: Länge i7/12,
Breite i5/ia> Dicke (ausschliefslich-Zapfen) 3/A
an den Enden 1/2 K.
Länge der Ständer 53/18 K-, Dicke u/18 K.
Die Tiefe des Ausschnittes x/4 K. wird der
Breite des Ständers in der Mitte hinzugefügt.
Länge der inneren Riegel des Geschränkes
8 K., Breite und Dicke x/2 K. Die Klammerzapfen
1 K. lang, 74 K. dick. Krümmung des inneren
Riegels (entsprechend der Krümmung der Peri-
trete) 3/4 K. Äufsere Riegel wie die inneren. Die
Querriegel des Tisches x/4 K. dick.
Länge der Leiterbäume 19 K., Abstand von
einander im Lichten i1/^ K„ ihre Höhe i’/g K.
Schieber ii72 K. lang, i3/16 K. breit, Wand-
stärke x/4 K .
Das Haspelwellenlager 3 K. lang.
Sprossen 5/i6X3/lö K. stark. Der Läufer ist
durch schwalbenschwanzförmige Federn mit der
Leiter verbunden.
Breite der Federn 3/10, Dicke (bei dreieckigem
Querschnitt) 712.
Abb. 19. Peritret nach Vitruv
Dicke des viereckigen Verbindungsstückes
am hinteren Ende ^der Leiter 74 K. Durchmesser
der Spannwelle ’/16 K.
Länge der Streben (zu beiden Seiten der
Leiter) 374 K., Breite 7a> Dicke 3/ia K.
Die Basis; Hinterschwellen 8 K. lang, Vorder-
schwellen 4 K. Beide 1 x 1 K. stark. Auf jeder
Seite eine Säule, die in halber Höhe Streben von
V2 X 7a Dicke haben. Die Höhe der Säulen
steht nicht im Verhältnis zum Kaliber, sondern
wird nach Bedarf gewählt.
Länge des Bogenarmes 6K„ gröbste Dicke 6/8,
kleinste 72
Die Beschreibung des Bespannens der Ge-
schütze entspricht der griechischen.
Die „balista“ nach Ammianus Marcellinus.
. Dafs es sich nicht um ein Wurfgeschütz,
sondern um ein Pfeilgeschütz handelt, geht aus
der allerdings sehr ungenauen Beschreibung
hervor.
Ein gewaltiges Eisen (der Bogen) ist durch
zwei Klammern mit der Pfeife verbunden, auf der
sich der viereckige Schieber mit der Pfeilrinne be-
findet, über der die Sehne (durch die Klaue) fest-
gehalten wird. Durch zwei Haspelräder wird
die Sehne gespannt und schnellt beim Abziehen
ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS
53
Die Spannsehnenbündel liegen in den röhren-
förmigen Ständern, die sie gleichzeitig schützen.
Das Kaliber ist auf 373 Zoll zu veranschlagen
und würde bei normalem Rahmen einer Pfeil-
länge von i1/^ Elle entsprechen. Infolge der durch
den niedrigen Spannrahmen bedingten längeren
Bogenarme verschofs aber das Geschütz leichtere,
vermutlich i eilige Pfeile.
Das Wurfgeschütz nach Vitruv.
Das Bild des griechischen Wurfgeschützes
gilt mit geringen Abweichungen auch für das
römische.
Obgleich die Ballisten alle auf dem gleichen
Prinzip beruhen, zeigen sie jedoch in der Aus-
führung mancherlei Verschiedenheiten unter-
einander, je nachdem sie mit Hebeln, Haspeln,
Flaschenzügen, Erdwinden oder Rädern gespannt
werden.
Den Gröfsenabmessungen einer Bailiste liegt
das Gewicht des Steines zu Grunde, den sie ver-
schiefsen soll.
Vitruv gibt das abgerundete Kaliber für
das zugehörige Steingewicht, offenbar nach der
Formel 3 _
4 — 1,1 • "|/ ioo /t
umgerechnet in römische Pfunde.
2 Pfund =
5
Zoll
4
=
67.
6
=
8
=
8
p
IO
n
=
1 ♦
20
=
i°3/4
n
4°
=
*33/4
5»
60
n
=
80
n
=
1 Fufs 1
Zoll
IOO
P
=
1 ,,
*72
120
V
=
1 „
372
140
=
1 H
472
P
160
—
1 »
6
«
180
—
1 »
6%
n
200
u
—
1
77i
n
240
—
1 »
360
• n
=
1 „
I274
Die Konstruktion der Peritrete ist ähnlich
wie .bei den Griechen (Abb. 19).
_Die Vorschrift, dafs das Bohrloch um so viel
oblong sein soll, als die Dicke des Spannbolzens
beträgt, beziehtsich auf die Bohrung in der Buchse,
nicht auf die in den Peritreten, denn’sonst wäre
eine Drehung der Buchse ausgeschlossen.
Dicke der Peritrete 1 K., Buchsen: Länge i7/12,
Breite i5/ia> Dicke (ausschliefslich-Zapfen) 3/A
an den Enden 1/2 K.
Länge der Ständer 53/18 K-, Dicke u/18 K.
Die Tiefe des Ausschnittes x/4 K. wird der
Breite des Ständers in der Mitte hinzugefügt.
Länge der inneren Riegel des Geschränkes
8 K., Breite und Dicke x/2 K. Die Klammerzapfen
1 K. lang, 74 K. dick. Krümmung des inneren
Riegels (entsprechend der Krümmung der Peri-
trete) 3/4 K. Äufsere Riegel wie die inneren. Die
Querriegel des Tisches x/4 K. dick.
Länge der Leiterbäume 19 K., Abstand von
einander im Lichten i1/^ K„ ihre Höhe i’/g K.
Schieber ii72 K. lang, i3/16 K. breit, Wand-
stärke x/4 K .
Das Haspelwellenlager 3 K. lang.
Sprossen 5/i6X3/lö K. stark. Der Läufer ist
durch schwalbenschwanzförmige Federn mit der
Leiter verbunden.
Breite der Federn 3/10, Dicke (bei dreieckigem
Querschnitt) 712.
Abb. 19. Peritret nach Vitruv
Dicke des viereckigen Verbindungsstückes
am hinteren Ende ^der Leiter 74 K. Durchmesser
der Spannwelle ’/16 K.
Länge der Streben (zu beiden Seiten der
Leiter) 374 K., Breite 7a> Dicke 3/ia K.
Die Basis; Hinterschwellen 8 K. lang, Vorder-
schwellen 4 K. Beide 1 x 1 K. stark. Auf jeder
Seite eine Säule, die in halber Höhe Streben von
V2 X 7a Dicke haben. Die Höhe der Säulen
steht nicht im Verhältnis zum Kaliber, sondern
wird nach Bedarf gewählt.
Länge des Bogenarmes 6K„ gröbste Dicke 6/8,
kleinste 72
Die Beschreibung des Bespannens der Ge-
schütze entspricht der griechischen.
Die „balista“ nach Ammianus Marcellinus.
. Dafs es sich nicht um ein Wurfgeschütz,
sondern um ein Pfeilgeschütz handelt, geht aus
der allerdings sehr ungenauen Beschreibung
hervor.
Ein gewaltiges Eisen (der Bogen) ist durch
zwei Klammern mit der Pfeife verbunden, auf der
sich der viereckige Schieber mit der Pfeilrinne be-
findet, über der die Sehne (durch die Klaue) fest-
gehalten wird. Durch zwei Haspelräder wird
die Sehne gespannt und schnellt beim Abziehen