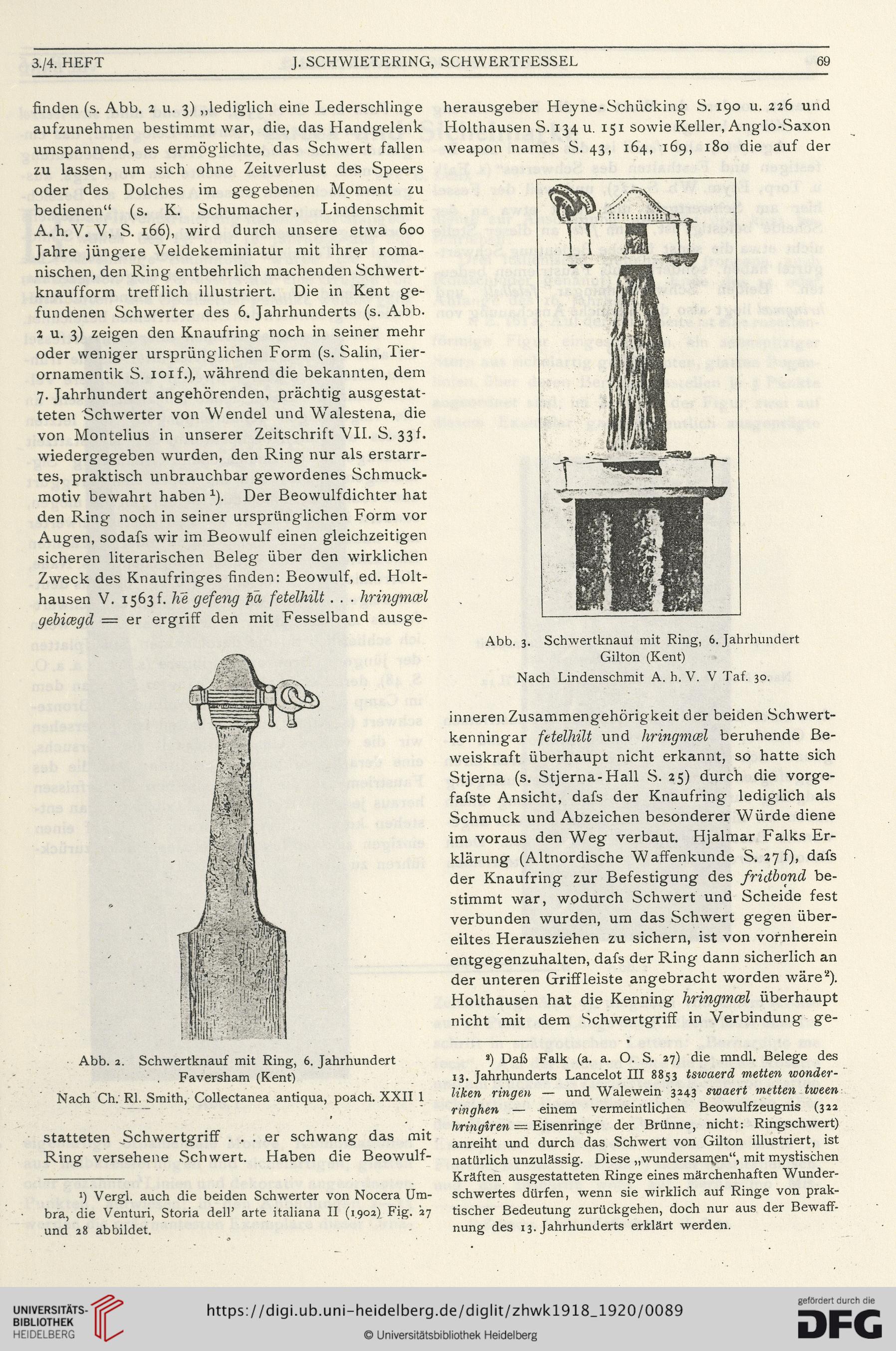3./4. HEFT
J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL
69
finden (s. Abb. 2 u. 3) „lediglich eine Lederschlinge
aufzunehmen bestimmt war, die, das Handgelenk
umspannend, es ermöglichte, das Schwert fallen
zu lassen, um sich ohne Zeitverlust des Speers
oder des Dolches im gegebenen Moment zu
bedienen“ (s. K. Schumacher, Lindenschmit
A.h.V. V, S. 166), wird durch unsere etwa 600
Jahre jüngere Veldekeminiatur mit ihrer roma-
nischen, den Ring entbehrlich machenden Schwert-
knaufform trefflich illustriert. Die in Kent ge-
fundenen Schwerter des 6. Jahrhunderts (s. Abb.
2 u. 3) zeigen den Knaufring noch in seiner mehr
oder weniger ursprünglichen Form (s. Salin, Tier-
ornamentik S. ioif.), während die bekannten, dem
7. Jahrhundert angehörenden, prächtig ausgestat-
teten Schwerter von Wendel und Walestena, die
von Montelius in unserer Zeitschrift VII. S. 33f.
wiedergegeben wurden, den Ring nur als erstarr-
tes, praktisch unbrauchbar gewordenes Schmuck-
motiv bewahrt haben x). Der Beowulfdichter hat
den Ring noch in seiner ursprünglichen Form vor
Augen, sodafs wir im Beowulf einen gleichzeitigen
sicheren literarischen Beleg über den wirklichen
Zweck des Knaufringes finden: Beowulf, ed. Holt-
hausen V. 1563 f. he gefeng frei fetelhilt. . . hringmcel
gebicegd = er ergriff den mit Fesselband ausge-
Abb. 2. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert
' . Faversham (Kent)
Nach Ch. RI. Smith, Collectanea antiqua, poach. XXII 1
statteten JSchwertgriff ... er schwang das mit
Ring versehene Schwert. Haben die Beowulf-
*) Vergl. auch die beiden Schwerter von Nocera Um-
bra, die Venturi, Storia dell’ arte italiana II (1.902) Fig. 27
und 28 abbildet.
herausgeber Heyne-Schücking S. 190 u. 226 und
Holthausen S. 134 u. 151 sowie Keller, Anglo-Saxon
weapon names S. 43, 164, 169, 180 die auf der
Abb. 3. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert
Gilton (Kent)
Nach Lindenschmit A. h. V. V Taf. 30.
inneren Zusammengehörigkeit der beiden Schwert-
kenningar fetelhilt und hringmcel beruhende Be-
weiskraft überhaupt nicht erkannt, so hatte sich
Stjerna (s. Stjerna-Hall S. 25) durch die vorge-
fafste Ansicht, dafs der Knaufring lediglich als
Schmuck und Abzeichen besonderer Würde diene
im voraus den Weg verbaut. Hjalmar Falks Er-
klärung (Altnordische Waffenkunde S. 27 f), dafs
der Knaufring zur Befestigung des fridbond be-
stimmt war, wodurch Schwert und Scheide fest
verbunden wurden, um das Schwert gegen über-
eiltes Herausziehen zu sichern, ist von vornherein
entgegenzuhalten, dafs der Ring dann sicherlich an
der unteren Griff leiste angebracht worden wäre2).
Holthausen hat die Kenning hringmcel überhaupt
nicht mit dem Schwertgriff in Verbindung ge-
») Daß Falk (a. a. O. S. 27) die mndl. Belege des
13. Jahrhunderts Lancelot III 8853 tswaerd metten wonder-
liken ringen — und Walewein 3243 swaert metten tween
ringhen — einem vermeintlichen Beowulfzeugnis (322
hringiren — Eisenringe der Brünne, nicht; Ringschwert)
anreiht und durch das Schwert von Gilton illustriert, ist
natürlich unzulässig. Diese „wundersarqen“, mit mystischen
Kräften ausgestatteten Ringe eines märchenhaften Wunder-
schwertes dürfen, wenn sie wirklich auf Ringe von prak-
tischer Bedeutung zurückgehen, doch nur aus der Bewaff-
nung des 13. Jahrhunderts erklärt werden.
J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL
69
finden (s. Abb. 2 u. 3) „lediglich eine Lederschlinge
aufzunehmen bestimmt war, die, das Handgelenk
umspannend, es ermöglichte, das Schwert fallen
zu lassen, um sich ohne Zeitverlust des Speers
oder des Dolches im gegebenen Moment zu
bedienen“ (s. K. Schumacher, Lindenschmit
A.h.V. V, S. 166), wird durch unsere etwa 600
Jahre jüngere Veldekeminiatur mit ihrer roma-
nischen, den Ring entbehrlich machenden Schwert-
knaufform trefflich illustriert. Die in Kent ge-
fundenen Schwerter des 6. Jahrhunderts (s. Abb.
2 u. 3) zeigen den Knaufring noch in seiner mehr
oder weniger ursprünglichen Form (s. Salin, Tier-
ornamentik S. ioif.), während die bekannten, dem
7. Jahrhundert angehörenden, prächtig ausgestat-
teten Schwerter von Wendel und Walestena, die
von Montelius in unserer Zeitschrift VII. S. 33f.
wiedergegeben wurden, den Ring nur als erstarr-
tes, praktisch unbrauchbar gewordenes Schmuck-
motiv bewahrt haben x). Der Beowulfdichter hat
den Ring noch in seiner ursprünglichen Form vor
Augen, sodafs wir im Beowulf einen gleichzeitigen
sicheren literarischen Beleg über den wirklichen
Zweck des Knaufringes finden: Beowulf, ed. Holt-
hausen V. 1563 f. he gefeng frei fetelhilt. . . hringmcel
gebicegd = er ergriff den mit Fesselband ausge-
Abb. 2. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert
' . Faversham (Kent)
Nach Ch. RI. Smith, Collectanea antiqua, poach. XXII 1
statteten JSchwertgriff ... er schwang das mit
Ring versehene Schwert. Haben die Beowulf-
*) Vergl. auch die beiden Schwerter von Nocera Um-
bra, die Venturi, Storia dell’ arte italiana II (1.902) Fig. 27
und 28 abbildet.
herausgeber Heyne-Schücking S. 190 u. 226 und
Holthausen S. 134 u. 151 sowie Keller, Anglo-Saxon
weapon names S. 43, 164, 169, 180 die auf der
Abb. 3. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert
Gilton (Kent)
Nach Lindenschmit A. h. V. V Taf. 30.
inneren Zusammengehörigkeit der beiden Schwert-
kenningar fetelhilt und hringmcel beruhende Be-
weiskraft überhaupt nicht erkannt, so hatte sich
Stjerna (s. Stjerna-Hall S. 25) durch die vorge-
fafste Ansicht, dafs der Knaufring lediglich als
Schmuck und Abzeichen besonderer Würde diene
im voraus den Weg verbaut. Hjalmar Falks Er-
klärung (Altnordische Waffenkunde S. 27 f), dafs
der Knaufring zur Befestigung des fridbond be-
stimmt war, wodurch Schwert und Scheide fest
verbunden wurden, um das Schwert gegen über-
eiltes Herausziehen zu sichern, ist von vornherein
entgegenzuhalten, dafs der Ring dann sicherlich an
der unteren Griff leiste angebracht worden wäre2).
Holthausen hat die Kenning hringmcel überhaupt
nicht mit dem Schwertgriff in Verbindung ge-
») Daß Falk (a. a. O. S. 27) die mndl. Belege des
13. Jahrhunderts Lancelot III 8853 tswaerd metten wonder-
liken ringen — und Walewein 3243 swaert metten tween
ringhen — einem vermeintlichen Beowulfzeugnis (322
hringiren — Eisenringe der Brünne, nicht; Ringschwert)
anreiht und durch das Schwert von Gilton illustriert, ist
natürlich unzulässig. Diese „wundersarqen“, mit mystischen
Kräften ausgestatteten Ringe eines märchenhaften Wunder-
schwertes dürfen, wenn sie wirklich auf Ringe von prak-
tischer Bedeutung zurückgehen, doch nur aus der Bewaff-
nung des 13. Jahrhunderts erklärt werden.