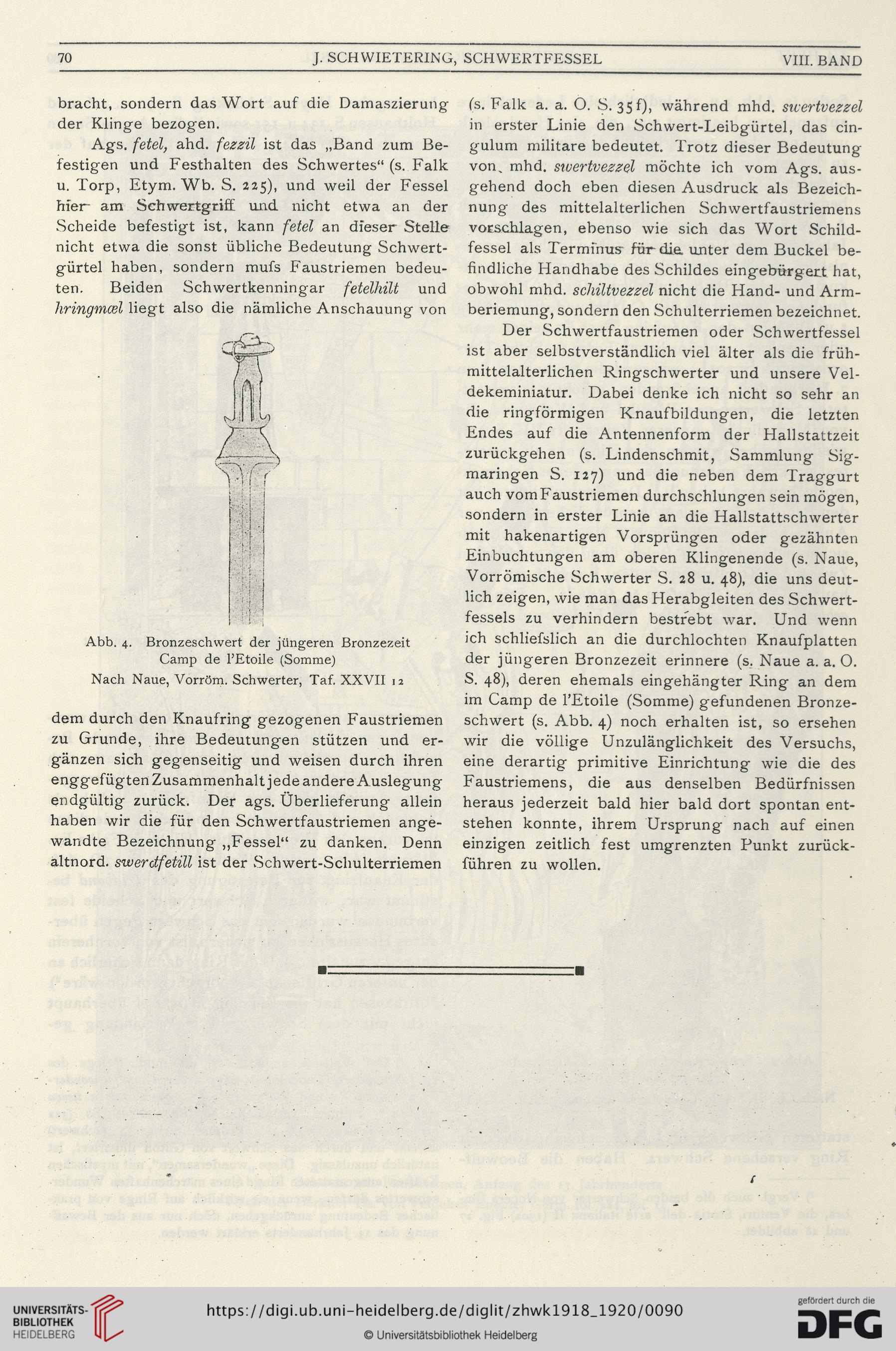70
J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL
VIII. BAND
bracht, sondern das Wort auf die Damaszierung
der Klinge bezogen.
Ags. fetel, ahd. fezzil ist das „Band zum Be-
festigen und Festhalten des Schwertes“ (s. Falk
u. Torp, Etym. Wb. S. 225), und weil der Fessel
hier- am Schwertgriff umd nicht etwa an der
Scheide befestigt ist, kann fetel an dieser Stelle
nicht etwa die sonst übliche Bedeutung Schwert-
gürtel haben, sondern mufs Faustriemen bedeu-
ten. Beiden Schwertkenningar fetelhilt und
liringmcel liegt also die nämliche Anschauung von
Abb. 4. Bronzeschwert der jüngeren Bronzezeit
Camp de l’Etoile (Somme)
Nach Naue, Vorröm. Schwerter, Taf. XXVII 12
dem durch den Knaufring gezogenen Faustriemen
zu Grunde, ihre Bedeutungen stützen und er-
gänzen sich gegenseitig und weisen durch ihren
enggefügtenZusammenhalt jedeandere Auslegung
endgültig zurück. Der ags. Überlieferung allein
haben wir die für den Schwertfaustriemen ange-
wandte Bezeichnung „Fessel“ zu danken. Denn
altnord. swerdfetill ist der Schwert-Schulterriemen
(s. Falk a. a. O. S. 35 f), während mhd. swertvezzel
in erster Linie den Schwert-Leibgürtel, das cin-
gulum militare bedeutet. Trotz dieser Bedeutung
von, mhd. swertvezzel möchte ich vom Ags. aus-
gehend doch eben diesen Ausdruck als Bezeich-
nung des mittelalterlichen Schwertfaustriemens
vorschlagen, ebenso wie sich das Wort Schild-
fessel als Terminus- für die. unter dem Buckel be-
findliche Handhabe des Schildes eingebürgert hat,
obwohl mhd. schiltvezzel nicht die Hand- und Arm-
beriemung, sondern den Schulterriemen bezeichnet.
Der Schwertfaustriemen oder Schwertfessel
ist aber selbstverständlich viel älter als die früh-
mittelalterlichen Ringschwerter und unsere Vel-
dekeminiatur. Dabei denke ich nicht so sehr an
die ringförmigen Knaufbildungen, die letzten
Endes auf die Antennenform der Hallstattzeit
zurückgehen (s. Lindenschmit, Sammlung Sig-
maringen S. 127) und die neben dem Traggurt
auch vom Faustriemen durchschlungen sein mögen,
sondern in erster Linie an die Hallstattschwerter
mit hakenartigen Vorsprüngen oder gezähnten
Einbuchtungen am oberen Klingenende (s. Naue,
Vorrömische Schwerter S. 28 u. 48), die uns deut-
lich zeigen, wie man das Herabgleiten des Schwert-
fessels zu verhindern bestrebt war. Und wenn
ich schliefslich an die durchlochten Knaufplatten
der jüngeren Bronzezeit erinnere (s, Naue a. a. O.
S. 48), deren ehemals eingehängter Ring an dem
im Camp de l’Etoile (Somme) gefundenen Bronze-
schwert (s. Abb. 4) noch erhalten ist, so ersehen
wir die völlige Unzulänglichkeit des Versuchs,
eine derartig primitive Einrichtung wie die des
Faustriemens, die aus denselben Bedürfnissen
heraus jederzeit bald hier bald dort spontan ent-
stehen konnte, ihrem Ursprung nach auf einen
einzigen zeitlich fest umgrenzten Punkt zurück-
führen zu wollen.
J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL
VIII. BAND
bracht, sondern das Wort auf die Damaszierung
der Klinge bezogen.
Ags. fetel, ahd. fezzil ist das „Band zum Be-
festigen und Festhalten des Schwertes“ (s. Falk
u. Torp, Etym. Wb. S. 225), und weil der Fessel
hier- am Schwertgriff umd nicht etwa an der
Scheide befestigt ist, kann fetel an dieser Stelle
nicht etwa die sonst übliche Bedeutung Schwert-
gürtel haben, sondern mufs Faustriemen bedeu-
ten. Beiden Schwertkenningar fetelhilt und
liringmcel liegt also die nämliche Anschauung von
Abb. 4. Bronzeschwert der jüngeren Bronzezeit
Camp de l’Etoile (Somme)
Nach Naue, Vorröm. Schwerter, Taf. XXVII 12
dem durch den Knaufring gezogenen Faustriemen
zu Grunde, ihre Bedeutungen stützen und er-
gänzen sich gegenseitig und weisen durch ihren
enggefügtenZusammenhalt jedeandere Auslegung
endgültig zurück. Der ags. Überlieferung allein
haben wir die für den Schwertfaustriemen ange-
wandte Bezeichnung „Fessel“ zu danken. Denn
altnord. swerdfetill ist der Schwert-Schulterriemen
(s. Falk a. a. O. S. 35 f), während mhd. swertvezzel
in erster Linie den Schwert-Leibgürtel, das cin-
gulum militare bedeutet. Trotz dieser Bedeutung
von, mhd. swertvezzel möchte ich vom Ags. aus-
gehend doch eben diesen Ausdruck als Bezeich-
nung des mittelalterlichen Schwertfaustriemens
vorschlagen, ebenso wie sich das Wort Schild-
fessel als Terminus- für die. unter dem Buckel be-
findliche Handhabe des Schildes eingebürgert hat,
obwohl mhd. schiltvezzel nicht die Hand- und Arm-
beriemung, sondern den Schulterriemen bezeichnet.
Der Schwertfaustriemen oder Schwertfessel
ist aber selbstverständlich viel älter als die früh-
mittelalterlichen Ringschwerter und unsere Vel-
dekeminiatur. Dabei denke ich nicht so sehr an
die ringförmigen Knaufbildungen, die letzten
Endes auf die Antennenform der Hallstattzeit
zurückgehen (s. Lindenschmit, Sammlung Sig-
maringen S. 127) und die neben dem Traggurt
auch vom Faustriemen durchschlungen sein mögen,
sondern in erster Linie an die Hallstattschwerter
mit hakenartigen Vorsprüngen oder gezähnten
Einbuchtungen am oberen Klingenende (s. Naue,
Vorrömische Schwerter S. 28 u. 48), die uns deut-
lich zeigen, wie man das Herabgleiten des Schwert-
fessels zu verhindern bestrebt war. Und wenn
ich schliefslich an die durchlochten Knaufplatten
der jüngeren Bronzezeit erinnere (s, Naue a. a. O.
S. 48), deren ehemals eingehängter Ring an dem
im Camp de l’Etoile (Somme) gefundenen Bronze-
schwert (s. Abb. 4) noch erhalten ist, so ersehen
wir die völlige Unzulänglichkeit des Versuchs,
eine derartig primitive Einrichtung wie die des
Faustriemens, die aus denselben Bedürfnissen
heraus jederzeit bald hier bald dort spontan ent-
stehen konnte, ihrem Ursprung nach auf einen
einzigen zeitlich fest umgrenzten Punkt zurück-
führen zu wollen.