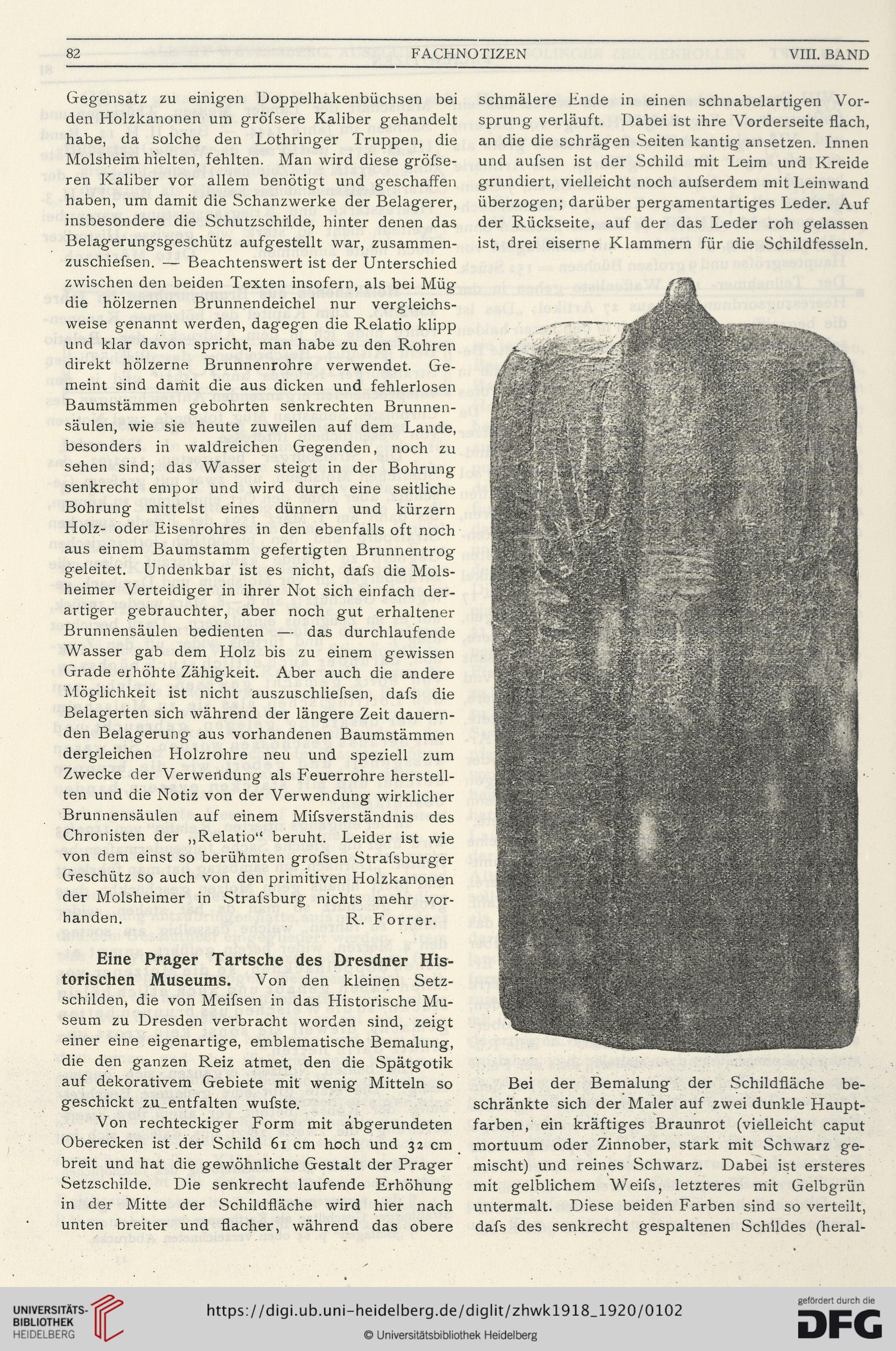82
FACHNOTIZEN
VIII. BAND
Gegensatz zu einigen Doppelhakenbüchsen bei
den Holzkanonen um gröfsere Kaliber gehandelt
habe, da solche den Lothringer Truppen, die
Molsheim hielten, fehlten. Man wird diese gröfse-
ren Kaliber vor allem benötigt und geschaffen
haben, um damit die Schanzwerke der Belagerer,
insbesondere die Schutzschilde, hinter denen das
Belagerungsgeschütz aufgestellt war, zusammen-
zuschiefsen. — Beachtenswert ist der Unterschied
zwischen den beiden Texten insofern, als bei Müg
die hölzernen Brunnendeichel nur vergleichs-
weise genannt werden, dagegen die Relatio klipp
und klar davon spricht, man habe zu den Rohren
direkt hölzerne Brunnenrohre verwendet. Ge-
meint sind damit die aus dicken und fehlerlosen
Baumstämmen gebohrten senkrechten Brunnen-
säulen, wie sie heute zuweilen auf dem Lande,
besonders in waldreichen Gegenden, noch zu
sehen sind; das Wasser steigt in der Bohrung
senkrecht empor und wird durch eine seitliche
Bohrung mittelst eines dünnern und kürzern
Holz- oder Eisenrohres in den ebenfalls oft noch
aus einem Baumstamm gefertigten Brunnentrog
geleitet. Undenkbar ist es nicht, dafs die Möls-
heimer Verteidiger in ihrer Not sich einfach der-
artiger gebrauchter, aber noch gut erhaltener
Brunnensäulen bedienten — das durchlaufende
Wasser gab dem Holz bis zu einem gewissen
Grade erhöhte Zähigkeit. Aber auch die andere
Möglichkeit ist nicht auszuschliefsen, dafs die
Belagerten sich während der längere Zeit dauern-
den Belagerung aus vorhandenen Baumstämmen
dergleichen Holzrohre neu und speziell zum
Zwecke der Verwendung als Feuerrohre herstell-
ten und die Notiz von der Verwendung wirklicher
Brunnen.säulen auf einem Mifsverständnis des
Chronisten der „Relatio“ beruht. Leider ist wie
von dem einst so berühmten grofsen Strafsburger
Geschütz so auch von den primitiven Holzkanonen
der Molsheimer in Strafsburg nichts mehr vor-
handen. R. Forrer.
Eine Prager Tartsche des Dresdner His-
torischen Museums. Von den kleinen Setz-
schilden, die von Meifsen in das Historische Mu-
seum zu Dresden verbracht worden sind, zeigt
einer eine eigenartige, emblematische Bemalung,
die den ganzen Reiz atmet, den die Spätgotik
auf dekorativem Gebiete mit wenig Mitteln so
geschickt zu_entfalten wufste.
Von rechteckiger Form mit abgerundeten
Oberecken ist der Schild 61 cm hoch und 32 cm
breit und hat die gewöhnliche Gestalt der Prager
Setzschilde. Die senkrecht laufende Erhöhung
in der Mitte der Schildfläche wird hier nach
unten breiter und flacher, während das obere
schmälere Ende in einen schnabelartigen Vor-
sprung verläuft. Dabei ist ihre Vorderseite flach,
an die die schrägen Seiten kantig ansetzen. Innen
und aufsen ist der Schild mit Leim und Kreide
grundiert, vielleicht noch aufserdem mit Leinwand
überzogen; darüber pergamentartiges Leder. Auf
der Rückseite, auf der das Leder roh gelassen
ist, drei eiserne Klammern für die Schildfesseln.
Bei der Bemalung der Schildfläche be-
schränkte sich der Maler auf zwei dunkle Haupt-
farben,' ein kräftiges Braunrot (vielleicht caput
mortuum oder Zinnober, stark mit Schwarz ge-
mischt) und reines Schwarz. Dabei ist ersteres
mit gelblichem Weifs, letzteres mit Gelbgrün
untermalt. Diese beiden Farben sind so verteilt,
dafs des senkrecht gespaltenen Schildes (heral-
FACHNOTIZEN
VIII. BAND
Gegensatz zu einigen Doppelhakenbüchsen bei
den Holzkanonen um gröfsere Kaliber gehandelt
habe, da solche den Lothringer Truppen, die
Molsheim hielten, fehlten. Man wird diese gröfse-
ren Kaliber vor allem benötigt und geschaffen
haben, um damit die Schanzwerke der Belagerer,
insbesondere die Schutzschilde, hinter denen das
Belagerungsgeschütz aufgestellt war, zusammen-
zuschiefsen. — Beachtenswert ist der Unterschied
zwischen den beiden Texten insofern, als bei Müg
die hölzernen Brunnendeichel nur vergleichs-
weise genannt werden, dagegen die Relatio klipp
und klar davon spricht, man habe zu den Rohren
direkt hölzerne Brunnenrohre verwendet. Ge-
meint sind damit die aus dicken und fehlerlosen
Baumstämmen gebohrten senkrechten Brunnen-
säulen, wie sie heute zuweilen auf dem Lande,
besonders in waldreichen Gegenden, noch zu
sehen sind; das Wasser steigt in der Bohrung
senkrecht empor und wird durch eine seitliche
Bohrung mittelst eines dünnern und kürzern
Holz- oder Eisenrohres in den ebenfalls oft noch
aus einem Baumstamm gefertigten Brunnentrog
geleitet. Undenkbar ist es nicht, dafs die Möls-
heimer Verteidiger in ihrer Not sich einfach der-
artiger gebrauchter, aber noch gut erhaltener
Brunnensäulen bedienten — das durchlaufende
Wasser gab dem Holz bis zu einem gewissen
Grade erhöhte Zähigkeit. Aber auch die andere
Möglichkeit ist nicht auszuschliefsen, dafs die
Belagerten sich während der längere Zeit dauern-
den Belagerung aus vorhandenen Baumstämmen
dergleichen Holzrohre neu und speziell zum
Zwecke der Verwendung als Feuerrohre herstell-
ten und die Notiz von der Verwendung wirklicher
Brunnen.säulen auf einem Mifsverständnis des
Chronisten der „Relatio“ beruht. Leider ist wie
von dem einst so berühmten grofsen Strafsburger
Geschütz so auch von den primitiven Holzkanonen
der Molsheimer in Strafsburg nichts mehr vor-
handen. R. Forrer.
Eine Prager Tartsche des Dresdner His-
torischen Museums. Von den kleinen Setz-
schilden, die von Meifsen in das Historische Mu-
seum zu Dresden verbracht worden sind, zeigt
einer eine eigenartige, emblematische Bemalung,
die den ganzen Reiz atmet, den die Spätgotik
auf dekorativem Gebiete mit wenig Mitteln so
geschickt zu_entfalten wufste.
Von rechteckiger Form mit abgerundeten
Oberecken ist der Schild 61 cm hoch und 32 cm
breit und hat die gewöhnliche Gestalt der Prager
Setzschilde. Die senkrecht laufende Erhöhung
in der Mitte der Schildfläche wird hier nach
unten breiter und flacher, während das obere
schmälere Ende in einen schnabelartigen Vor-
sprung verläuft. Dabei ist ihre Vorderseite flach,
an die die schrägen Seiten kantig ansetzen. Innen
und aufsen ist der Schild mit Leim und Kreide
grundiert, vielleicht noch aufserdem mit Leinwand
überzogen; darüber pergamentartiges Leder. Auf
der Rückseite, auf der das Leder roh gelassen
ist, drei eiserne Klammern für die Schildfesseln.
Bei der Bemalung der Schildfläche be-
schränkte sich der Maler auf zwei dunkle Haupt-
farben,' ein kräftiges Braunrot (vielleicht caput
mortuum oder Zinnober, stark mit Schwarz ge-
mischt) und reines Schwarz. Dabei ist ersteres
mit gelblichem Weifs, letzteres mit Gelbgrün
untermalt. Diese beiden Farben sind so verteilt,
dafs des senkrecht gespaltenen Schildes (heral-