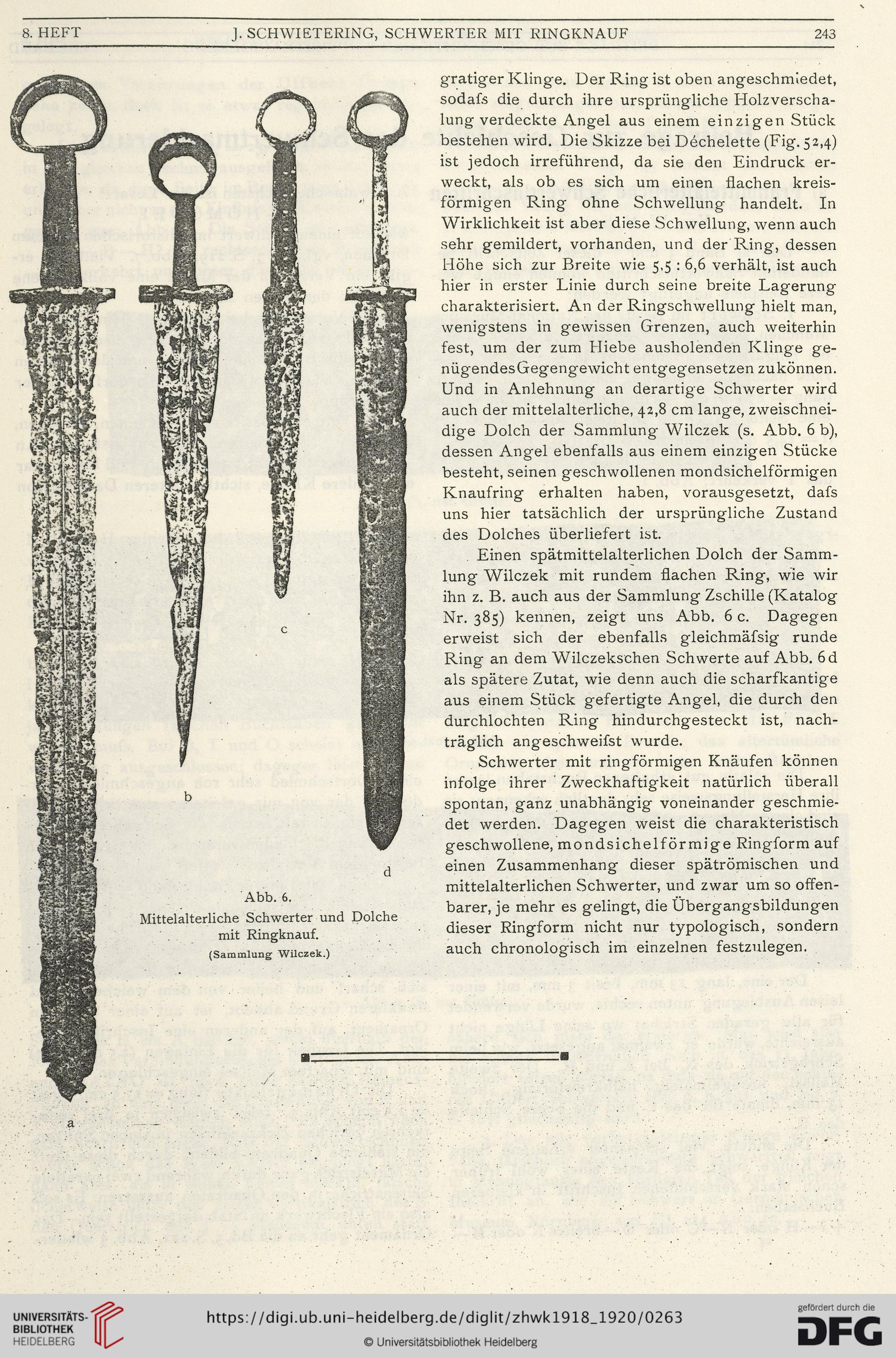8. HEFT
J. SCHWIETERING, SCHWERTER MIT RINGKNAUF
243
d
Abb. 6.
Mittelalterliche Schwerter und Dolche
mit Ringknauf.
(Sammlung Wilczek.)
grätiger Klinge. Der Ring ist oben angeschmiedet,
sodafs die durch ihre ursprüngliche Holzverscha-
lung verdeckte Angel aus einem einzigen Stück
bestehen wird. Die Skizze bei Dechelette (Fig. 52,4)
ist jedoch irreführend, da sie den Eindruck er-
weckt, als ob es sich um einen flachen kreis-
förmigen Ring ohne Schwellung handelt. In
Wirklichkeit ist aber diese Schwellung, wenn auch
sehr gemildert, vorhanden, und der Ring, dessen
Höhe sich zur Breite wie 5,5 : 6,6 verhält, ist auch
hier in erster Linie durch seine breite Lagerung
charakterisiert. An der Ringschwellung hielt man,
wenigstens in gewissen Grenzen, auch weiterhin
fest, um der zum Hiebe ausholenden Klinge ge-
nügendesGegengewicht entgegensetzen zukönnen.
Und in Anlehnung an derartige Schwerter wird
auch der mittelalterliche, 42,8 cm lange, zweischnei-
dige Dolch der Sammlung Wilczek (s. Abb. 6 b),
dessen Angel ebenfalls aus einem einzigen Stücke
besteht, seinen geschwollenen mondsichelförmigen
Knaufring erhalten haben, vorausgesetzt, dafs
uns hier tatsächlich der ursprüngliche Zustand
des Dolches überliefert ist.
Einen spätmittelalterlichen Dolch der Samm-
lung Wilczek mit rundem flachen Ring, wie wir
ihn z. B. auch aus der Sammlung Zschille (Katalog
Nr. 385) kennen, zeigt uns Abb. 6 c. Dagegen
erweist sich der ebenfalls gleichmäfsig runde
Ring an dem Wilczekschen Schwerte auf Abb. 6d
als spätere Zutat, wie denn auch die scharfkantige
aus einem Stück gefertigte Angel, die durch den
durchlochten Ring hindurchgesteckt ist, nach-
träglich angeschweifst wurde.
Schwerter mit ringförmigen Knäufen können
infolge ihrer Zweckhaftigkeit natürlich überall
spontan, ganz unabhängig voneinander geschmie-
det werden. Dagegen weist die charakteristisch
geschwollene, mondsichelförmige Ringform auf
einen Zusammenhang dieser spätrömischen und
mittelalterlichen Schwerter, und zwar um so offen-
barer, je mehr es gelingt, die Übergangsbildungen
dieser Ringform nicht nur typologisch, sondern
auch chronologisch im einzelnen festzulegen.
J. SCHWIETERING, SCHWERTER MIT RINGKNAUF
243
d
Abb. 6.
Mittelalterliche Schwerter und Dolche
mit Ringknauf.
(Sammlung Wilczek.)
grätiger Klinge. Der Ring ist oben angeschmiedet,
sodafs die durch ihre ursprüngliche Holzverscha-
lung verdeckte Angel aus einem einzigen Stück
bestehen wird. Die Skizze bei Dechelette (Fig. 52,4)
ist jedoch irreführend, da sie den Eindruck er-
weckt, als ob es sich um einen flachen kreis-
förmigen Ring ohne Schwellung handelt. In
Wirklichkeit ist aber diese Schwellung, wenn auch
sehr gemildert, vorhanden, und der Ring, dessen
Höhe sich zur Breite wie 5,5 : 6,6 verhält, ist auch
hier in erster Linie durch seine breite Lagerung
charakterisiert. An der Ringschwellung hielt man,
wenigstens in gewissen Grenzen, auch weiterhin
fest, um der zum Hiebe ausholenden Klinge ge-
nügendesGegengewicht entgegensetzen zukönnen.
Und in Anlehnung an derartige Schwerter wird
auch der mittelalterliche, 42,8 cm lange, zweischnei-
dige Dolch der Sammlung Wilczek (s. Abb. 6 b),
dessen Angel ebenfalls aus einem einzigen Stücke
besteht, seinen geschwollenen mondsichelförmigen
Knaufring erhalten haben, vorausgesetzt, dafs
uns hier tatsächlich der ursprüngliche Zustand
des Dolches überliefert ist.
Einen spätmittelalterlichen Dolch der Samm-
lung Wilczek mit rundem flachen Ring, wie wir
ihn z. B. auch aus der Sammlung Zschille (Katalog
Nr. 385) kennen, zeigt uns Abb. 6 c. Dagegen
erweist sich der ebenfalls gleichmäfsig runde
Ring an dem Wilczekschen Schwerte auf Abb. 6d
als spätere Zutat, wie denn auch die scharfkantige
aus einem Stück gefertigte Angel, die durch den
durchlochten Ring hindurchgesteckt ist, nach-
träglich angeschweifst wurde.
Schwerter mit ringförmigen Knäufen können
infolge ihrer Zweckhaftigkeit natürlich überall
spontan, ganz unabhängig voneinander geschmie-
det werden. Dagegen weist die charakteristisch
geschwollene, mondsichelförmige Ringform auf
einen Zusammenhang dieser spätrömischen und
mittelalterlichen Schwerter, und zwar um so offen-
barer, je mehr es gelingt, die Übergangsbildungen
dieser Ringform nicht nur typologisch, sondern
auch chronologisch im einzelnen festzulegen.