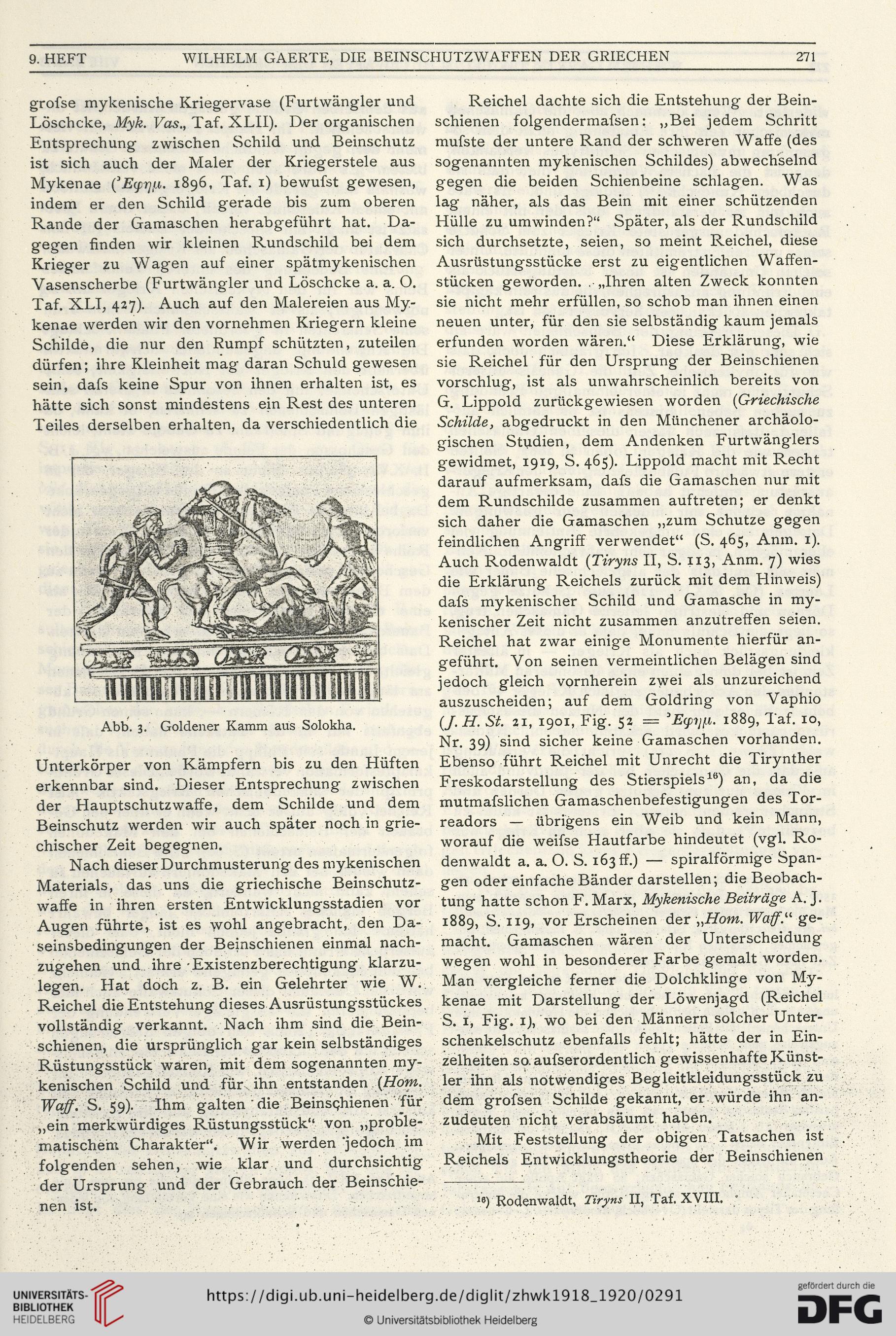9. HEFT
WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN
271
grofse mykenische Kriegervase (Furtwängler und
Löschcke, Myk. Vas., Taf. XLII). Der organischen
Entsprechung zwischen Schild und Beinschutz
ist sich auch der Maler der Kriegerstele aus
Mykenae (3Eg)T]u. 1896, Taf. 1) bewufst gewesen,
indem er den Schild gerade bis zum oberen
Rande der Gamaschen herabgeführt hat. Da-
gegen finden wir kleinen Rundschild bei dem
Krieger zu Wagen auf einer spätmykenischen
Vasenscherbe (Furtwängler und Löschcke a. a. O.
Taf. XLI, 427). Auch auf den Malereien aus My-
kenae werden wir den vornehmen Kriegern kleine
Schilde, die nur den Rumpf schützten, zuteilen
dürfen; ihre Kleinheit mag daran Schuld gewesen
sein, dafs keine Spur von ihnen erhalten ist, es
hätte sich sonst mindestens ein Rest des unteren
Teiles derselben erhalten, da verschiedentlich die
Unterkörper von Kämpfern bis zu den Hüften
erkennbar sind. Dieser Entsprechung zwischen
der Hauptschutzwaffe, dem Schilde und dem
Beinschutz werden wir auch später noch in grie-
chischer Zeit begegnen.
Nach dieser Durchmusterung des mykenischen
Materials, das uns die griechische Beinschutz-
waffe in ihren ersten Entwicklungsstadien vor
Augen führte, ist es wohl angebracht, den Da-
seinsbedingungen der Beinschienen einmal nach-
zugehen und ihre -Existenzberechtigung klarzu-
legen. Hat doch z. B. ein Gelehrter wie W.
Reichel die Entstehung dieses Ausrüstungsstückes
vollständig verkannt. Nach ihm sind die Bein-
schienen, die ursprünglich gar kein selbständiges
Rüstungsstück waren, mit dem sogenannten my-
kenischen Schild und für. ihn entstanden (Hom.
Waff. S. 59). ' Ihm galten die Beinschienen für
„ein merkwürdiges Rüstungsstück“ von „proble-
matischem Charakter“. Wir werden 'jedoch im
folgenden sehen, wie klar und durchsichtig
der Ursprung und der Gebrauch der Beinschie-
nen ist.
Reichel dachte sich die Entstehung der Bein-
schienen folgendermafsen: „Bei jedem Schritt
mufste der untere Rand der schweren Waffe (des
sogenannten mykenischen Schildes) abwechselnd
gegen die beiden Schienbeine schlagen. Was
lag näher, als das Bein mit einer schützenden
Hülle zu umwinden?“ Später, als der Rundschild
sich durchsetzte, seien, so meint Reichel, diese
Ausrüstungsstücke erst zu eigentlichen Waffen-
stücken geworden. . „Ihren alten Zweck konnten
sie nicht mehr erfüllen, so schob man ihnen einen
neuen unter, für den sie selbständig kaum jemals
erfunden worden wären.“ Diese Erklärung, wie
sie Reichel für den Ursprung der Beinschienen
vorschlug, ist als unwahrscheinlich bereits von
G. Lippold zurückgewiesen worden (Griechische
Schilde, abgedruckt in den Münchener archäolo-
gischen Studien, dem Andenken Furtwänglers
gewidmet, 1919, S. 465). Lippold macht mit Recht
darauf aufmerksam, dafs die Gamaschen nur mit
dem Rundschilde zusammen auftreten; er denkt
sich daher die Gamaschen „zum Schutze gegen
feindlichen Angriff verwendet“ (S. 465, Anm. 1).
Auch Rodenwaldt (Tiryns II, S. 113, Anm. 7) wies
die Erklärung Reichels zurück mit dem Hinweis)
dafs mykenischer Schild und Gamasche in my-
kenischer Zeit nicht zusammen anzutreffen seien.
Reichel hat zwar einige Monumente hierfür an-
geführt. Von seinen vermeintlichen Belägen sind
jedoch gleich vornherein zwei als unzureichend
auszuscheiden; auf dem Goldring von Vaphio
(J. H. St. 21, 1901, Fig. 52 — ’Egiigi. 1889, Taf. 10,
Nr. 39) sind sicher keine Gamaschen vorhanden.
Ebenso führt Reichel mit Unrecht die Tirynther
Freskodarstellung des Stierspiels10) an, da die
mutmafslichen Gamaschenbefestigungen des Tor-
readors — übrigens ein Weib und kein Mann,
worauf die weifse Hautfarbe hindeutet (vgl. Ro-
denwaldt a. a. O. S. 163 ff.) — spiralförmige Span-
gen oder einfache Bänder darstellen; die Beobach-
tung hatte schon F. Marx, Mykenische Beiträge A. J.
1889, S. 119, vor Erscheinen der „Hom. Waff.“ ge-
macht. Gamaschen wären der Unterscheidung
wegen wohl in besonderer Farbe gemalt worden.
Man vergleiche ferner die Dolchklinge von My-
kenae mit Darstellung der Löwenjagd (Reichel
S. 1, Fig. 1), wo bei den Männern solcher Unter-
schenkelschutz ebenfalls fehlt; hätte der in Ein-
zelheiten so. aufserordentlich gewissenhafte Künst-
ler ihn als notwendiges Begleitkleidungsstück zu
dem grofsen Schilde gekannt, er würde ihn an-
zudeuten nicht verabsäumt haben.
Mit Feststellung der obigen Tatsachen ist /'
Reichels Entwicklungstheorie der Beinschienen
18) Rodenwaldt, Tiryns II, Taf. XVIII. ’ .
WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN
271
grofse mykenische Kriegervase (Furtwängler und
Löschcke, Myk. Vas., Taf. XLII). Der organischen
Entsprechung zwischen Schild und Beinschutz
ist sich auch der Maler der Kriegerstele aus
Mykenae (3Eg)T]u. 1896, Taf. 1) bewufst gewesen,
indem er den Schild gerade bis zum oberen
Rande der Gamaschen herabgeführt hat. Da-
gegen finden wir kleinen Rundschild bei dem
Krieger zu Wagen auf einer spätmykenischen
Vasenscherbe (Furtwängler und Löschcke a. a. O.
Taf. XLI, 427). Auch auf den Malereien aus My-
kenae werden wir den vornehmen Kriegern kleine
Schilde, die nur den Rumpf schützten, zuteilen
dürfen; ihre Kleinheit mag daran Schuld gewesen
sein, dafs keine Spur von ihnen erhalten ist, es
hätte sich sonst mindestens ein Rest des unteren
Teiles derselben erhalten, da verschiedentlich die
Unterkörper von Kämpfern bis zu den Hüften
erkennbar sind. Dieser Entsprechung zwischen
der Hauptschutzwaffe, dem Schilde und dem
Beinschutz werden wir auch später noch in grie-
chischer Zeit begegnen.
Nach dieser Durchmusterung des mykenischen
Materials, das uns die griechische Beinschutz-
waffe in ihren ersten Entwicklungsstadien vor
Augen führte, ist es wohl angebracht, den Da-
seinsbedingungen der Beinschienen einmal nach-
zugehen und ihre -Existenzberechtigung klarzu-
legen. Hat doch z. B. ein Gelehrter wie W.
Reichel die Entstehung dieses Ausrüstungsstückes
vollständig verkannt. Nach ihm sind die Bein-
schienen, die ursprünglich gar kein selbständiges
Rüstungsstück waren, mit dem sogenannten my-
kenischen Schild und für. ihn entstanden (Hom.
Waff. S. 59). ' Ihm galten die Beinschienen für
„ein merkwürdiges Rüstungsstück“ von „proble-
matischem Charakter“. Wir werden 'jedoch im
folgenden sehen, wie klar und durchsichtig
der Ursprung und der Gebrauch der Beinschie-
nen ist.
Reichel dachte sich die Entstehung der Bein-
schienen folgendermafsen: „Bei jedem Schritt
mufste der untere Rand der schweren Waffe (des
sogenannten mykenischen Schildes) abwechselnd
gegen die beiden Schienbeine schlagen. Was
lag näher, als das Bein mit einer schützenden
Hülle zu umwinden?“ Später, als der Rundschild
sich durchsetzte, seien, so meint Reichel, diese
Ausrüstungsstücke erst zu eigentlichen Waffen-
stücken geworden. . „Ihren alten Zweck konnten
sie nicht mehr erfüllen, so schob man ihnen einen
neuen unter, für den sie selbständig kaum jemals
erfunden worden wären.“ Diese Erklärung, wie
sie Reichel für den Ursprung der Beinschienen
vorschlug, ist als unwahrscheinlich bereits von
G. Lippold zurückgewiesen worden (Griechische
Schilde, abgedruckt in den Münchener archäolo-
gischen Studien, dem Andenken Furtwänglers
gewidmet, 1919, S. 465). Lippold macht mit Recht
darauf aufmerksam, dafs die Gamaschen nur mit
dem Rundschilde zusammen auftreten; er denkt
sich daher die Gamaschen „zum Schutze gegen
feindlichen Angriff verwendet“ (S. 465, Anm. 1).
Auch Rodenwaldt (Tiryns II, S. 113, Anm. 7) wies
die Erklärung Reichels zurück mit dem Hinweis)
dafs mykenischer Schild und Gamasche in my-
kenischer Zeit nicht zusammen anzutreffen seien.
Reichel hat zwar einige Monumente hierfür an-
geführt. Von seinen vermeintlichen Belägen sind
jedoch gleich vornherein zwei als unzureichend
auszuscheiden; auf dem Goldring von Vaphio
(J. H. St. 21, 1901, Fig. 52 — ’Egiigi. 1889, Taf. 10,
Nr. 39) sind sicher keine Gamaschen vorhanden.
Ebenso führt Reichel mit Unrecht die Tirynther
Freskodarstellung des Stierspiels10) an, da die
mutmafslichen Gamaschenbefestigungen des Tor-
readors — übrigens ein Weib und kein Mann,
worauf die weifse Hautfarbe hindeutet (vgl. Ro-
denwaldt a. a. O. S. 163 ff.) — spiralförmige Span-
gen oder einfache Bänder darstellen; die Beobach-
tung hatte schon F. Marx, Mykenische Beiträge A. J.
1889, S. 119, vor Erscheinen der „Hom. Waff.“ ge-
macht. Gamaschen wären der Unterscheidung
wegen wohl in besonderer Farbe gemalt worden.
Man vergleiche ferner die Dolchklinge von My-
kenae mit Darstellung der Löwenjagd (Reichel
S. 1, Fig. 1), wo bei den Männern solcher Unter-
schenkelschutz ebenfalls fehlt; hätte der in Ein-
zelheiten so. aufserordentlich gewissenhafte Künst-
ler ihn als notwendiges Begleitkleidungsstück zu
dem grofsen Schilde gekannt, er würde ihn an-
zudeuten nicht verabsäumt haben.
Mit Feststellung der obigen Tatsachen ist /'
Reichels Entwicklungstheorie der Beinschienen
18) Rodenwaldt, Tiryns II, Taf. XVIII. ’ .