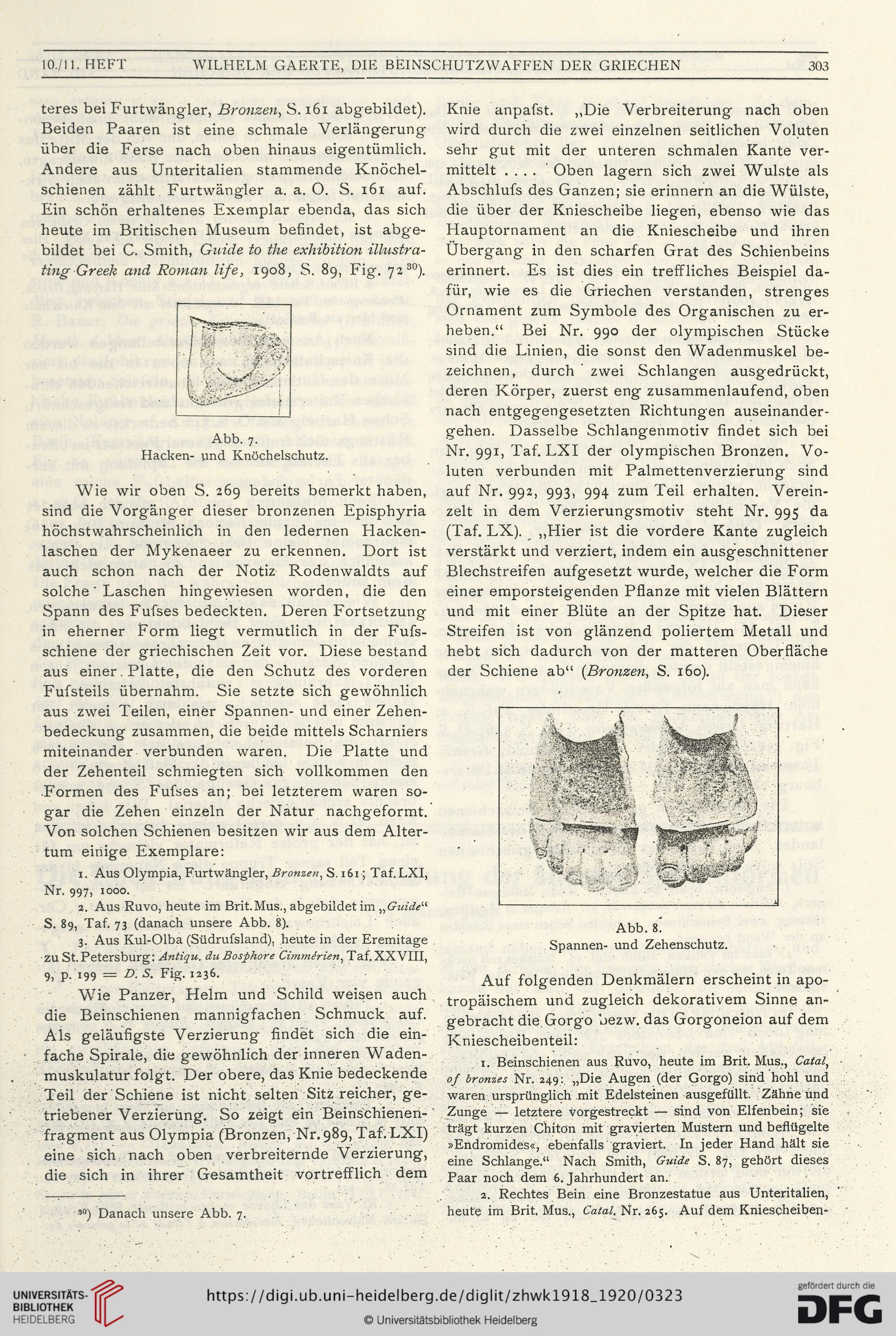10./11 • HEFT
WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN
303
teres bei Furtwängler, Bronzen, S. 161 abgebildet).
Beiden Paaren ist eine schmale Verlängerung
über die Ferse nach oben hinaus eigentümlich.
Andere aus Unteritalien stammende Knöchel-
schienen zählt Furtwängler a. a. O. S. 161 auf.
Ein schön erhaltenes Exemplar ebenda, das sich
heute im Britischen Museum befindet, ist abge-
bildet bei C. Smith, Guide to the exliibition illustra-
ting Greek and Roman life, 1908, S. 89, Fig. 7230).
Abb. 7.
Hacken- und Knöchelschutz.
Wie wir oben S. 269 bereits bemerkt haben,
sind die Vorgänger dieser bronzenen Episphyria
höchstwahrscheinlich in den ledernen Hacken-
laschen der Mykenaeer zu erkennen. Dort ist
auch schon nach der Notiz Rodenwaldts auf
solche ’ Laschen hingewiesen worden, die den
Spann des Fufses bedeckten. Deren Fortsetzung
in eherner Form liegt vermutlich in der Fufs-
schiene der griechischen Zeit vor. Diese bestand
aus einer. Platte, die den Schutz des vorderen
Fufsteils übernahm. Sie setzte sich gewöhnlich
aus zwei Teilen, einer Spannen- und einer Zehen-
bedeckung zusammen, die beide mittels Scharniers
miteinander verbunden waren. Die Platte und
der Zehenteil schmiegten sich vollkommen den
Formen des Fufses an; bei letzterem waren so-
gar die Zehen einzeln der Natur nachgeformt.
Von solchen Schienen besitzen wir aus dem Alter-
tum einige Exemplare:
1. Aus Olympia, Furtwängler, Bronzen, S. 161; Taf. LXI,
Nr. 997, 1000.
2. Aus Ruvo, heute im Brit.Mus., abgebildet im „Guide“
S. 89, Taf. 73 (danach unsere Abb. 8).
3. Aus Kul-Olba (Südrufsland), heute in der Eremitage
•ZU St.Petersburg: Antiqu. du BosRhore Cimmerien, Taf. XXVIII,
9, p. 199 = D. S. Fig. 1236.
Wie Panzer, Helm und Schild weisen auch
die Beinschienen mannigfachen Schmuck auf.
Als geläufigste Verzierung findet sich die ein-
fache Spirale, die gewöhnlich der inneren Waden-
muskulatur folgt. Der obere, das Knie bedeckende
Teil der Schiene ist nicht selten Sitz reicher, ge-
triebener Verzierung. So zeigt ein Beinschienen-
fragment aus Olympia (Bronzen, Nr. 989, Taf. LXI)
eine sich nach oben verbreiternde Verzierung,
die sich in ihrer Gesamtheit vortrefflich dem
30) Danach unsere Abb. 7.
Knie anpafst. ,,Die Verbreiterung nach oben
wird durch die zwei einzelnen seitlichen Voluten
sehr gut mit der unteren schmalen Kante ver-
mittelt .... Oben lagern sich zwei Wulste als
Abschlufs des Ganzen; sie erinnern an die Wülste,
die über der Kniescheibe liegen, ebenso wie das
Hauptornament an die Kniescheibe und ihren
Übergang in den scharfen Grat des Schienbeins
erinnert. Es ist dies ein treffliches Beispiel da-
für, wie es die Griechen verstanden, strenges
Ornament zum Symbole des Organischen zu er-
heben.“ Bei Nr. 990 der olympischen Stücke
sind die Linien, die sonst den Wadenmuskel be-
zeichnen, durch zwei Schlangen ausgedrückt,
deren Körper, zuerst eng zusammenlaufend, oben
nach entgegengesetzten Richtungen auseinander-
gehen. Dasselbe Schlangenmotiv findet sich bei
Nr. 991, Taf. LXI der olympischen Bronzen. Vo-
luten verbunden mit Palmettenverzierung sind
auf Nr. 992, 993, 994 zum Teil erhalten. Verein-
zelt in dem Verzierungsmotiv steht Nr. 995 da
(Taf. LX). „Hier ist die vordere Kante zugleich
verstärkt und verziert, indem ein ausgeschnittener
Blechstreifen aufgesetzt wurde, welcher die Form
einer emporsteigenden Pflanze mit vielen Blättern
und mit einer Blüte an der Spitze hat. Dieser
Streifen ist von glänzend poliertem Metall und
hebt sich dadurch von der matteren Oberfläche
der Schiene ab“ (Bronzen, S. 160).
Auf folgenden Denkmälern erscheint in apo-
tropäischem und zugleich dekorativem Sinne an-
gebracht die.Gorgo bezw. das Gorgoneion auf dem
Kniescheibenteil:
1. Beinschienen aus Ruvo, heute im Brit.Mus., Catal,
of bronzes Nr. 249: „Die Augen (der Gorgo) sind hohl und
waren ursprünglich mit Edelsteinen ausgefüllt. Zähne und
Zunge — letztere vorgestreckt — sind von Elfenbein; sie
trägt kurzen Chiton mit gravierten Mustern und beflügelte
»Endromides«, ebenfalls graviert. In jeder Hand hält sie
eine Schlange.“ Nach Smith, Guide S. 87, gehört dieses
Paar noch dem 6. Jahrhundert an.
2. Rechtes Bein eine Bronzestatue aus Unteritalien,
heute im Brit. Mus., Catal. Nr. 265. Auf dem Kniescheiben-
WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN
303
teres bei Furtwängler, Bronzen, S. 161 abgebildet).
Beiden Paaren ist eine schmale Verlängerung
über die Ferse nach oben hinaus eigentümlich.
Andere aus Unteritalien stammende Knöchel-
schienen zählt Furtwängler a. a. O. S. 161 auf.
Ein schön erhaltenes Exemplar ebenda, das sich
heute im Britischen Museum befindet, ist abge-
bildet bei C. Smith, Guide to the exliibition illustra-
ting Greek and Roman life, 1908, S. 89, Fig. 7230).
Abb. 7.
Hacken- und Knöchelschutz.
Wie wir oben S. 269 bereits bemerkt haben,
sind die Vorgänger dieser bronzenen Episphyria
höchstwahrscheinlich in den ledernen Hacken-
laschen der Mykenaeer zu erkennen. Dort ist
auch schon nach der Notiz Rodenwaldts auf
solche ’ Laschen hingewiesen worden, die den
Spann des Fufses bedeckten. Deren Fortsetzung
in eherner Form liegt vermutlich in der Fufs-
schiene der griechischen Zeit vor. Diese bestand
aus einer. Platte, die den Schutz des vorderen
Fufsteils übernahm. Sie setzte sich gewöhnlich
aus zwei Teilen, einer Spannen- und einer Zehen-
bedeckung zusammen, die beide mittels Scharniers
miteinander verbunden waren. Die Platte und
der Zehenteil schmiegten sich vollkommen den
Formen des Fufses an; bei letzterem waren so-
gar die Zehen einzeln der Natur nachgeformt.
Von solchen Schienen besitzen wir aus dem Alter-
tum einige Exemplare:
1. Aus Olympia, Furtwängler, Bronzen, S. 161; Taf. LXI,
Nr. 997, 1000.
2. Aus Ruvo, heute im Brit.Mus., abgebildet im „Guide“
S. 89, Taf. 73 (danach unsere Abb. 8).
3. Aus Kul-Olba (Südrufsland), heute in der Eremitage
•ZU St.Petersburg: Antiqu. du BosRhore Cimmerien, Taf. XXVIII,
9, p. 199 = D. S. Fig. 1236.
Wie Panzer, Helm und Schild weisen auch
die Beinschienen mannigfachen Schmuck auf.
Als geläufigste Verzierung findet sich die ein-
fache Spirale, die gewöhnlich der inneren Waden-
muskulatur folgt. Der obere, das Knie bedeckende
Teil der Schiene ist nicht selten Sitz reicher, ge-
triebener Verzierung. So zeigt ein Beinschienen-
fragment aus Olympia (Bronzen, Nr. 989, Taf. LXI)
eine sich nach oben verbreiternde Verzierung,
die sich in ihrer Gesamtheit vortrefflich dem
30) Danach unsere Abb. 7.
Knie anpafst. ,,Die Verbreiterung nach oben
wird durch die zwei einzelnen seitlichen Voluten
sehr gut mit der unteren schmalen Kante ver-
mittelt .... Oben lagern sich zwei Wulste als
Abschlufs des Ganzen; sie erinnern an die Wülste,
die über der Kniescheibe liegen, ebenso wie das
Hauptornament an die Kniescheibe und ihren
Übergang in den scharfen Grat des Schienbeins
erinnert. Es ist dies ein treffliches Beispiel da-
für, wie es die Griechen verstanden, strenges
Ornament zum Symbole des Organischen zu er-
heben.“ Bei Nr. 990 der olympischen Stücke
sind die Linien, die sonst den Wadenmuskel be-
zeichnen, durch zwei Schlangen ausgedrückt,
deren Körper, zuerst eng zusammenlaufend, oben
nach entgegengesetzten Richtungen auseinander-
gehen. Dasselbe Schlangenmotiv findet sich bei
Nr. 991, Taf. LXI der olympischen Bronzen. Vo-
luten verbunden mit Palmettenverzierung sind
auf Nr. 992, 993, 994 zum Teil erhalten. Verein-
zelt in dem Verzierungsmotiv steht Nr. 995 da
(Taf. LX). „Hier ist die vordere Kante zugleich
verstärkt und verziert, indem ein ausgeschnittener
Blechstreifen aufgesetzt wurde, welcher die Form
einer emporsteigenden Pflanze mit vielen Blättern
und mit einer Blüte an der Spitze hat. Dieser
Streifen ist von glänzend poliertem Metall und
hebt sich dadurch von der matteren Oberfläche
der Schiene ab“ (Bronzen, S. 160).
Auf folgenden Denkmälern erscheint in apo-
tropäischem und zugleich dekorativem Sinne an-
gebracht die.Gorgo bezw. das Gorgoneion auf dem
Kniescheibenteil:
1. Beinschienen aus Ruvo, heute im Brit.Mus., Catal,
of bronzes Nr. 249: „Die Augen (der Gorgo) sind hohl und
waren ursprünglich mit Edelsteinen ausgefüllt. Zähne und
Zunge — letztere vorgestreckt — sind von Elfenbein; sie
trägt kurzen Chiton mit gravierten Mustern und beflügelte
»Endromides«, ebenfalls graviert. In jeder Hand hält sie
eine Schlange.“ Nach Smith, Guide S. 87, gehört dieses
Paar noch dem 6. Jahrhundert an.
2. Rechtes Bein eine Bronzestatue aus Unteritalien,
heute im Brit. Mus., Catal. Nr. 265. Auf dem Kniescheiben-