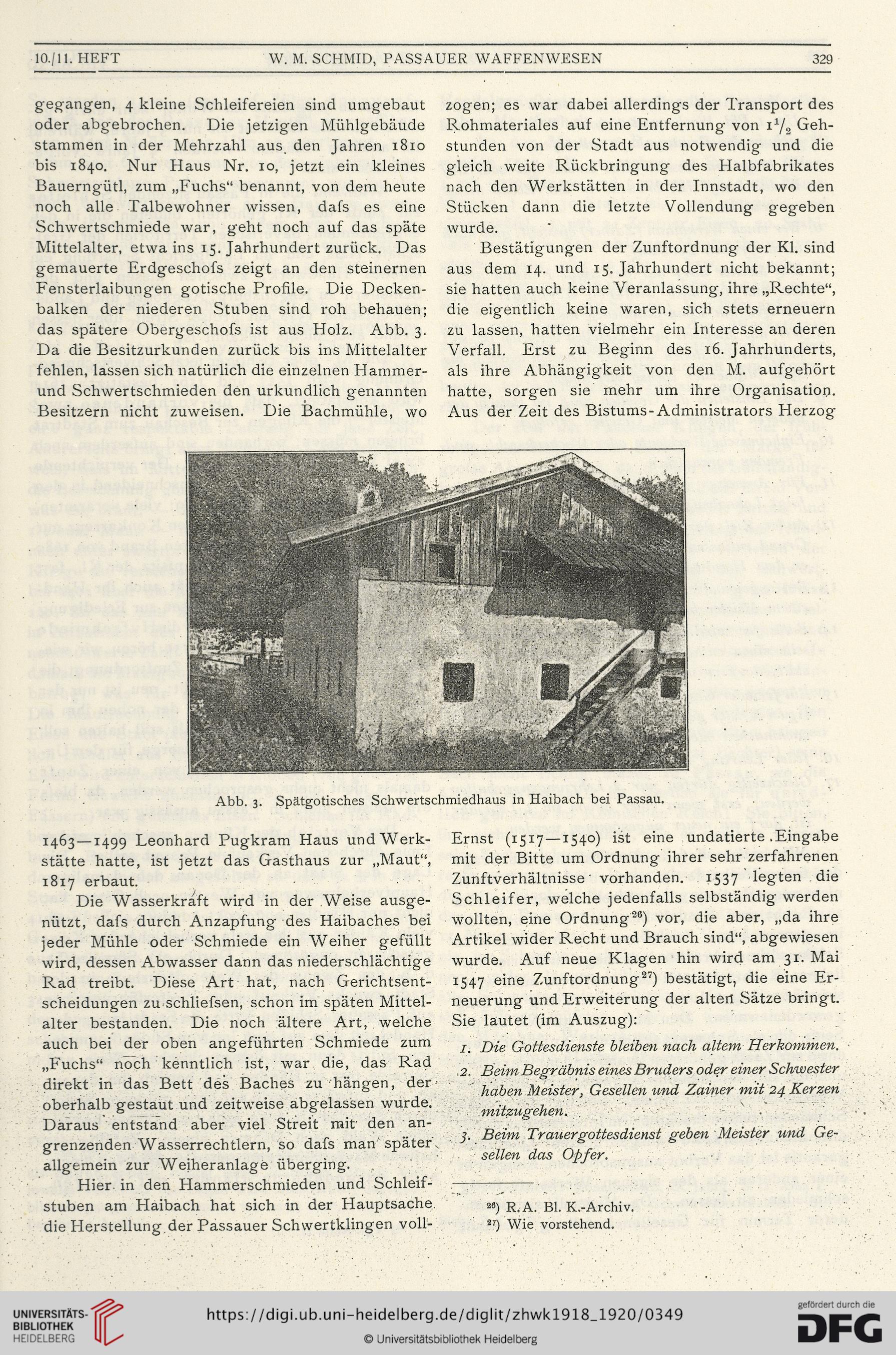10./11. HEFT
W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFEN WESEN
329
gegangen, 4 kleine Schleifereien sind umgebaut
oder abgebrochen. Die jetzigen Mühlgebäude
stammen in der Mehrzahl aus. den Jahren 1810
bis 1840. Nur Haus Nr. 10, jetzt ein kleines
Bauerngütl, zum „Fuchs“ benannt, von dem heute
noch alle Talbewohner wissen, dafs es eine
Schwertschmiede war, geht noch auf das späte
Mittelalter, etwa ins 15. Jahrhundert zurück. Das
gemauerte Erdgeschofs zeigt an den steinernen
Fensterlaibungen gotische Profile. Die Decken-
balken der niederen Stuben sind roh behauen;
das spätere Obergeschofs ist aus Holz. Abb. 3.
Da die Besitzurkunden zurück bis ins Mittelalter
fehlen, lassen sich natürlich die einzelnen Hammer-
und Schwertschmieden den urkundlich genannten
Besitzern nicht zuweisen. Die Bachmühle, wo
zogen; es war dabei allerdings der Transport des
Rohmateriales auf eine Entfernung von 1V2 Geh-
stunden von der Stadt aus notwendig und die
gleich weite Rückbringung des Halbfabrikates
nach den Werkstätten in der Innstadt, wo den
Stücken dann die letzte Vollendung gegeben
wurde.
Bestätigungen der Zunftordnung der Kl. sind
aus dem 14. und 15. Jahrhundert nicht bekannt;
sie hatten auch keine Veranlassung, ihre „Rechte“,
die eigentlich keine waren, sich stets erneuern
zu lassen, hatten vielmehr ein Interesse an deren
Verfall. Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts,
als ihre Abhängigkeit von den M. aufgehört
hatte, sorgen sie mehr um ihre Organisation.
Aus der Zeit des Bistums-Administrators Herzog
Abb. 3. Spätgotisches Schwertschmiedhaus in Haibach bei Passau.
1463—1499 Leonhard Pugkram Haus und Werk-
stätte hatte, ist jetzt das Gasthaus zur „Maut“,
1817 erbaut.
Die Wasserkraft wird in der Weise ausge-
nützt, dafs durch Anzapfung des Haibaches bei
jeder Mühle oder Schmiede ein Weiher gefüllt
wird, dessen Abwasser dann das niederschlächtige
Rad treibt. Diese Art hat, nach Gerichtsent-
scheidungen zu schliefsen, schon im späten Mittel-
alter bestanden. Die noch ältere Art, welche
auch bei der oben angeführten Schmiede zum
„Fuchs“ noch kenntlich ist, war die, das Rad
direkt in das Bett des Baches zu hängen, der<
oberhalb gestaut und zeitweise abgelassen wurde.
Daraus entstand aber viel Streit mit' den an-
grenzenden Wasserrechtlern, so dafs man später
allgemein zur Weiheranlage überging.
Hier, in den Hammerschmieden und Schleif-
stuben am Flaibach hat sich in der Hauptsache
die Herstellung.der Passauer Schwertklingen voll-
Ernst (1517 —154°) ist eine undatierte .Eingabe
mit der Bitte um Ordnung ihrer sehr zerfahrenen
Zunftverhältnisse’ vorhanden. 1537 legten die
Schleifer, welche jedenfalls selbständig werden
wollten, eine Ordnung26) vor, die aber, „da ihre
Artikel wider Recht und Brauch sind“, abgewiesen
wurde. Auf neue Klagen hin wird am 31. Mai
1547 eine Zunftordnung27) bestätigt, die eine Er-
neuerung und Erweiterung der altert Sätze bringt.
Sie lautet (im Auszug):
1. Die Gottesdienste bleiben nach altem Herkommen.
.2. Beim Begräbnis eines Bruders oder einer Schwester
haben Meister, Gesellen ttnd Zainer mit 24 Kerzen
mitzugehen. . ■' •
7. Beim Traziergottesdienst geben Meister und Ge-
sellen das Opfer.
26) R.A. Bl. K.-Archiv.
27) Wie vorstehend.
W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFEN WESEN
329
gegangen, 4 kleine Schleifereien sind umgebaut
oder abgebrochen. Die jetzigen Mühlgebäude
stammen in der Mehrzahl aus. den Jahren 1810
bis 1840. Nur Haus Nr. 10, jetzt ein kleines
Bauerngütl, zum „Fuchs“ benannt, von dem heute
noch alle Talbewohner wissen, dafs es eine
Schwertschmiede war, geht noch auf das späte
Mittelalter, etwa ins 15. Jahrhundert zurück. Das
gemauerte Erdgeschofs zeigt an den steinernen
Fensterlaibungen gotische Profile. Die Decken-
balken der niederen Stuben sind roh behauen;
das spätere Obergeschofs ist aus Holz. Abb. 3.
Da die Besitzurkunden zurück bis ins Mittelalter
fehlen, lassen sich natürlich die einzelnen Hammer-
und Schwertschmieden den urkundlich genannten
Besitzern nicht zuweisen. Die Bachmühle, wo
zogen; es war dabei allerdings der Transport des
Rohmateriales auf eine Entfernung von 1V2 Geh-
stunden von der Stadt aus notwendig und die
gleich weite Rückbringung des Halbfabrikates
nach den Werkstätten in der Innstadt, wo den
Stücken dann die letzte Vollendung gegeben
wurde.
Bestätigungen der Zunftordnung der Kl. sind
aus dem 14. und 15. Jahrhundert nicht bekannt;
sie hatten auch keine Veranlassung, ihre „Rechte“,
die eigentlich keine waren, sich stets erneuern
zu lassen, hatten vielmehr ein Interesse an deren
Verfall. Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts,
als ihre Abhängigkeit von den M. aufgehört
hatte, sorgen sie mehr um ihre Organisation.
Aus der Zeit des Bistums-Administrators Herzog
Abb. 3. Spätgotisches Schwertschmiedhaus in Haibach bei Passau.
1463—1499 Leonhard Pugkram Haus und Werk-
stätte hatte, ist jetzt das Gasthaus zur „Maut“,
1817 erbaut.
Die Wasserkraft wird in der Weise ausge-
nützt, dafs durch Anzapfung des Haibaches bei
jeder Mühle oder Schmiede ein Weiher gefüllt
wird, dessen Abwasser dann das niederschlächtige
Rad treibt. Diese Art hat, nach Gerichtsent-
scheidungen zu schliefsen, schon im späten Mittel-
alter bestanden. Die noch ältere Art, welche
auch bei der oben angeführten Schmiede zum
„Fuchs“ noch kenntlich ist, war die, das Rad
direkt in das Bett des Baches zu hängen, der<
oberhalb gestaut und zeitweise abgelassen wurde.
Daraus entstand aber viel Streit mit' den an-
grenzenden Wasserrechtlern, so dafs man später
allgemein zur Weiheranlage überging.
Hier, in den Hammerschmieden und Schleif-
stuben am Flaibach hat sich in der Hauptsache
die Herstellung.der Passauer Schwertklingen voll-
Ernst (1517 —154°) ist eine undatierte .Eingabe
mit der Bitte um Ordnung ihrer sehr zerfahrenen
Zunftverhältnisse’ vorhanden. 1537 legten die
Schleifer, welche jedenfalls selbständig werden
wollten, eine Ordnung26) vor, die aber, „da ihre
Artikel wider Recht und Brauch sind“, abgewiesen
wurde. Auf neue Klagen hin wird am 31. Mai
1547 eine Zunftordnung27) bestätigt, die eine Er-
neuerung und Erweiterung der altert Sätze bringt.
Sie lautet (im Auszug):
1. Die Gottesdienste bleiben nach altem Herkommen.
.2. Beim Begräbnis eines Bruders oder einer Schwester
haben Meister, Gesellen ttnd Zainer mit 24 Kerzen
mitzugehen. . ■' •
7. Beim Traziergottesdienst geben Meister und Ge-
sellen das Opfer.
26) R.A. Bl. K.-Archiv.
27) Wie vorstehend.