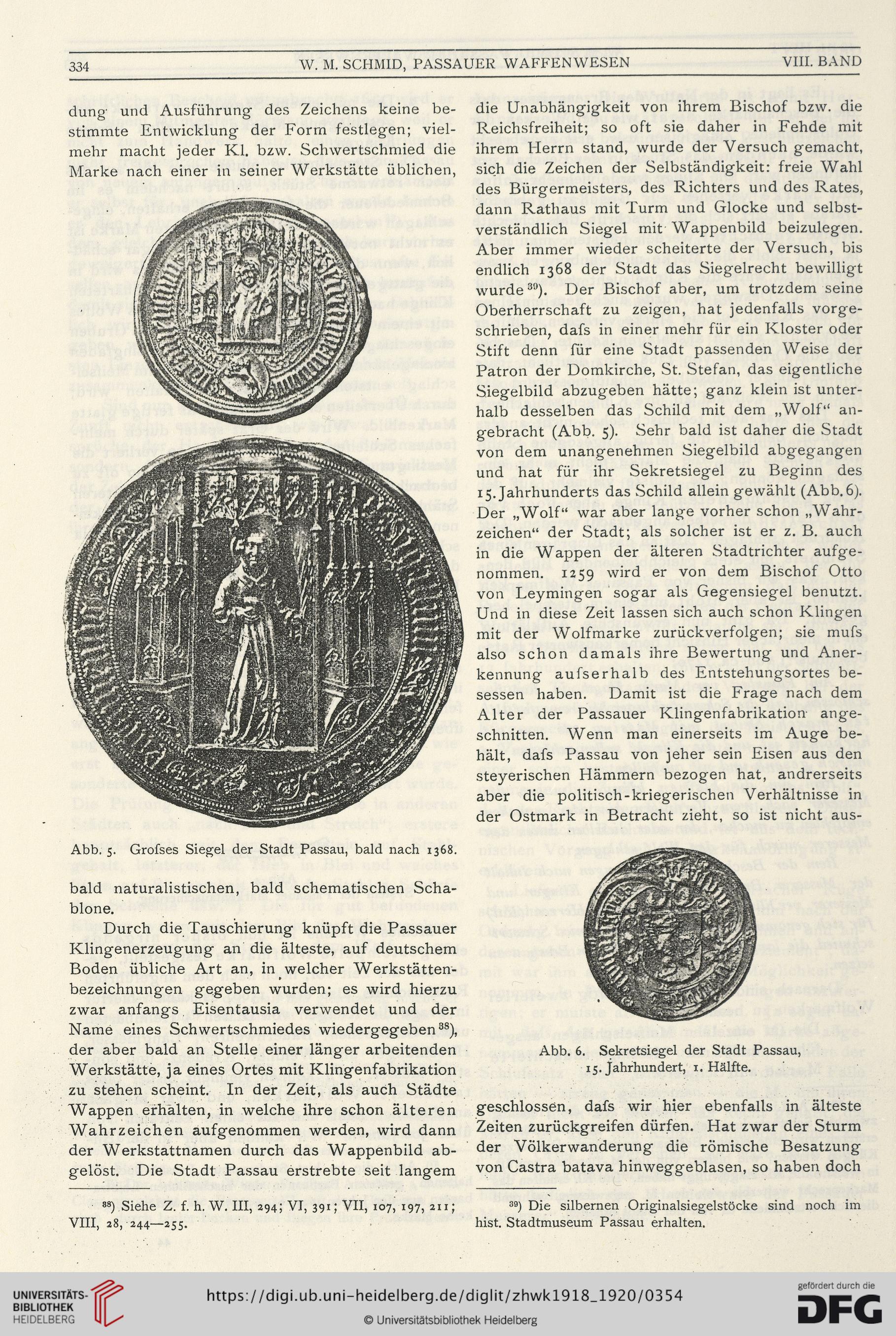334
W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFENWESEN
VIII. BAND
düng' und Ausführung des Zeichens keine be-
stimmte Entwicklung der Form festlegen; viel-
mehr macht jeder Kl. bzw. Schwertschmied die
Marke nach einer in seiner Werkstätte üblichen,
die Unabhängigkeit von ihrem Bischof bzw. die
Reichsfreiheit; so oft sie daher in Fehde mit
ihrem Herrn stand, wurde der Versuch gemacht,
sich die Zeichen der Selbständigkeit: freie Wahl
des Bürgermeisters, des Richters und des Rates,
dann Rathaus mit Turm und Glocke und selbst-
verständlich Siegel mit Wappenbild beizulegen.
Aber immer wieder scheiterte der Versuch, bis
endlich 1368 der Stadt das Siegelrecht bewilligt
wurde30). Der Bischof aber, um trotzdem seine
Oberherrschaft zu zeigen, hat jedenfalls vorge-
schrieben, dafs in einer mehr für ein Kloster oder
Stift denn für eine Stadt passenden Weise der
Patron der Domkirche, St. Stefan, das eigentliche
Siegelbild abzugeben hätte; ganz klein ist unter-
halb desselben das Schild mit dem „Wolf‘‘ an-
gebracht (Abb. 5). Sehr bald ist daher die Stadt
von dem unangenehmen Siegelbild abgegangen
und hat für ihr Sekretsiegel zu Beginn des
15. Jahrhunderts das Schild allein gewählt (Abb. 6).
Der „Wolf“ war aber lange vorher schon „Wahr-
zeichen“ der Stadt; als solcher ist er z. B. auch
in die Wappen der älteren Stadtrichter aufge-
nommen. 1259 wird er von dem Bischof Otto
von Leymingen sogar als Gegensiegel benutzt.
Und in diese Zeit lassen sich auch schon Klingen
mit der Wolfmarke zurückverfolgen; sie mufs
also schon damals ihre Bewertung und Aner-
kennung aufserhalb des Entstehungsortes be-
sessen haben. Damit ist die Frage nach dem
Alter der Passauer Klingenfabrikation- ange-
schnitten. Wenn man einerseits im Auge be-
hält, dafs Passau von jeher sein Eisen aus den
steyerischen Hämmern bezogen hat, andrerseits
aber die politisch-kriegerischen Verhältnisse in
der Ostmark in Betracht zieht, so ist nicht aus-
Abb. 5. Grofses Siegel der Stadt Passau, bald nach 1368.
bald naturalistischen, bald schematischen Scha-
blone.
Durch die Tauschierung knüpft die Passauer
Klingenerzeugung an die älteste, auf deutschem
Boden übliche Art an, in welcher Werkstätten-
bezeichnungen gegeben wurden; es wird hierzu
zwar anfangs Eisentausia verwendet und der
Name eines Schwertschmiedes wiedergegeben38),
der aber bald an Stelle einer länger arbeitenden
Werkstätte, ja eines Ortes mit Klingenfabrikation
zu stehen scheint. In der Zeit, als auch Städte
Wappen erhälten, in welche ihre schon älteren
Wahrzeichen aufgenommen werden, wird dann
der Werkstattnamen durch das Wappenbild ab-
gelöst. Die Stadt Passau erstrebte seit langem
Abb. 6. Sekretsiegel der Stadt Passau,
15. Jahrhundert, 1. Hälfte.
geschlossen, dafs wir hier ebenfalls in älteste
Zeiten zurückgreifen dürfen. Hat zwar der Sturm
der Völkerwanderung die römische Besatzung
von Castra batava hinweggeblasen, so haben doch
88) Siehe Z. f. h. W. III, 294; VI, 391; VII, 107, 197, 211;
VIII, 28, 244—255.
39) Die silbernen Originalsiegelstöcke sind noch im
hist. Stadtmuseum Passau erhalten.
W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFENWESEN
VIII. BAND
düng' und Ausführung des Zeichens keine be-
stimmte Entwicklung der Form festlegen; viel-
mehr macht jeder Kl. bzw. Schwertschmied die
Marke nach einer in seiner Werkstätte üblichen,
die Unabhängigkeit von ihrem Bischof bzw. die
Reichsfreiheit; so oft sie daher in Fehde mit
ihrem Herrn stand, wurde der Versuch gemacht,
sich die Zeichen der Selbständigkeit: freie Wahl
des Bürgermeisters, des Richters und des Rates,
dann Rathaus mit Turm und Glocke und selbst-
verständlich Siegel mit Wappenbild beizulegen.
Aber immer wieder scheiterte der Versuch, bis
endlich 1368 der Stadt das Siegelrecht bewilligt
wurde30). Der Bischof aber, um trotzdem seine
Oberherrschaft zu zeigen, hat jedenfalls vorge-
schrieben, dafs in einer mehr für ein Kloster oder
Stift denn für eine Stadt passenden Weise der
Patron der Domkirche, St. Stefan, das eigentliche
Siegelbild abzugeben hätte; ganz klein ist unter-
halb desselben das Schild mit dem „Wolf‘‘ an-
gebracht (Abb. 5). Sehr bald ist daher die Stadt
von dem unangenehmen Siegelbild abgegangen
und hat für ihr Sekretsiegel zu Beginn des
15. Jahrhunderts das Schild allein gewählt (Abb. 6).
Der „Wolf“ war aber lange vorher schon „Wahr-
zeichen“ der Stadt; als solcher ist er z. B. auch
in die Wappen der älteren Stadtrichter aufge-
nommen. 1259 wird er von dem Bischof Otto
von Leymingen sogar als Gegensiegel benutzt.
Und in diese Zeit lassen sich auch schon Klingen
mit der Wolfmarke zurückverfolgen; sie mufs
also schon damals ihre Bewertung und Aner-
kennung aufserhalb des Entstehungsortes be-
sessen haben. Damit ist die Frage nach dem
Alter der Passauer Klingenfabrikation- ange-
schnitten. Wenn man einerseits im Auge be-
hält, dafs Passau von jeher sein Eisen aus den
steyerischen Hämmern bezogen hat, andrerseits
aber die politisch-kriegerischen Verhältnisse in
der Ostmark in Betracht zieht, so ist nicht aus-
Abb. 5. Grofses Siegel der Stadt Passau, bald nach 1368.
bald naturalistischen, bald schematischen Scha-
blone.
Durch die Tauschierung knüpft die Passauer
Klingenerzeugung an die älteste, auf deutschem
Boden übliche Art an, in welcher Werkstätten-
bezeichnungen gegeben wurden; es wird hierzu
zwar anfangs Eisentausia verwendet und der
Name eines Schwertschmiedes wiedergegeben38),
der aber bald an Stelle einer länger arbeitenden
Werkstätte, ja eines Ortes mit Klingenfabrikation
zu stehen scheint. In der Zeit, als auch Städte
Wappen erhälten, in welche ihre schon älteren
Wahrzeichen aufgenommen werden, wird dann
der Werkstattnamen durch das Wappenbild ab-
gelöst. Die Stadt Passau erstrebte seit langem
Abb. 6. Sekretsiegel der Stadt Passau,
15. Jahrhundert, 1. Hälfte.
geschlossen, dafs wir hier ebenfalls in älteste
Zeiten zurückgreifen dürfen. Hat zwar der Sturm
der Völkerwanderung die römische Besatzung
von Castra batava hinweggeblasen, so haben doch
88) Siehe Z. f. h. W. III, 294; VI, 391; VII, 107, 197, 211;
VIII, 28, 244—255.
39) Die silbernen Originalsiegelstöcke sind noch im
hist. Stadtmuseum Passau erhalten.