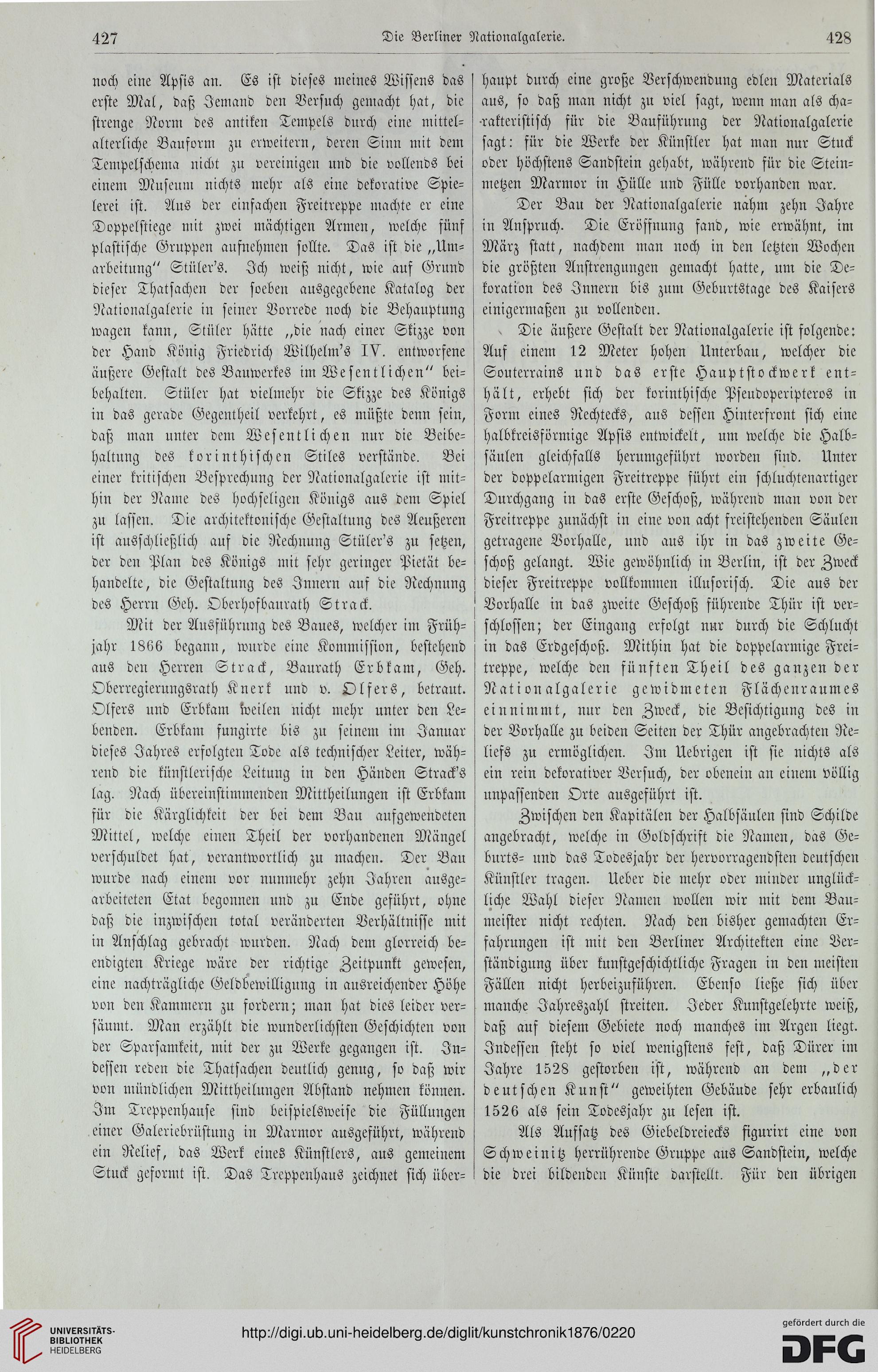427
Die Berliner Nationalgalerie.
428
noch eine Apsis an. Es ist dieses meines Wissens das
erste Mal, daß Jemand den Versuch gemacht hat, die
strenge Norm des antiken Tempels durch eine mittel-
alterliche Bauform zu erweitern, deren Sinn mit dem
Tempelschema nickt zu vereinigen und die vollends bei
einem Museuni nichts mehr als eine dekorative Spie-
lerei ist. Aus der einfachen Freitreppe machte er eine
Doppelstiege mit zwei mächtigen Armen, welche füns
plastische Gruppen aufnehmen sollte. Das ist die „Um-
arbeitung" Stnler's. Jch weiß nicht, wie auf Grund
dieser Thatsachen der soeben ausgegebene Katalog der
Nationalgalerie in seiner Vorrede noch die Behauptnng
wagen kann, Stnler hätte „die nach einer Skizze von
der Hand König Friedrich Wilhelm's IV. entworsene
äußere Gestalt des Bauwerkes im Wesentlichen" bei-
behalten. Stüler hat vielmehr die Skizze des Königs
in das gerade Gegentheil verkehrt, es müßte denn sein,
daß man unter dem Wesentlichen nur die Beibe-
haltung des korinthischen Stiles verstände. Bei
einer kritischen Besprechung der Nationalgalerie ist mit-
hin der Name des hochseligen Königs aus dem Spiel
zu lassen. Die architektonische Gestaltung des Aeußeren
ist ausschließlich aus die Nechnung Stüler's zu setzen,
der den Plan des Königs mit sehr geringer Pietät be-
handelte, die Gestaltung des Jnnern auf die Rechnung
des Herrn Geh. Oberhosbaurath Strack.
Mit der Ausführnng des Baues, welcher im Früh-
jahr 1866 begann, wurde eine Kommission, bestehend
aus den Herren Strack, Baurath Erbkam, Geh.
Oberregierungsrath Knerk und v. Olsers, betraut.
Olfers und Erbkam sveilen nicht mehr unter den Le-
benden. Erbkam fungirte bis zu seinem im Januar
dieses Jahres erfolgten Tode als technischer Leiter, wäh-
rend die künstlerische Leitung in den Händen Strack's
lag. Nach übereinstimmenden Mittheilungen ist Erbkam
für die Kärglichkeit der bei dem Bau aufgewendeten
Mittel, welche einen Theil der vorhandenen Mängel
verschuldet hat, verantwortlich zu machen. Der Ban
wurde nach einem vor nunmehr zehn Jahren ausge-
arbeiteten Etat begonnen und zu Ende geführt, ohne
daß die inzwischen total veränderten Verhältnisse mit
in Anschlag gebracht wurden. Nach dem glorreich be-
endigten Kriege wäre der richtige Zeitpunkt gewesen,
eine nachträgliche Geldbewilligung in ausreichender Höhe
von den Kammern zu fordern; man hat dies leider ver-
säumt. Man erzählt die wunderlichsten Geschichten von
der Sparsamkeit, mit der zu Werke gegangen ist. Jn-
dessen reden die Thatsachen deutlich genug, so daß wir
von mündlichen Mittheilungen Abstand nehmen können.
Jm Treppenhause sind beispielsweise die Füllungen
einer Galeriebrüstung in Marmor ausgeführt, während
ein Relies, das Werk eines Künstlers, aus gemeinem
Stuck geformt ist. Das Treppenhaus zeichnet sich über-
haupt durch eine große Verschwendung edlen Materials
aus, so daß man nicht zu viel sagt, wenn man als cha-
-rakteristisch sür die Bauführung der Nationalgalerie
sagt: für die Werke der Künstler hat man nur Stuck
oder höchstens Sandstein gehabt, während für die Stein-
metzen Marmor in Hülle und Fülle vorhanden war.
Der Bau der Nationalgalerie nahm zehn Jahre
in Anspruch. Die Eröfsnung sand, wie erwähnt, im
März statt, nachdem man noch in den letzten Wochen
die größten Anstrengungen gemacht hatte, um die De-
koration des Jnnern bis zum Geburtstage des Kaisers
einigermaßen zu vollenden.
. Die äußere Gestalt der Nationalgalerie ist folgende:
Auf einem 12 Meter hohen Unterbau, welcher die
Souterrains und das erste Hauptsto ckwerk ent-
hält, erhebt sich der korinthische Pseudoperipteros in
Form eines Rechtecks, aus dessen Hinterfront sich eine
halbkreisförmige Apsis entwickelt, um welche die Halb-
säulen gleichfalls herumgeführt worden sind. Unter
der doppelarmigen Freitreppe führt ein schlnchtenartiger
Durchgang in das erste Geschoß, während man von der
Freitreppe zunächst in eine von acht freistehenden Säulen
getragene Vorhalle, und aus ihr in das zweite Ge-
schoß gelangt. Wie gewöhnlich in Berlin, ist der Zweck
dieser Freitreppe vollkommen illusorisch. Die aus der
^ Vorhalle in das zweite Geschoß führende Thür ist ver-
schlossen; der Eingang erfolgt nur durch die Schlucht
in das Erdgeschoß. Mithin hat die doppelarmige Frei-
treppe, welche den fünsten Theil des ganzen der
Nati on algalerie gewidmeten Flächenraumes
einnimmt, nur den Zweck, die Besichtigung des in
der Vorhalle zu beiden Seiten der Thür angebrachten Re-
liefs zu ermöglichen. Jm Uebrigen ist sie nichts als
ein rein dekorativer Versuch, der obenein an einem völlig
unpassenden Orte ausgesührt ist.
Zwischen den Kapitälen der Halbsäulen sind Schilde
angebracht, welche in Goldschrift die Namen, das Ge-
burts- nnd das Todesjahr der hervorragendsten deutschen
Künstler tragen. Ueber die mehr oder minder unglück-
liche Wahl dieser Namen wollen wir mit dem Bau-
meister nicht rechten. Nach den bisher gemachten Er-
fahrungen ist mit den Berliner Architekten eine Ver-
ständigung über kunstgeschichtliche Fragen in den meisten
Fällen nicht herbeizusühren. Ebenso ließe sich über
manche Jahreszahl streiten. Jeder Kunstgelehrte weiß,
daß auf diesem Gebiete noch manches im Argen liegt.
Jndessen steht so viel wenigstens sest, daß Dürer im
Iahre 1528 gestorben ist, während an dem „der
deutschen Kunst" geweihten Gebäude sehr erbaulich
1526 als sein Todesjahr zu lesen ist.
Als Aussatz des Giebeldreiecks figurirt eine von
Schweinitz herrührende Gruppe aus Sandstein, welche
die drei bildenden Künste darstelü. Für den übrigen
Die Berliner Nationalgalerie.
428
noch eine Apsis an. Es ist dieses meines Wissens das
erste Mal, daß Jemand den Versuch gemacht hat, die
strenge Norm des antiken Tempels durch eine mittel-
alterliche Bauform zu erweitern, deren Sinn mit dem
Tempelschema nickt zu vereinigen und die vollends bei
einem Museuni nichts mehr als eine dekorative Spie-
lerei ist. Aus der einfachen Freitreppe machte er eine
Doppelstiege mit zwei mächtigen Armen, welche füns
plastische Gruppen aufnehmen sollte. Das ist die „Um-
arbeitung" Stnler's. Jch weiß nicht, wie auf Grund
dieser Thatsachen der soeben ausgegebene Katalog der
Nationalgalerie in seiner Vorrede noch die Behauptnng
wagen kann, Stnler hätte „die nach einer Skizze von
der Hand König Friedrich Wilhelm's IV. entworsene
äußere Gestalt des Bauwerkes im Wesentlichen" bei-
behalten. Stüler hat vielmehr die Skizze des Königs
in das gerade Gegentheil verkehrt, es müßte denn sein,
daß man unter dem Wesentlichen nur die Beibe-
haltung des korinthischen Stiles verstände. Bei
einer kritischen Besprechung der Nationalgalerie ist mit-
hin der Name des hochseligen Königs aus dem Spiel
zu lassen. Die architektonische Gestaltung des Aeußeren
ist ausschließlich aus die Nechnung Stüler's zu setzen,
der den Plan des Königs mit sehr geringer Pietät be-
handelte, die Gestaltung des Jnnern auf die Rechnung
des Herrn Geh. Oberhosbaurath Strack.
Mit der Ausführnng des Baues, welcher im Früh-
jahr 1866 begann, wurde eine Kommission, bestehend
aus den Herren Strack, Baurath Erbkam, Geh.
Oberregierungsrath Knerk und v. Olsers, betraut.
Olfers und Erbkam sveilen nicht mehr unter den Le-
benden. Erbkam fungirte bis zu seinem im Januar
dieses Jahres erfolgten Tode als technischer Leiter, wäh-
rend die künstlerische Leitung in den Händen Strack's
lag. Nach übereinstimmenden Mittheilungen ist Erbkam
für die Kärglichkeit der bei dem Bau aufgewendeten
Mittel, welche einen Theil der vorhandenen Mängel
verschuldet hat, verantwortlich zu machen. Der Ban
wurde nach einem vor nunmehr zehn Jahren ausge-
arbeiteten Etat begonnen und zu Ende geführt, ohne
daß die inzwischen total veränderten Verhältnisse mit
in Anschlag gebracht wurden. Nach dem glorreich be-
endigten Kriege wäre der richtige Zeitpunkt gewesen,
eine nachträgliche Geldbewilligung in ausreichender Höhe
von den Kammern zu fordern; man hat dies leider ver-
säumt. Man erzählt die wunderlichsten Geschichten von
der Sparsamkeit, mit der zu Werke gegangen ist. Jn-
dessen reden die Thatsachen deutlich genug, so daß wir
von mündlichen Mittheilungen Abstand nehmen können.
Jm Treppenhause sind beispielsweise die Füllungen
einer Galeriebrüstung in Marmor ausgeführt, während
ein Relies, das Werk eines Künstlers, aus gemeinem
Stuck geformt ist. Das Treppenhaus zeichnet sich über-
haupt durch eine große Verschwendung edlen Materials
aus, so daß man nicht zu viel sagt, wenn man als cha-
-rakteristisch sür die Bauführung der Nationalgalerie
sagt: für die Werke der Künstler hat man nur Stuck
oder höchstens Sandstein gehabt, während für die Stein-
metzen Marmor in Hülle und Fülle vorhanden war.
Der Bau der Nationalgalerie nahm zehn Jahre
in Anspruch. Die Eröfsnung sand, wie erwähnt, im
März statt, nachdem man noch in den letzten Wochen
die größten Anstrengungen gemacht hatte, um die De-
koration des Jnnern bis zum Geburtstage des Kaisers
einigermaßen zu vollenden.
. Die äußere Gestalt der Nationalgalerie ist folgende:
Auf einem 12 Meter hohen Unterbau, welcher die
Souterrains und das erste Hauptsto ckwerk ent-
hält, erhebt sich der korinthische Pseudoperipteros in
Form eines Rechtecks, aus dessen Hinterfront sich eine
halbkreisförmige Apsis entwickelt, um welche die Halb-
säulen gleichfalls herumgeführt worden sind. Unter
der doppelarmigen Freitreppe führt ein schlnchtenartiger
Durchgang in das erste Geschoß, während man von der
Freitreppe zunächst in eine von acht freistehenden Säulen
getragene Vorhalle, und aus ihr in das zweite Ge-
schoß gelangt. Wie gewöhnlich in Berlin, ist der Zweck
dieser Freitreppe vollkommen illusorisch. Die aus der
^ Vorhalle in das zweite Geschoß führende Thür ist ver-
schlossen; der Eingang erfolgt nur durch die Schlucht
in das Erdgeschoß. Mithin hat die doppelarmige Frei-
treppe, welche den fünsten Theil des ganzen der
Nati on algalerie gewidmeten Flächenraumes
einnimmt, nur den Zweck, die Besichtigung des in
der Vorhalle zu beiden Seiten der Thür angebrachten Re-
liefs zu ermöglichen. Jm Uebrigen ist sie nichts als
ein rein dekorativer Versuch, der obenein an einem völlig
unpassenden Orte ausgesührt ist.
Zwischen den Kapitälen der Halbsäulen sind Schilde
angebracht, welche in Goldschrift die Namen, das Ge-
burts- nnd das Todesjahr der hervorragendsten deutschen
Künstler tragen. Ueber die mehr oder minder unglück-
liche Wahl dieser Namen wollen wir mit dem Bau-
meister nicht rechten. Nach den bisher gemachten Er-
fahrungen ist mit den Berliner Architekten eine Ver-
ständigung über kunstgeschichtliche Fragen in den meisten
Fällen nicht herbeizusühren. Ebenso ließe sich über
manche Jahreszahl streiten. Jeder Kunstgelehrte weiß,
daß auf diesem Gebiete noch manches im Argen liegt.
Jndessen steht so viel wenigstens sest, daß Dürer im
Iahre 1528 gestorben ist, während an dem „der
deutschen Kunst" geweihten Gebäude sehr erbaulich
1526 als sein Todesjahr zu lesen ist.
Als Aussatz des Giebeldreiecks figurirt eine von
Schweinitz herrührende Gruppe aus Sandstein, welche
die drei bildenden Künste darstelü. Für den übrigen