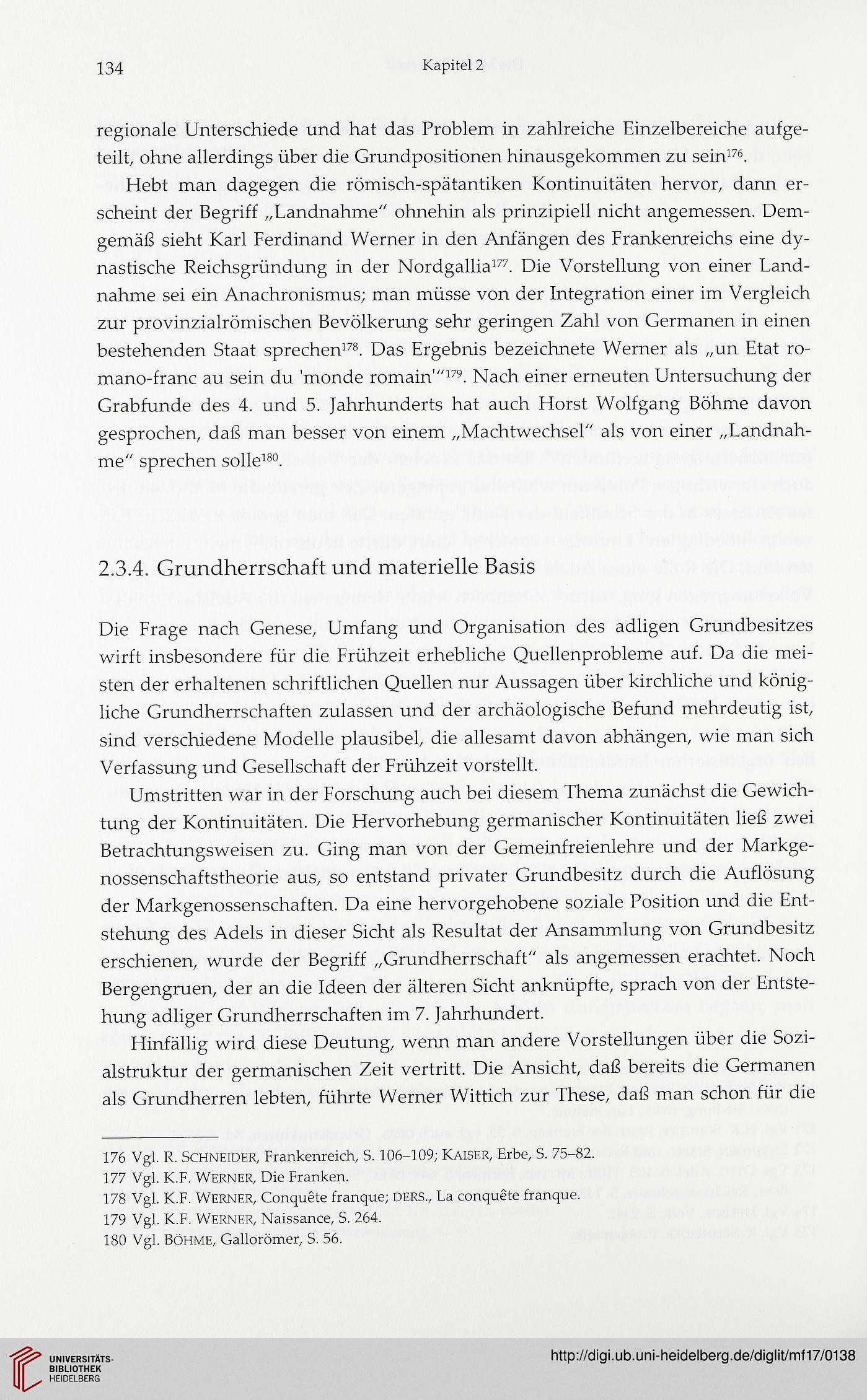134
Kapitel 2
regionale Unterschiede und hat das Problem in zahlreiche Einzelbereiche aufge-
teilt, ohne allerdings über die Grundpositionen hinausgekommen zu seinW
Hebt man dagegen die römisch-spätantiken Kontinuitäten hervor, dann er-
scheint der Begriff „Landnahme" ohnehin als prinzipiell nicht angemessen. Dem-
gemäß sieht Karl Ferdinand Werner in den Anfängen des Frankenreichs eine dy-
nastische Reichsgründung in der NordgalliaW Die Vorstellung von einer Land-
nahme sei ein Anachronismus; man müsse von der Integration einer im Vergleich
zur provinzialrömischen Bevölkerung sehr geringen Zahl von Germanen in einen
bestehenden Staat sprechen^. Das Ergebnis bezeichnete Werner als „un Etat ro-
mano-franc au sein du monde romain'"^^. Nach einer erneuten Untersuchung der
Grabfunde des 4. und 5. Jahrhunderts hat auch Horst Wolfgang Böhme davon
gesprochen, daß man besser von einem „Machtwechsel" als von einer „Landnah-
me" sprechen sollet.
2.3.4. Grundherrschaft und materielle Basis
Die Frage nach Genese, Umfang und Organisation des adligen Grundbesitzes
wirft insbesondere für die Frühzeit erhebliche Quellenprobleme auf. Da die mei-
sten der erhaltenen schriftlichen Quellen nur Aussagen über kirchliche und könig-
liche Grundherrschaften zulassen und der archäologische Befund mehrdeutig ist,
sind verschiedene Modelle plausibel, die allesamt davon abhängen, wie man sich
Verfassung und Gesellschaft der Frühzeit vorstellt.
Umstritten war in der Forschung auch bei diesem Thema zunächst die Gewich-
tung der Kontinuitäten. Die Hervorhebung germanischer Kontinuitäten ließ zwei
Betrachtungsweisen zu. Ging man von der Gemeinfreienlehre und der Markge-
nossenschaftstheorie aus, so entstand privater Grundbesitz durch die Auflösung
der Markgenossenschaften. Da eine hervorgehobene soziale Position und die Ent-
stehung des Adels in dieser Sicht als Resultat der Ansammlung von Grundbesitz
erschienen, wurde der Begriff „Grundherrschaft" als angemessen erachtet. Noch
Bergengruen, der an die Ideen der älteren Sicht anknüpfte, sprach von der Entste-
hung adliger Grundherrschaften im 7. Jahrhundert.
Hinfällig wird diese Deutung, wenn man andere Vorstellungen über die Sozi-
alstruktur der germanischen Zeit vertritt. Die Ansicht, daß bereits die Germanen
als Grundherren lebten, führte Werner Wittich zur These, daß man schon für die
176 Vgl. R. SCHNEIDER, Frankenreich, S. 106-109; KAISER, Erbe, S. 75-82.
177 Vgl. K.F. WERNER, Die Franken.
178 Vgl. K.F. WERNER, Conquete franque; DERS., La conquete franque.
179 Vgl. K.F. WERNER, Naissance, S. 264.
180 Vgl. BÖHME, Gallorömer, S. 56.
Kapitel 2
regionale Unterschiede und hat das Problem in zahlreiche Einzelbereiche aufge-
teilt, ohne allerdings über die Grundpositionen hinausgekommen zu seinW
Hebt man dagegen die römisch-spätantiken Kontinuitäten hervor, dann er-
scheint der Begriff „Landnahme" ohnehin als prinzipiell nicht angemessen. Dem-
gemäß sieht Karl Ferdinand Werner in den Anfängen des Frankenreichs eine dy-
nastische Reichsgründung in der NordgalliaW Die Vorstellung von einer Land-
nahme sei ein Anachronismus; man müsse von der Integration einer im Vergleich
zur provinzialrömischen Bevölkerung sehr geringen Zahl von Germanen in einen
bestehenden Staat sprechen^. Das Ergebnis bezeichnete Werner als „un Etat ro-
mano-franc au sein du monde romain'"^^. Nach einer erneuten Untersuchung der
Grabfunde des 4. und 5. Jahrhunderts hat auch Horst Wolfgang Böhme davon
gesprochen, daß man besser von einem „Machtwechsel" als von einer „Landnah-
me" sprechen sollet.
2.3.4. Grundherrschaft und materielle Basis
Die Frage nach Genese, Umfang und Organisation des adligen Grundbesitzes
wirft insbesondere für die Frühzeit erhebliche Quellenprobleme auf. Da die mei-
sten der erhaltenen schriftlichen Quellen nur Aussagen über kirchliche und könig-
liche Grundherrschaften zulassen und der archäologische Befund mehrdeutig ist,
sind verschiedene Modelle plausibel, die allesamt davon abhängen, wie man sich
Verfassung und Gesellschaft der Frühzeit vorstellt.
Umstritten war in der Forschung auch bei diesem Thema zunächst die Gewich-
tung der Kontinuitäten. Die Hervorhebung germanischer Kontinuitäten ließ zwei
Betrachtungsweisen zu. Ging man von der Gemeinfreienlehre und der Markge-
nossenschaftstheorie aus, so entstand privater Grundbesitz durch die Auflösung
der Markgenossenschaften. Da eine hervorgehobene soziale Position und die Ent-
stehung des Adels in dieser Sicht als Resultat der Ansammlung von Grundbesitz
erschienen, wurde der Begriff „Grundherrschaft" als angemessen erachtet. Noch
Bergengruen, der an die Ideen der älteren Sicht anknüpfte, sprach von der Entste-
hung adliger Grundherrschaften im 7. Jahrhundert.
Hinfällig wird diese Deutung, wenn man andere Vorstellungen über die Sozi-
alstruktur der germanischen Zeit vertritt. Die Ansicht, daß bereits die Germanen
als Grundherren lebten, führte Werner Wittich zur These, daß man schon für die
176 Vgl. R. SCHNEIDER, Frankenreich, S. 106-109; KAISER, Erbe, S. 75-82.
177 Vgl. K.F. WERNER, Die Franken.
178 Vgl. K.F. WERNER, Conquete franque; DERS., La conquete franque.
179 Vgl. K.F. WERNER, Naissance, S. 264.
180 Vgl. BÖHME, Gallorömer, S. 56.