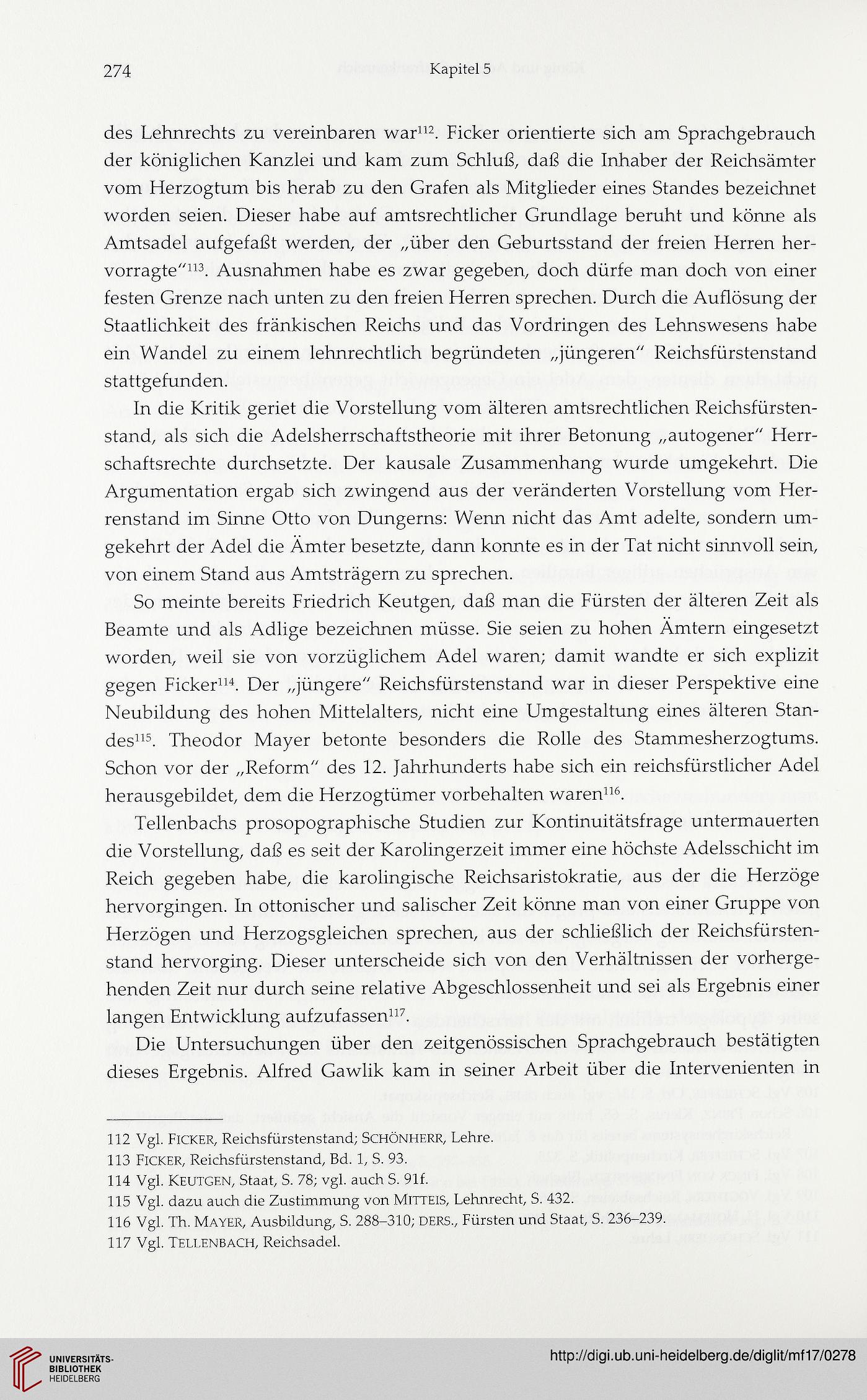274
Kapitel 5
des Lehnrechts zu vereinbaren wahA Ficker orientierte sich am Sprachgebrauch
der königiichen Kanzlei und kam zum Schluß, daß die Inhaber der Reichsämter
vom Herzogtum bis herab zu den Grafen als Mitglieder eines Standes bezeichnet
worden seien. Dieser habe auf amtsrechtlicher Grundlage beruht und könne als
Amtsadel aufgefaßt werden, der „über den Geburtsstand der freien Herren her-
vorragte"n3. Ausnahmen habe es zwar gegeben, doch dürfe man doch von einer
festen Grenze nach unten zu den freien Herren sprechen. Durch die Auflösung der
Staatlichkeit des fränkischen Reichs und das Vordringen des Lehnswesens habe
ein Wandel zu einem lehnrechtlich begründeten „jüngeren" Reichsfürstenstand
stattgefunden.
In die Kritik geriet die Vorstellung vom älteren amtsrechtlichen Reichsfürsten-
stand, als sich die Adelsherrschaftstheorie mit ihrer Betonung „autogener" Herr-
schaftsrechte durchsetzte. Der kausale Zusammenhang wurde umgekehrt. Die
Argumentation ergab sich zwingend aus der veränderten Vorstellung vom Her-
renstand im Sinne Otto von Dungerns: Wenn nicht das Amt adelte, sondern um-
gekehrt der Adel die Ämter besetzte, dann konnte es in der Tat nicht sinnvoll sein,
von einem Stand aus Amtsträgern zu sprechen.
So meinte bereits Friedrich Keutgen, daß man die Fürsten der älteren Zeit als
Beamte und als Adlige bezeichnen müsse. Sie seien zu hohen Ämtern eingesetzt
worden, weil sie von vorzüglichem Adel waren; damit wandte er sich explizit
gegen Ficker"E Der „jüngere" Reichsfürstenstand war in dieser Perspektive eine
Neubildung des hohen Mittelalters, nicht eine Umgestaltung eines älteren Stan-
des^. Theodor Mayer betonte besonders die Rolle des Stammesherzogtums.
Schon vor der „Reform" des 12. Jahrhunderts habe sich ein reichsfürstlicher Adel
herausgebildet, dem die Herzogtümer Vorbehalten wareNA
Tellenbachs prosopographische Studien zur Kontinuitätsfrage untermauerten
die Vorstellung, daß es seit der Karolingerzeit immer eine höchste Adelsschicht im
Reich gegeben habe, die karolingische Reichsaristokratie, aus der die Herzoge
hervorgingen. In ottonischer und salischer Zeit könne man von einer Gruppe von
Herzogen und Herzogsgleichen sprechen, aus der schließlich der Reichsfürsten-
stand hervorging. Dieser unterscheide sich von den Verhältnissen der vorherge-
henden Zeit nur durch seine relative Abgeschlossenheit und sei als Ergebnis einer
langen Entwicklung aufzufasseNA
Die Untersuchungen über den zeitgenössischen Sprachgebrauch bestätigten
dieses Ergebnis. Alfred Gawlik kam in seiner Arbeit über die Intervenienten in
112 Vgl. FICKER, Reichsfürstenstand; SCHÖNHERR, Lehre.
113 FICKER, Reichsfürstenstand, Bd. 1, S. 93.
114 Vgl. KEUTGEN, Staat, S. 78; vgl. auch S. 91f.
115 Vgl. dazu auch die Zustimmung von MlTTElS, Lehnrecht, S. 432.
116 Vgl. Th. MAYER, Ausbildung, S. 288-310; DERS., Fürsten und Staat, S. 236-239.
117 Vgl. TELLENBACH, Reichsadel.
Kapitel 5
des Lehnrechts zu vereinbaren wahA Ficker orientierte sich am Sprachgebrauch
der königiichen Kanzlei und kam zum Schluß, daß die Inhaber der Reichsämter
vom Herzogtum bis herab zu den Grafen als Mitglieder eines Standes bezeichnet
worden seien. Dieser habe auf amtsrechtlicher Grundlage beruht und könne als
Amtsadel aufgefaßt werden, der „über den Geburtsstand der freien Herren her-
vorragte"n3. Ausnahmen habe es zwar gegeben, doch dürfe man doch von einer
festen Grenze nach unten zu den freien Herren sprechen. Durch die Auflösung der
Staatlichkeit des fränkischen Reichs und das Vordringen des Lehnswesens habe
ein Wandel zu einem lehnrechtlich begründeten „jüngeren" Reichsfürstenstand
stattgefunden.
In die Kritik geriet die Vorstellung vom älteren amtsrechtlichen Reichsfürsten-
stand, als sich die Adelsherrschaftstheorie mit ihrer Betonung „autogener" Herr-
schaftsrechte durchsetzte. Der kausale Zusammenhang wurde umgekehrt. Die
Argumentation ergab sich zwingend aus der veränderten Vorstellung vom Her-
renstand im Sinne Otto von Dungerns: Wenn nicht das Amt adelte, sondern um-
gekehrt der Adel die Ämter besetzte, dann konnte es in der Tat nicht sinnvoll sein,
von einem Stand aus Amtsträgern zu sprechen.
So meinte bereits Friedrich Keutgen, daß man die Fürsten der älteren Zeit als
Beamte und als Adlige bezeichnen müsse. Sie seien zu hohen Ämtern eingesetzt
worden, weil sie von vorzüglichem Adel waren; damit wandte er sich explizit
gegen Ficker"E Der „jüngere" Reichsfürstenstand war in dieser Perspektive eine
Neubildung des hohen Mittelalters, nicht eine Umgestaltung eines älteren Stan-
des^. Theodor Mayer betonte besonders die Rolle des Stammesherzogtums.
Schon vor der „Reform" des 12. Jahrhunderts habe sich ein reichsfürstlicher Adel
herausgebildet, dem die Herzogtümer Vorbehalten wareNA
Tellenbachs prosopographische Studien zur Kontinuitätsfrage untermauerten
die Vorstellung, daß es seit der Karolingerzeit immer eine höchste Adelsschicht im
Reich gegeben habe, die karolingische Reichsaristokratie, aus der die Herzoge
hervorgingen. In ottonischer und salischer Zeit könne man von einer Gruppe von
Herzogen und Herzogsgleichen sprechen, aus der schließlich der Reichsfürsten-
stand hervorging. Dieser unterscheide sich von den Verhältnissen der vorherge-
henden Zeit nur durch seine relative Abgeschlossenheit und sei als Ergebnis einer
langen Entwicklung aufzufasseNA
Die Untersuchungen über den zeitgenössischen Sprachgebrauch bestätigten
dieses Ergebnis. Alfred Gawlik kam in seiner Arbeit über die Intervenienten in
112 Vgl. FICKER, Reichsfürstenstand; SCHÖNHERR, Lehre.
113 FICKER, Reichsfürstenstand, Bd. 1, S. 93.
114 Vgl. KEUTGEN, Staat, S. 78; vgl. auch S. 91f.
115 Vgl. dazu auch die Zustimmung von MlTTElS, Lehnrecht, S. 432.
116 Vgl. Th. MAYER, Ausbildung, S. 288-310; DERS., Fürsten und Staat, S. 236-239.
117 Vgl. TELLENBACH, Reichsadel.