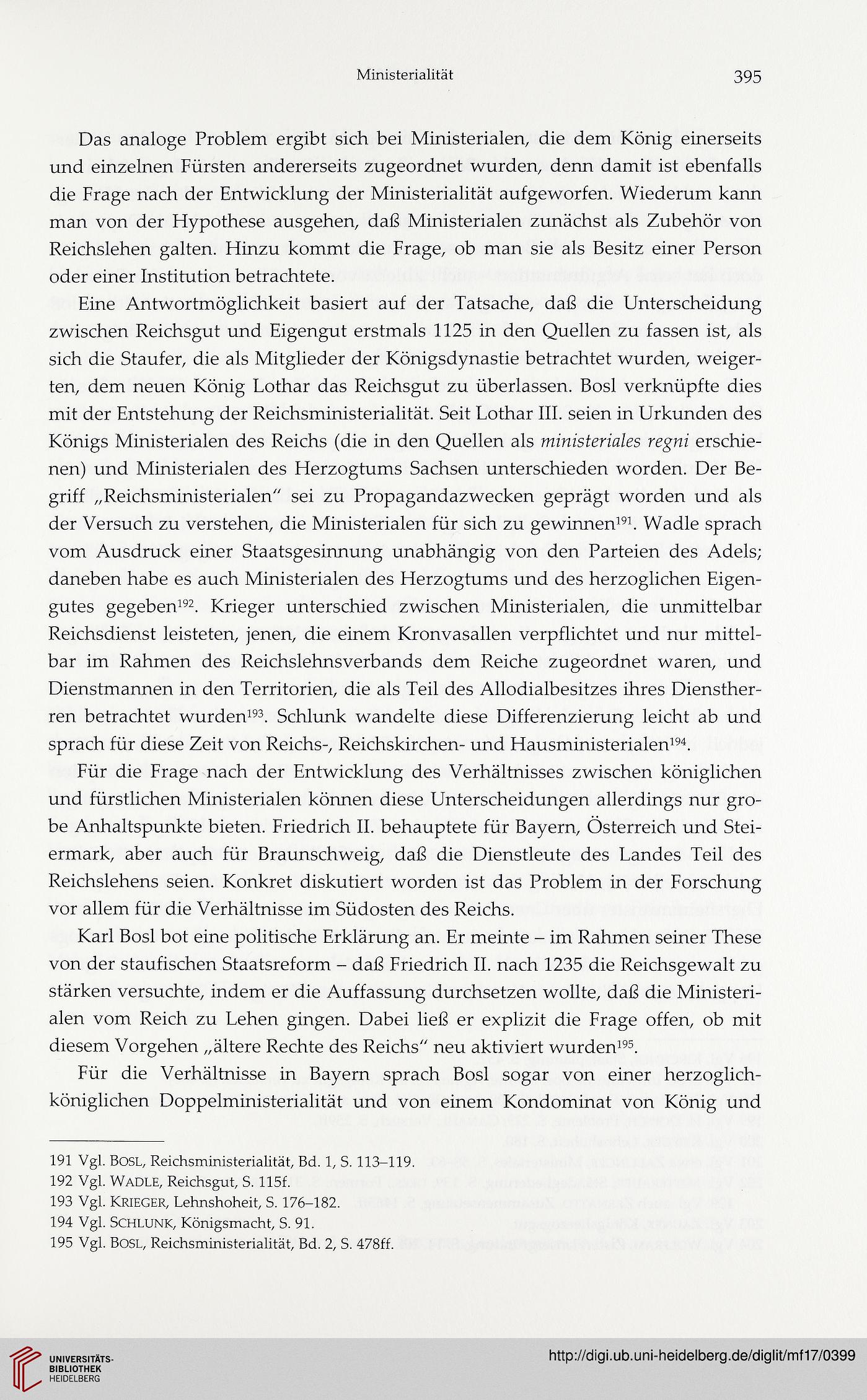Mmisterialität
395
Das analoge Problem ergibt sich bei Ministerialen, die dem König einerseits
und einzelnen Fürsten andererseits zugeordnet wurden, denn damit ist ebenfalls
die Frage nach der Entwicklung der Mmisterialität aufgeworfen. Wiederum kann
man von der Hypothese ausgehen, daß Ministerialen zunächst als Zubehör von
Reichslehen galten. Hinzu kommt die Frage, ob man sie als Besitz einer Person
oder einer Institution betrachtete.
Eine Antwortmöglichkeit basiert auf der Tatsache, daß die Unterscheidung
zwischen Reichsgut und Eigengut erstmals 1125 in den Quellen zu fassen ist, als
sich die Staufer, die als Mitglieder der Königsdynastie betrachtet wurden, weiger-
ten, dem neuen König Lothar das Reichsgut zu überlassen. Bosl verknüpfte dies
mit der Entstehung der Reichsministerialität. Seit Lothar III. seien in Urkunden des
Königs Ministerialen des Reichs (die in den Quellen als Ttzmz'sUrMlcs mynz erschie-
nen) und Ministerialen des Herzogtums Sachsen unterschieden worden. Der Be-
griff „Reichsministerialen" sei zu Propagandazwecken geprägt worden und als
der Versuch zu verstehen, die Ministerialen für sich zu gewinnen^. Wadle sprach
vom Ausdruck einer Staatsgesinnung unabhängig von den Parteien des Adels;
daneben habe es auch Ministerialen des Herzogtums und des herzoglichen Eigen-
gutes gegeben*^. Krieger unterschied zwischen Ministerialen, die unmittelbar
Reichsdienst leisteten, jenen, die einem Kronvasallen verpflichtet und nur mittel-
bar im Rahmen des Reichslehnsverbands dem Reiche zugeordnet waren, und
Dienstmannen in den Territorien, die als Teil des Allodialbesitzes ihres Diensther-
ren betrachtet wurdenW Schiunk wandelte diese Differenzierung leicht ab und
sprach für diese Zeit von Reichs-, Reichskirchen- und Hausministerialen^y
Für die Frage nach der Entwicklung des Verhältnisses zwischen königlichen
und fürstlichen Ministerialen können diese Unterscheidungen allerdings nur gro-
be Anhaltspunkte bieten. Friedrich II. behauptete für Bayern, Österreich und Stei-
ermark, aber auch für Braunschweig, daß die Dienstleute des Landes Teil des
Reichslehens seien. Konkret diskutiert worden ist das Problem in der Forschung
vor allem für die Verhältnisse im Südosten des Reichs.
Karl Bosl bot eine politische Erklärung an. Er meinte - im Rahmen seiner These
von der staufischen Staatsreform - daß Friedrich II. nach 1235 die Reichsgewalt zu
stärken versuchte, indem er die Auffassung durchsetzen wollte, daß die Ministeri-
alen vom Reich zu Lehen gingen. Dabei ließ er explizit die Frage offen, ob mit
diesem Vorgehen „ältere Rechte des Reichs" neu aktiviert wurdenW
Für die Verhältnisse in Bayern sprach Bosl sogar von einer herzoglich-
königlichen Doppelministerialität und von einem Kondominat von König und
191 Vgl. BOSL, Reichsministerialität, Bd. 1, S. 113-119.
192 Vgl. WADLE, Reichsgut, S. 115f.
193 Vgl. KRIEGER, Lehnshoheit, S. 176-182.
194 Vgl. SCHLUNK, Königsmacht, S. 91.
195 Vgl. BOSL, Reichsministerialität, Bd. 2, S. 478ff.
395
Das analoge Problem ergibt sich bei Ministerialen, die dem König einerseits
und einzelnen Fürsten andererseits zugeordnet wurden, denn damit ist ebenfalls
die Frage nach der Entwicklung der Mmisterialität aufgeworfen. Wiederum kann
man von der Hypothese ausgehen, daß Ministerialen zunächst als Zubehör von
Reichslehen galten. Hinzu kommt die Frage, ob man sie als Besitz einer Person
oder einer Institution betrachtete.
Eine Antwortmöglichkeit basiert auf der Tatsache, daß die Unterscheidung
zwischen Reichsgut und Eigengut erstmals 1125 in den Quellen zu fassen ist, als
sich die Staufer, die als Mitglieder der Königsdynastie betrachtet wurden, weiger-
ten, dem neuen König Lothar das Reichsgut zu überlassen. Bosl verknüpfte dies
mit der Entstehung der Reichsministerialität. Seit Lothar III. seien in Urkunden des
Königs Ministerialen des Reichs (die in den Quellen als Ttzmz'sUrMlcs mynz erschie-
nen) und Ministerialen des Herzogtums Sachsen unterschieden worden. Der Be-
griff „Reichsministerialen" sei zu Propagandazwecken geprägt worden und als
der Versuch zu verstehen, die Ministerialen für sich zu gewinnen^. Wadle sprach
vom Ausdruck einer Staatsgesinnung unabhängig von den Parteien des Adels;
daneben habe es auch Ministerialen des Herzogtums und des herzoglichen Eigen-
gutes gegeben*^. Krieger unterschied zwischen Ministerialen, die unmittelbar
Reichsdienst leisteten, jenen, die einem Kronvasallen verpflichtet und nur mittel-
bar im Rahmen des Reichslehnsverbands dem Reiche zugeordnet waren, und
Dienstmannen in den Territorien, die als Teil des Allodialbesitzes ihres Diensther-
ren betrachtet wurdenW Schiunk wandelte diese Differenzierung leicht ab und
sprach für diese Zeit von Reichs-, Reichskirchen- und Hausministerialen^y
Für die Frage nach der Entwicklung des Verhältnisses zwischen königlichen
und fürstlichen Ministerialen können diese Unterscheidungen allerdings nur gro-
be Anhaltspunkte bieten. Friedrich II. behauptete für Bayern, Österreich und Stei-
ermark, aber auch für Braunschweig, daß die Dienstleute des Landes Teil des
Reichslehens seien. Konkret diskutiert worden ist das Problem in der Forschung
vor allem für die Verhältnisse im Südosten des Reichs.
Karl Bosl bot eine politische Erklärung an. Er meinte - im Rahmen seiner These
von der staufischen Staatsreform - daß Friedrich II. nach 1235 die Reichsgewalt zu
stärken versuchte, indem er die Auffassung durchsetzen wollte, daß die Ministeri-
alen vom Reich zu Lehen gingen. Dabei ließ er explizit die Frage offen, ob mit
diesem Vorgehen „ältere Rechte des Reichs" neu aktiviert wurdenW
Für die Verhältnisse in Bayern sprach Bosl sogar von einer herzoglich-
königlichen Doppelministerialität und von einem Kondominat von König und
191 Vgl. BOSL, Reichsministerialität, Bd. 1, S. 113-119.
192 Vgl. WADLE, Reichsgut, S. 115f.
193 Vgl. KRIEGER, Lehnshoheit, S. 176-182.
194 Vgl. SCHLUNK, Königsmacht, S. 91.
195 Vgl. BOSL, Reichsministerialität, Bd. 2, S. 478ff.