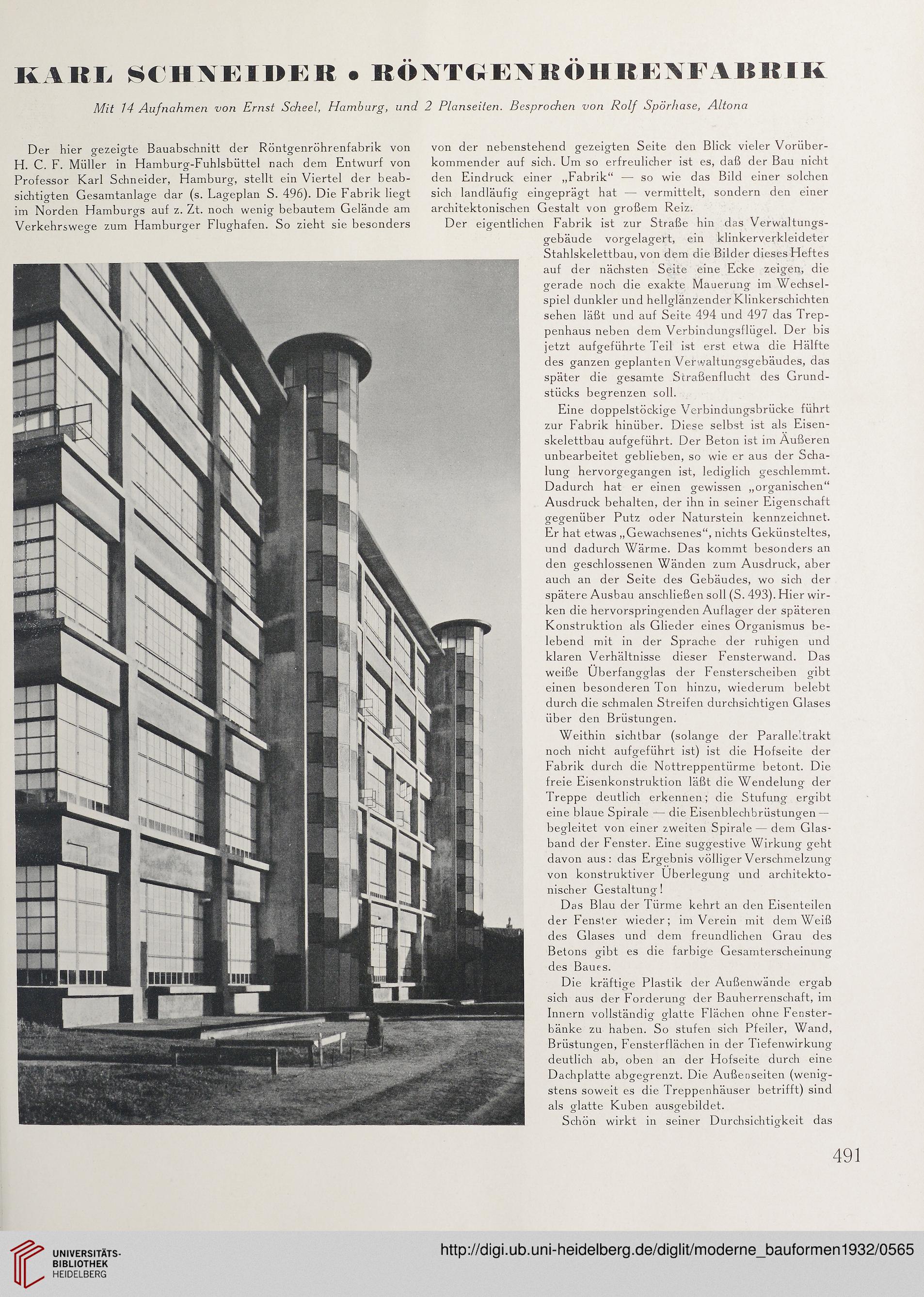KAHL SCHNEIDER • BÖNTGENRÖHRENFABRIK
Mit 14 Aufnahmen von Ernst Scheel, Hamburg, und 2 Planseiten. Besprochen von Rolf Spörhase, Altona
Der hier gezeigte Bauabschnitt der Röntgenröhrenfabrik von
H. C. F. Müller in Hamburg-Fuhlsbüttel nach dem Entwurf von
Professor Karl Schneider, Hamburg, stellt ein Viertel der beab-
sichtigten Gesamtanlage dar (s. Lageplan S. 496). Die Fabrik liegt
im Norden Hamburgs auf z. Zt. noch wenig bebautem Gelände am
Verkehrswege zum Hamburger Flughafen. So zieht sie besonders
von der nebenstehend gezeigten Seite den Blick vieler Vorüber-
kommender auf sich. Um so erfreulicher ist es, daß der Bau nicht
den Eindruck einer „Fabrik“ — so wie das Bild einer solchen
sich landläufig eingeprägt hat — vermittelt, sondern den einer
architektonischen Gestalt von großem Reiz.
Der eigentlichen Fabrik ist zur Straße hin das Verwaltungs-
gebäude vorgelagert, ein klinkerverkleideter
Stahlskelettbau, von dem die Bilder dieses Heftes
auf der nächsten Seite eine Ecke zeigen, die
gerade noch die exakte Mauerung im Wechsel-
spiel dunkler und hellglänzender Klinkerschichten
sehen läßt und auf Seite 494 und 497 das Trep-
penhaus neben dem Verbindungsflügel. Der bis
jetzt aufgeführte Teil ist erst etwa die Hälfte
des ganzen geplanten Verwaltungsgebäudes, das
später die gesamte Straßenflucht des Grund-
stücks begrenzen soll.
Eine doppelstöckige Verbindungsbrücke führt
zur Fabrik hinüber. Diese selbst ist als Eisen-
skelettbau aufgeführt. Der Beton ist im Äußeren
unbearbeitet geblieben, so wie er aus der Scha-
lung hervorgegangen ist, lediglich geschlemmt.
Dadurch hat er einen gewissen „organischen“
Ausdruck behalten, der ihn in seiner Eigenschaft
gegenüber Putz oder Naturstein kennzeichnet.
Er hat etwas „Gewachsenes“, nichts Gekünsteltes,
und dadurch Wärme. Das kommt besonders an
den geschlossenen Wänden zum Ausdruck, aber
auch an der Seite des Gebäudes, wo sich der
spätere Ausbau anschließen soll (S. 493). Hier wir-
ken die hervorspringenden Auflager der späteren
Konstruktion als Glieder eines Organismus be-
lebend mit in der Sprache der ruhigen und
klaren Verhältnisse dieser Fensterwand. Das
weiße Überfangglas der Fensterscheiben gibt
einen besonderen Ton hinzu, wiederum belebt
durch die schmalen Streifen durchsichtigen Glases
über den Brüstungen.
Weithin sichtbar (solange der Paralleitrakt
noch nicht aufgeführt ist) ist die Hofseite der
Fabrik durch die Nottreppentürme betont. Die
freie Eisenkonstruktion läßt die Wendelung der
Treppe deutlich erkennen; die Stufung ergibt
eine blaue Spirale — die Eisenblechbrüstungen —
begleitet von einer zweiten Spirale — dem Glas-
band der Fenster. Eine suggestive Wirkung geht
davon aus: das Ergebnis völliger Verschmelzung
von konstruktiver Überlegung und architekto-
nischer Gestaltung!
Das Blau der Türme kehrt an den Eisenteilen
der Fenster wieder; im Verein mit dem Weiß
des Glases und dem freundlichen Grau des
Betons gibt es die farbige Gesamterscheinung
des Baues.
Die kräftige Plastik der Außenwände ergab
sich aus der Forderung der Bauherrenschaft, im
Innern vollständig glatte Flächen ohne Fenster-
bänke zu haben. So stufen sich Pfeiler, Wand,
Brüstungen, Fensterflächen in der Tiefenwirkung-
deutlich ab, oben an der Hofseite durch eine
Dachplatte abgegrenzt. Die Außenseiten (wenig-
stens soweit es die Treppenhäuser betrifft) sind
als glatte Kuben ausgebildet.
Schön wirkt in seiner Durchsichtigkeit das
491
Mit 14 Aufnahmen von Ernst Scheel, Hamburg, und 2 Planseiten. Besprochen von Rolf Spörhase, Altona
Der hier gezeigte Bauabschnitt der Röntgenröhrenfabrik von
H. C. F. Müller in Hamburg-Fuhlsbüttel nach dem Entwurf von
Professor Karl Schneider, Hamburg, stellt ein Viertel der beab-
sichtigten Gesamtanlage dar (s. Lageplan S. 496). Die Fabrik liegt
im Norden Hamburgs auf z. Zt. noch wenig bebautem Gelände am
Verkehrswege zum Hamburger Flughafen. So zieht sie besonders
von der nebenstehend gezeigten Seite den Blick vieler Vorüber-
kommender auf sich. Um so erfreulicher ist es, daß der Bau nicht
den Eindruck einer „Fabrik“ — so wie das Bild einer solchen
sich landläufig eingeprägt hat — vermittelt, sondern den einer
architektonischen Gestalt von großem Reiz.
Der eigentlichen Fabrik ist zur Straße hin das Verwaltungs-
gebäude vorgelagert, ein klinkerverkleideter
Stahlskelettbau, von dem die Bilder dieses Heftes
auf der nächsten Seite eine Ecke zeigen, die
gerade noch die exakte Mauerung im Wechsel-
spiel dunkler und hellglänzender Klinkerschichten
sehen läßt und auf Seite 494 und 497 das Trep-
penhaus neben dem Verbindungsflügel. Der bis
jetzt aufgeführte Teil ist erst etwa die Hälfte
des ganzen geplanten Verwaltungsgebäudes, das
später die gesamte Straßenflucht des Grund-
stücks begrenzen soll.
Eine doppelstöckige Verbindungsbrücke führt
zur Fabrik hinüber. Diese selbst ist als Eisen-
skelettbau aufgeführt. Der Beton ist im Äußeren
unbearbeitet geblieben, so wie er aus der Scha-
lung hervorgegangen ist, lediglich geschlemmt.
Dadurch hat er einen gewissen „organischen“
Ausdruck behalten, der ihn in seiner Eigenschaft
gegenüber Putz oder Naturstein kennzeichnet.
Er hat etwas „Gewachsenes“, nichts Gekünsteltes,
und dadurch Wärme. Das kommt besonders an
den geschlossenen Wänden zum Ausdruck, aber
auch an der Seite des Gebäudes, wo sich der
spätere Ausbau anschließen soll (S. 493). Hier wir-
ken die hervorspringenden Auflager der späteren
Konstruktion als Glieder eines Organismus be-
lebend mit in der Sprache der ruhigen und
klaren Verhältnisse dieser Fensterwand. Das
weiße Überfangglas der Fensterscheiben gibt
einen besonderen Ton hinzu, wiederum belebt
durch die schmalen Streifen durchsichtigen Glases
über den Brüstungen.
Weithin sichtbar (solange der Paralleitrakt
noch nicht aufgeführt ist) ist die Hofseite der
Fabrik durch die Nottreppentürme betont. Die
freie Eisenkonstruktion läßt die Wendelung der
Treppe deutlich erkennen; die Stufung ergibt
eine blaue Spirale — die Eisenblechbrüstungen —
begleitet von einer zweiten Spirale — dem Glas-
band der Fenster. Eine suggestive Wirkung geht
davon aus: das Ergebnis völliger Verschmelzung
von konstruktiver Überlegung und architekto-
nischer Gestaltung!
Das Blau der Türme kehrt an den Eisenteilen
der Fenster wieder; im Verein mit dem Weiß
des Glases und dem freundlichen Grau des
Betons gibt es die farbige Gesamterscheinung
des Baues.
Die kräftige Plastik der Außenwände ergab
sich aus der Forderung der Bauherrenschaft, im
Innern vollständig glatte Flächen ohne Fenster-
bänke zu haben. So stufen sich Pfeiler, Wand,
Brüstungen, Fensterflächen in der Tiefenwirkung-
deutlich ab, oben an der Hofseite durch eine
Dachplatte abgegrenzt. Die Außenseiten (wenig-
stens soweit es die Treppenhäuser betrifft) sind
als glatte Kuben ausgebildet.
Schön wirkt in seiner Durchsichtigkeit das
491