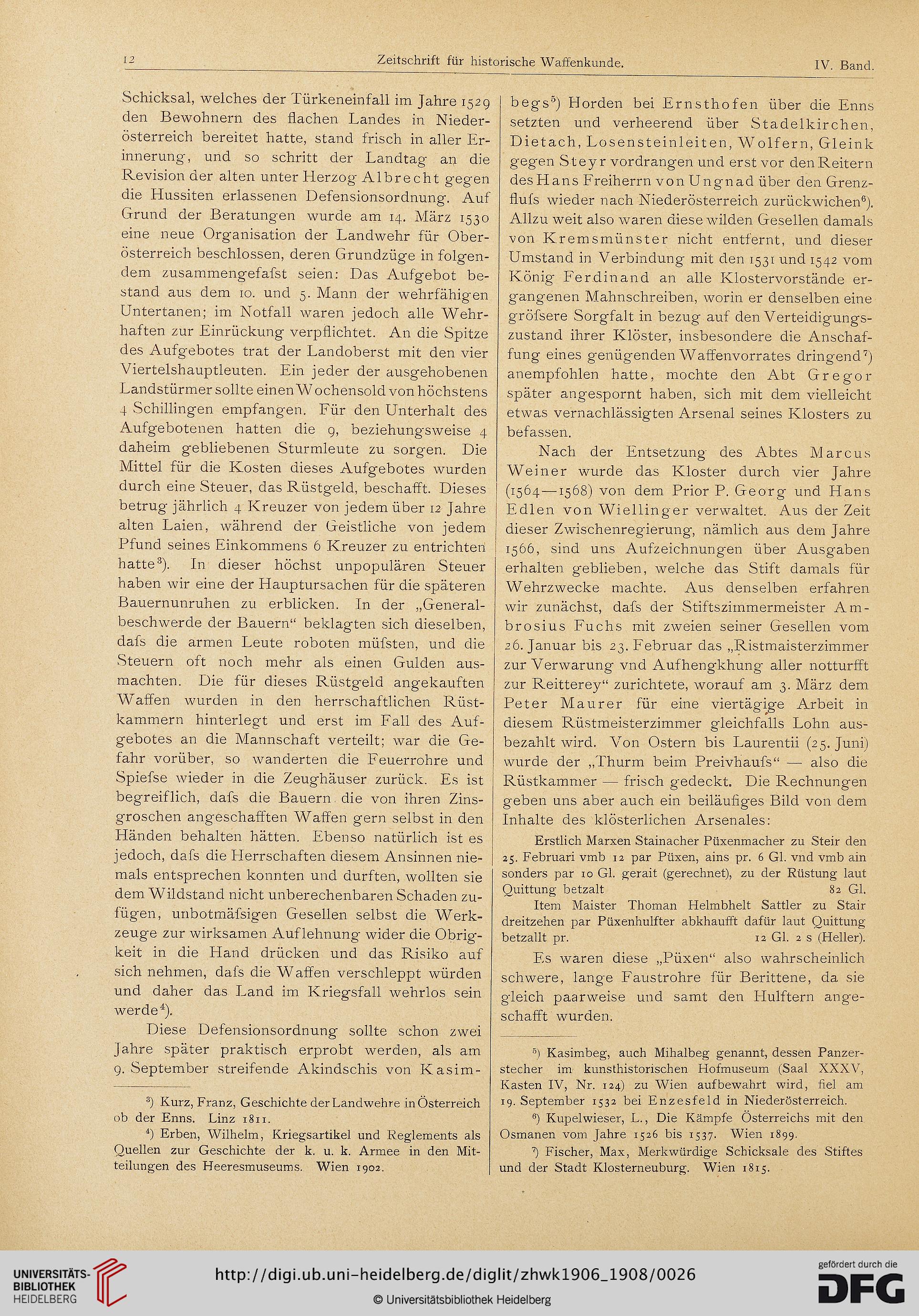12
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
IV. Band.
Schicksal, welches der Türkeneinfall im Jahre 1529
den Bewohnern des flachen Landes in Nieder-
österreich bereitet hatte, stand frisch in aller Er-
innerung-, und so schritt der Landtag an die
Revision der alten unter Herzog Albrecht gegen
die Hussiten erlassenen Defensionsordnung. Auf
Grund der Beratungen wurde am 14. März 1530
eine neue Organisation der Landwehr für Ober-
österreich beschlossen, deren Grundzüge in folgen-
dem zusammengefafst seien: Das Aufgebot be-
stand aus dem 10. und 5. Mann der wehrfähigen
Untertanen; im Notfall waren jedoch alle Wehr-
haften zur Einrückung verpflichtet. An die Spitze
des Aufgebotes trat der Landoberst mit den vier
Viertelshauptleuten. Ein jeder der ausgehobenen
Landstürmer sollte einen W ochensold von höchstens
4 Schillingen empfangen. Für den Unterhalt des
Aufgebotenen hatten die g, beziehungsweise 4
daheim gebliebenen Sturmleute zu sorgen. Die
Mittel für die Kosten dieses Aufgebotes wurden
durch eine Steuer, das Rüstgeld, beschafft. Dieses
betrug jährlich 4 Kreuzer von jedem über 12 Jahre
alten Laien, während der Geistliche von jedem
Pfund seines Einkommens 6 Kreuzer zu entrichten
hatte3). In dieser höchst unpopulären Steuer
haben wir eine der Hauptursachen für die späteren
Bauernunruhen zu erblicken. In der „General-
beschwerde der Bauern“ beklagten sich dieselben,
dafs die armen Leute roboten müfsten, und die
Steuern oft noch mehr als einen Gulden aus-
machten. Die für dieses Rüstgeld angekauften
Waffen wurden in den herrschaftlichen Rüst-
kammern hinterlegt und erst im Fall des Auf-
gebotes an die Mannschaft verteilt; war die Ge-
fahr vorüber, so wanderten die Feuerrohre und
Spiefse wieder in die Zeughäuser zurück. Es ist
begreiflich, dafs die Bauern die von ihren Zins-
groschen angeschafften Waffen gern selbst in den
Händen behalten hätten. Ebenso natürlich ist es
jedoch, dafs die Herrschaften diesem Ansinnen nie-
mals entsprechen konnten und durften, wollten sie
dem Wildstand nicht unberechenbaren Schaden zu-
fügen, unbotmäfsigen Gesellen selbst die Werk-
zeuge zur wirksamen Auflehnung wider die Obrig-
keit in die Hand drücken und das Risiko auf
sich nehmen, dafs die Waffen verschleppt würden
und daher das Land im Kriegsfall wehrlos sein
werde4 *).
Diese Defensionsordnung sollte schon zwei
Jahre später praktisch erprobt werden, als am
9. September streifende Akindschis von Kasim-
3) Kurz, Franz, Geschichte der Landwehre in Österreich
ob der Enns. Linz 1811.
4) Erben, Wilhelm, Kriegsartikel und Reglements als
Quellen zur Geschichte der k. u. k. Armee in den Mit-
teilungen des Heeresmuseums. Wien 1902.
begs0) Horden bei Ernsthofen über die Enns
setzten und verheerend über Stadelkirchen,
Dietach, Losensteinleiten, Wolfern, Gleink
g-egen Steyr vor drangen und erst vor den Reitern
des Hans Freiherrn von Ungnad über den Grenz-
flufs wieder nach Niederösterreich zurückwichen6).
Allzu weit also waren diese wilden Gesellen damals
von Kremsmünster nicht entfernt, und dieser
Umstand in Verbindung mit den 1531 und 1542 vom
König Ferdinand an alle Klostervorstände er-
gangenen Mahnschreiben, worin er denselben eine
gröfsere Sorgfalt in bezug auf den Verteidigungs-
zustand ihrer Klöster, insbesondere die Anschaf-
fung eines g-enügenden Waffenvorrates dringend7)
anempfohlen hatte, mochte den Abt Gregor
später angespornt haben, sich mit dem vielleicht
etwas vernachlässigten Arsenal seines Klosters zu
befassen.
Nach der Entsetzung- des Abtes Marcus
Weiner wurde das Kloster durch vier Jahre
(1564 —1568) von dem Prior P. Georg und Hans
Edlen von Wiellinger verwaltet. Aus der Zeit
dieser Zwischenreg'ierung, nämlich aus dem Jahre
1566, sind uns Aufzeichnungen über Ausgaben
erhalten g'eblieben, welche das Stift damals für
Wehrzwecke machte. Aus denselben erfahren
wir zunächst, dafs der Stiftszimmermeister Am-
brosius Fuchs mit zweien seiner Gesellen vom
26. Januar bis 23. Februar das „Ristmaisterzimmer
zur Verwarung vnd Aufhengkhung aller notturfft
zur Reitterey“ zurichtete, worauf am 3. März dem
Peter Maurer für eine viertägige Arbeit in
diesem Rüstmeisterzimmer gleichfalls Lohn aus-
bezahlt wird. Von Ostern bis Laurentii (25. Juni)
wurde der „Thurm beim Preivhaufs“ —■ also die
Rüstkammer — frisch gedeckt. Die Rechnungen
geben uns aber auch ein beiläufiges Bild von dem
Inhalte des klösterlichen Arsenales:
Erstlich Marxen Stainacher Püxenmacher zu Steir den
25. Februari vmb 12 par Püxen, ains pr. 6 Gl. vnd vmb ain
sonders par 10 Gl. gerait (gerechnet), zu der Rüstung laut
Quittung betzalt 82 Gl.
Item Maister Thoman Helmbhelt Sattler zu Stair
dreitzehen par Püxenhulfter abkhaufft dafür laut Quittung
betzallt pr. 12 Gl. 2 s (Heller).
Es waren diese „Püxen“ also wahrscheinlich
schwere, lange Faustrohre für Berittene, da sie
gleich paarweise und samt den ITulftern ange-
schafft wurden.
6) Kasimbeg, auch Mihalbeg genannt, dessen Panzer-
stecher im kunsthistorischen Hofmuseum (Saal XXXV,
Kasten IV, Nr. 124) zu Wien auf bewahrt wird, fiel am
19. September 1532 bei Enzesfeld in Niederösterreich.
6) Kupelwieser, L., Die Kämpfe Österreichs mit den
Osmanen vom Jahre 1526 bis 1537. Wien 1899.
7) Fischer, Max, Merkwürdige Schicksale des Stiftes
und der Stadt Klosterneuburg. Wien 18x5.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
IV. Band.
Schicksal, welches der Türkeneinfall im Jahre 1529
den Bewohnern des flachen Landes in Nieder-
österreich bereitet hatte, stand frisch in aller Er-
innerung-, und so schritt der Landtag an die
Revision der alten unter Herzog Albrecht gegen
die Hussiten erlassenen Defensionsordnung. Auf
Grund der Beratungen wurde am 14. März 1530
eine neue Organisation der Landwehr für Ober-
österreich beschlossen, deren Grundzüge in folgen-
dem zusammengefafst seien: Das Aufgebot be-
stand aus dem 10. und 5. Mann der wehrfähigen
Untertanen; im Notfall waren jedoch alle Wehr-
haften zur Einrückung verpflichtet. An die Spitze
des Aufgebotes trat der Landoberst mit den vier
Viertelshauptleuten. Ein jeder der ausgehobenen
Landstürmer sollte einen W ochensold von höchstens
4 Schillingen empfangen. Für den Unterhalt des
Aufgebotenen hatten die g, beziehungsweise 4
daheim gebliebenen Sturmleute zu sorgen. Die
Mittel für die Kosten dieses Aufgebotes wurden
durch eine Steuer, das Rüstgeld, beschafft. Dieses
betrug jährlich 4 Kreuzer von jedem über 12 Jahre
alten Laien, während der Geistliche von jedem
Pfund seines Einkommens 6 Kreuzer zu entrichten
hatte3). In dieser höchst unpopulären Steuer
haben wir eine der Hauptursachen für die späteren
Bauernunruhen zu erblicken. In der „General-
beschwerde der Bauern“ beklagten sich dieselben,
dafs die armen Leute roboten müfsten, und die
Steuern oft noch mehr als einen Gulden aus-
machten. Die für dieses Rüstgeld angekauften
Waffen wurden in den herrschaftlichen Rüst-
kammern hinterlegt und erst im Fall des Auf-
gebotes an die Mannschaft verteilt; war die Ge-
fahr vorüber, so wanderten die Feuerrohre und
Spiefse wieder in die Zeughäuser zurück. Es ist
begreiflich, dafs die Bauern die von ihren Zins-
groschen angeschafften Waffen gern selbst in den
Händen behalten hätten. Ebenso natürlich ist es
jedoch, dafs die Herrschaften diesem Ansinnen nie-
mals entsprechen konnten und durften, wollten sie
dem Wildstand nicht unberechenbaren Schaden zu-
fügen, unbotmäfsigen Gesellen selbst die Werk-
zeuge zur wirksamen Auflehnung wider die Obrig-
keit in die Hand drücken und das Risiko auf
sich nehmen, dafs die Waffen verschleppt würden
und daher das Land im Kriegsfall wehrlos sein
werde4 *).
Diese Defensionsordnung sollte schon zwei
Jahre später praktisch erprobt werden, als am
9. September streifende Akindschis von Kasim-
3) Kurz, Franz, Geschichte der Landwehre in Österreich
ob der Enns. Linz 1811.
4) Erben, Wilhelm, Kriegsartikel und Reglements als
Quellen zur Geschichte der k. u. k. Armee in den Mit-
teilungen des Heeresmuseums. Wien 1902.
begs0) Horden bei Ernsthofen über die Enns
setzten und verheerend über Stadelkirchen,
Dietach, Losensteinleiten, Wolfern, Gleink
g-egen Steyr vor drangen und erst vor den Reitern
des Hans Freiherrn von Ungnad über den Grenz-
flufs wieder nach Niederösterreich zurückwichen6).
Allzu weit also waren diese wilden Gesellen damals
von Kremsmünster nicht entfernt, und dieser
Umstand in Verbindung mit den 1531 und 1542 vom
König Ferdinand an alle Klostervorstände er-
gangenen Mahnschreiben, worin er denselben eine
gröfsere Sorgfalt in bezug auf den Verteidigungs-
zustand ihrer Klöster, insbesondere die Anschaf-
fung eines g-enügenden Waffenvorrates dringend7)
anempfohlen hatte, mochte den Abt Gregor
später angespornt haben, sich mit dem vielleicht
etwas vernachlässigten Arsenal seines Klosters zu
befassen.
Nach der Entsetzung- des Abtes Marcus
Weiner wurde das Kloster durch vier Jahre
(1564 —1568) von dem Prior P. Georg und Hans
Edlen von Wiellinger verwaltet. Aus der Zeit
dieser Zwischenreg'ierung, nämlich aus dem Jahre
1566, sind uns Aufzeichnungen über Ausgaben
erhalten g'eblieben, welche das Stift damals für
Wehrzwecke machte. Aus denselben erfahren
wir zunächst, dafs der Stiftszimmermeister Am-
brosius Fuchs mit zweien seiner Gesellen vom
26. Januar bis 23. Februar das „Ristmaisterzimmer
zur Verwarung vnd Aufhengkhung aller notturfft
zur Reitterey“ zurichtete, worauf am 3. März dem
Peter Maurer für eine viertägige Arbeit in
diesem Rüstmeisterzimmer gleichfalls Lohn aus-
bezahlt wird. Von Ostern bis Laurentii (25. Juni)
wurde der „Thurm beim Preivhaufs“ —■ also die
Rüstkammer — frisch gedeckt. Die Rechnungen
geben uns aber auch ein beiläufiges Bild von dem
Inhalte des klösterlichen Arsenales:
Erstlich Marxen Stainacher Püxenmacher zu Steir den
25. Februari vmb 12 par Püxen, ains pr. 6 Gl. vnd vmb ain
sonders par 10 Gl. gerait (gerechnet), zu der Rüstung laut
Quittung betzalt 82 Gl.
Item Maister Thoman Helmbhelt Sattler zu Stair
dreitzehen par Püxenhulfter abkhaufft dafür laut Quittung
betzallt pr. 12 Gl. 2 s (Heller).
Es waren diese „Püxen“ also wahrscheinlich
schwere, lange Faustrohre für Berittene, da sie
gleich paarweise und samt den ITulftern ange-
schafft wurden.
6) Kasimbeg, auch Mihalbeg genannt, dessen Panzer-
stecher im kunsthistorischen Hofmuseum (Saal XXXV,
Kasten IV, Nr. 124) zu Wien auf bewahrt wird, fiel am
19. September 1532 bei Enzesfeld in Niederösterreich.
6) Kupelwieser, L., Die Kämpfe Österreichs mit den
Osmanen vom Jahre 1526 bis 1537. Wien 1899.
7) Fischer, Max, Merkwürdige Schicksale des Stiftes
und der Stadt Klosterneuburg. Wien 18x5.