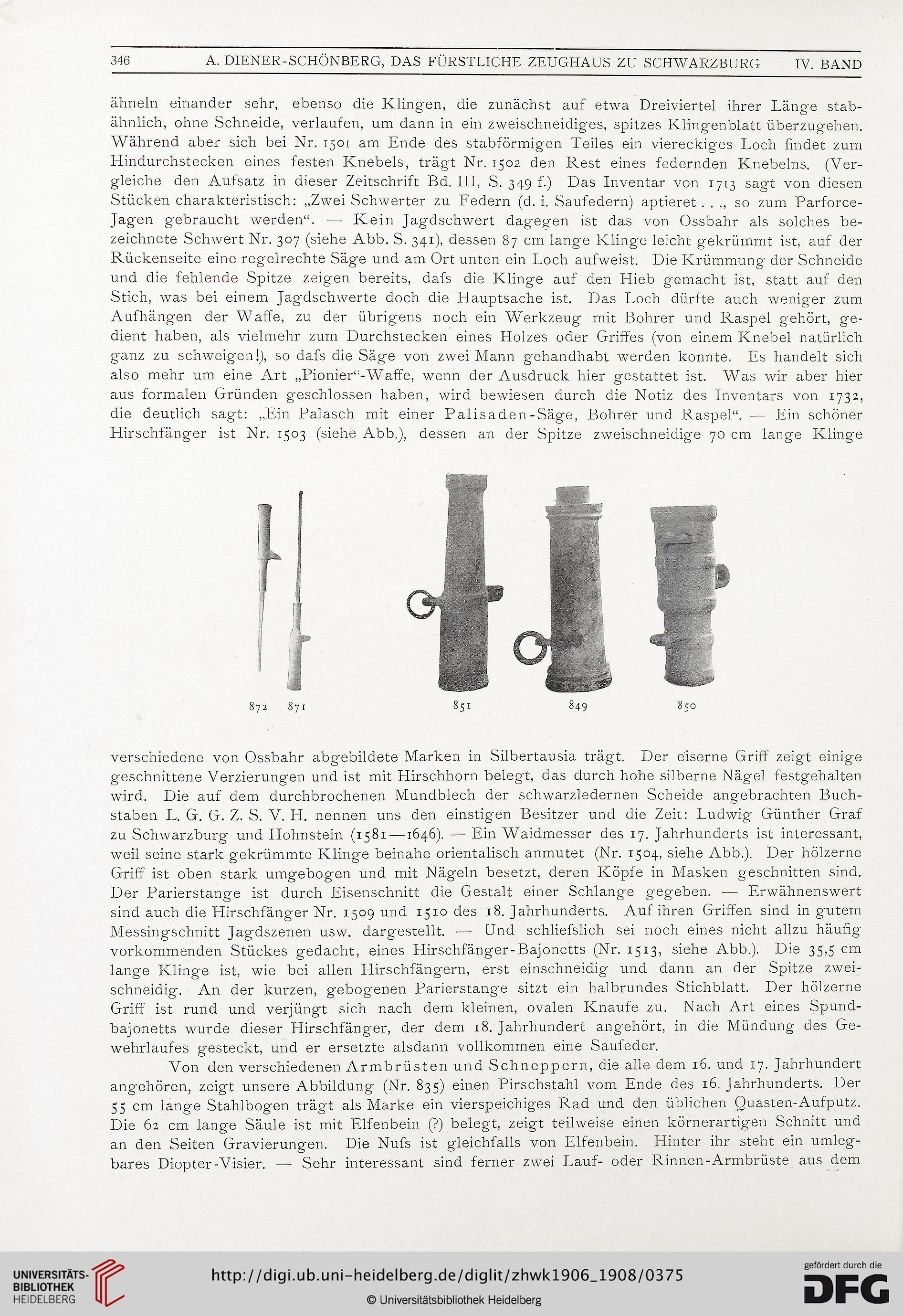346
A. DIENER-SCHÖNBERG, DAS FÜRSTLICHE ZEUGHAUS ZU SCHWARZBURG
IV. BAND
ähneln einander sehr, ebenso die Klingen, die zunächst auf etwa Dreiviertel ihrer Länge stab-
ähnlich, ohne Schneide, verlaufen, um dann in ein zweischneidiges, spitzes Klingenblatt überzugehen.
Während aber sich bei Nr. 1501 am Ende des stabförmigen Teiles ein viereckiges Loch findet zum
Hindurchstecken eines festen Knebels, trägt Nr. 1502 den Rest eines federnden Knebelns. (Ver-
gleiche den Aufsatz in dieser Zeitschrift Bd. III, S. 349 f.) Das Inventar von 1713 sagt von diesen
Stücken charakteristisch: „Zwei Schwerter zu Federn (d. i. Saufedern) aptieret . . ., so zum Parforce-
Jagen gebraucht werden“. —• Kein Jagdschwert dagegen ist das von Ossbahr als solches be-
zeichnete Schwert Nr. 307 (siehe Abb. S. 341), dessen 87 cm lange Klinge leicht gekrümmt ist, auf der
Rückenseite eine regelrechte Säge und am Ort unten ein Loch aufweist. Die Krümmung der Schneide
und die fehlende Spitze zeigen bereits, dafs die Klinge auf den Hieb gemacht ist, statt auf den
Stich, was bei einem Jagdschwerte doch die Hauptsache ist. Das Loch dürfte auch weniger zum
Aufhängen der Waffe, zu der übrigens noch ein Werkzeug mit Bohrer und Raspel gehört, ge-
dient haben, als vielmehr zum Durchstecken eines Holzes oder Griffes (von einem Knebel natürlich
ganz zu schweigen!), so dafs die Säge von zwei Mann gehandhabt werden konnte. Es handelt sich
also mehr um eine Art „Pionier“-Waffe, wenn der Ausdruck hier gestattet ist. Was wir aber hier
aus formalen Gründen geschlossen haben, wird bewiesen durch die Notiz des Inventars von 1732,
die deutlich sagt: „Ein Palasch mit einer Palisaden-Säge, Bohrer und Raspel“. — Ein schöner
Hirschfänger ist Nr. 1503 (siehe Abb.), dessen an der Spitze zweischneidige 70 cm lange Klinge
872 871 851 849 850
verschiedene von Ossbahr abgebildete Marken in Silbertausia trägt. Der eiserne Griff zeigt einige
geschnittene Verzierungen und ist mit Llirschhorn belegt, das durch hohe silberne Nägel festgehalten
wird. Die auf dem durchbrochenen Mundblech der schwarzledernen Scheide angebrachten Buch-
staben L. G. G. Z. S. V. H. nennen uns den einstigen Besitzer und die Zeit: Ludwig Günther Graf
zu Schwarzburg und Hohnstein (1581 —1646). — Ein Waidmesser des 17. Jahrhunderts ist interessant,
weil seine stark gekrümmte Klinge beinahe orientalisch anmutet (Nr. 1504, siehe Abb.). Der hölzerne
Griff ist oben stark umgebogen und mit Nägeln besetzt, deren Köpfe in Masken geschnitten sind.
Der Parierstange ist durch Eisenschnitt die Gestalt einer Schlange gegeben. — Erwähnenswert
sind auch die Hirschfänger Nr. 1509 und 1510 des 18. Jahrhunderts. Auf ihren Griffen sind in gutem
Messingschnitt Jagdszenen usw. dargestellt. — CJnd schliefslich sei noch eines nicht allzu häufig
vorkommenden Stückes gedacht, eines Llirschfänger-Bajonetts (Nr. 1513, siehe Abb.). Die 35,5 cm
lange Klinge ist, wie bei allen Hirschfängern, erst einschneidig und dann an der Spitze zwei-
schneidig. An der kurzen, gebogenen Parierstange sitzt ein halbrundes Stichblatt. Der hölzerne
Griff ist rund und verjüngt sich nach dem kleinen, ovalen Knaufe zu. Nach Art eines Spund-
bajonetts wurde dieser Hirschfänger, der dem 18. Jahrhundert angehört, in die Mündung des Ge-
wehrlaufes gesteckt, und er ersetzte alsdann vollkommen eine Saufeder.
Von den verschiedenen Armbrüsten und Schneppern, die alle dem 16. und 17. Jahrhundert
angehören, zeigt unsere Abbildung' (Nr. 835) einen Pirschstahl vom Ende des 16. Jahrhunderts. Der
55 cm lang-e Stahlbogen trägt als Marke ein vierspeichiges Rad und den üblichen Quasten-Aufputz.
Die 62 cm lange Säule ist mit Elfenbein (?) belegt, zeigt teilweise einen körnerartigen Schnitt und
an den Seiten Gravierungen. Die Nufs ist gleichfalls von Elfenbein. Hinter ihr steht ein umleg-
bares Diopter-Visier. -—- Sehr interessant sind ferner zwei Lauf- oder Rinnen-Armbrüste aus dem
A. DIENER-SCHÖNBERG, DAS FÜRSTLICHE ZEUGHAUS ZU SCHWARZBURG
IV. BAND
ähneln einander sehr, ebenso die Klingen, die zunächst auf etwa Dreiviertel ihrer Länge stab-
ähnlich, ohne Schneide, verlaufen, um dann in ein zweischneidiges, spitzes Klingenblatt überzugehen.
Während aber sich bei Nr. 1501 am Ende des stabförmigen Teiles ein viereckiges Loch findet zum
Hindurchstecken eines festen Knebels, trägt Nr. 1502 den Rest eines federnden Knebelns. (Ver-
gleiche den Aufsatz in dieser Zeitschrift Bd. III, S. 349 f.) Das Inventar von 1713 sagt von diesen
Stücken charakteristisch: „Zwei Schwerter zu Federn (d. i. Saufedern) aptieret . . ., so zum Parforce-
Jagen gebraucht werden“. —• Kein Jagdschwert dagegen ist das von Ossbahr als solches be-
zeichnete Schwert Nr. 307 (siehe Abb. S. 341), dessen 87 cm lange Klinge leicht gekrümmt ist, auf der
Rückenseite eine regelrechte Säge und am Ort unten ein Loch aufweist. Die Krümmung der Schneide
und die fehlende Spitze zeigen bereits, dafs die Klinge auf den Hieb gemacht ist, statt auf den
Stich, was bei einem Jagdschwerte doch die Hauptsache ist. Das Loch dürfte auch weniger zum
Aufhängen der Waffe, zu der übrigens noch ein Werkzeug mit Bohrer und Raspel gehört, ge-
dient haben, als vielmehr zum Durchstecken eines Holzes oder Griffes (von einem Knebel natürlich
ganz zu schweigen!), so dafs die Säge von zwei Mann gehandhabt werden konnte. Es handelt sich
also mehr um eine Art „Pionier“-Waffe, wenn der Ausdruck hier gestattet ist. Was wir aber hier
aus formalen Gründen geschlossen haben, wird bewiesen durch die Notiz des Inventars von 1732,
die deutlich sagt: „Ein Palasch mit einer Palisaden-Säge, Bohrer und Raspel“. — Ein schöner
Hirschfänger ist Nr. 1503 (siehe Abb.), dessen an der Spitze zweischneidige 70 cm lange Klinge
872 871 851 849 850
verschiedene von Ossbahr abgebildete Marken in Silbertausia trägt. Der eiserne Griff zeigt einige
geschnittene Verzierungen und ist mit Llirschhorn belegt, das durch hohe silberne Nägel festgehalten
wird. Die auf dem durchbrochenen Mundblech der schwarzledernen Scheide angebrachten Buch-
staben L. G. G. Z. S. V. H. nennen uns den einstigen Besitzer und die Zeit: Ludwig Günther Graf
zu Schwarzburg und Hohnstein (1581 —1646). — Ein Waidmesser des 17. Jahrhunderts ist interessant,
weil seine stark gekrümmte Klinge beinahe orientalisch anmutet (Nr. 1504, siehe Abb.). Der hölzerne
Griff ist oben stark umgebogen und mit Nägeln besetzt, deren Köpfe in Masken geschnitten sind.
Der Parierstange ist durch Eisenschnitt die Gestalt einer Schlange gegeben. — Erwähnenswert
sind auch die Hirschfänger Nr. 1509 und 1510 des 18. Jahrhunderts. Auf ihren Griffen sind in gutem
Messingschnitt Jagdszenen usw. dargestellt. — CJnd schliefslich sei noch eines nicht allzu häufig
vorkommenden Stückes gedacht, eines Llirschfänger-Bajonetts (Nr. 1513, siehe Abb.). Die 35,5 cm
lange Klinge ist, wie bei allen Hirschfängern, erst einschneidig und dann an der Spitze zwei-
schneidig. An der kurzen, gebogenen Parierstange sitzt ein halbrundes Stichblatt. Der hölzerne
Griff ist rund und verjüngt sich nach dem kleinen, ovalen Knaufe zu. Nach Art eines Spund-
bajonetts wurde dieser Hirschfänger, der dem 18. Jahrhundert angehört, in die Mündung des Ge-
wehrlaufes gesteckt, und er ersetzte alsdann vollkommen eine Saufeder.
Von den verschiedenen Armbrüsten und Schneppern, die alle dem 16. und 17. Jahrhundert
angehören, zeigt unsere Abbildung' (Nr. 835) einen Pirschstahl vom Ende des 16. Jahrhunderts. Der
55 cm lang-e Stahlbogen trägt als Marke ein vierspeichiges Rad und den üblichen Quasten-Aufputz.
Die 62 cm lange Säule ist mit Elfenbein (?) belegt, zeigt teilweise einen körnerartigen Schnitt und
an den Seiten Gravierungen. Die Nufs ist gleichfalls von Elfenbein. Hinter ihr steht ein umleg-
bares Diopter-Visier. -—- Sehr interessant sind ferner zwei Lauf- oder Rinnen-Armbrüste aus dem