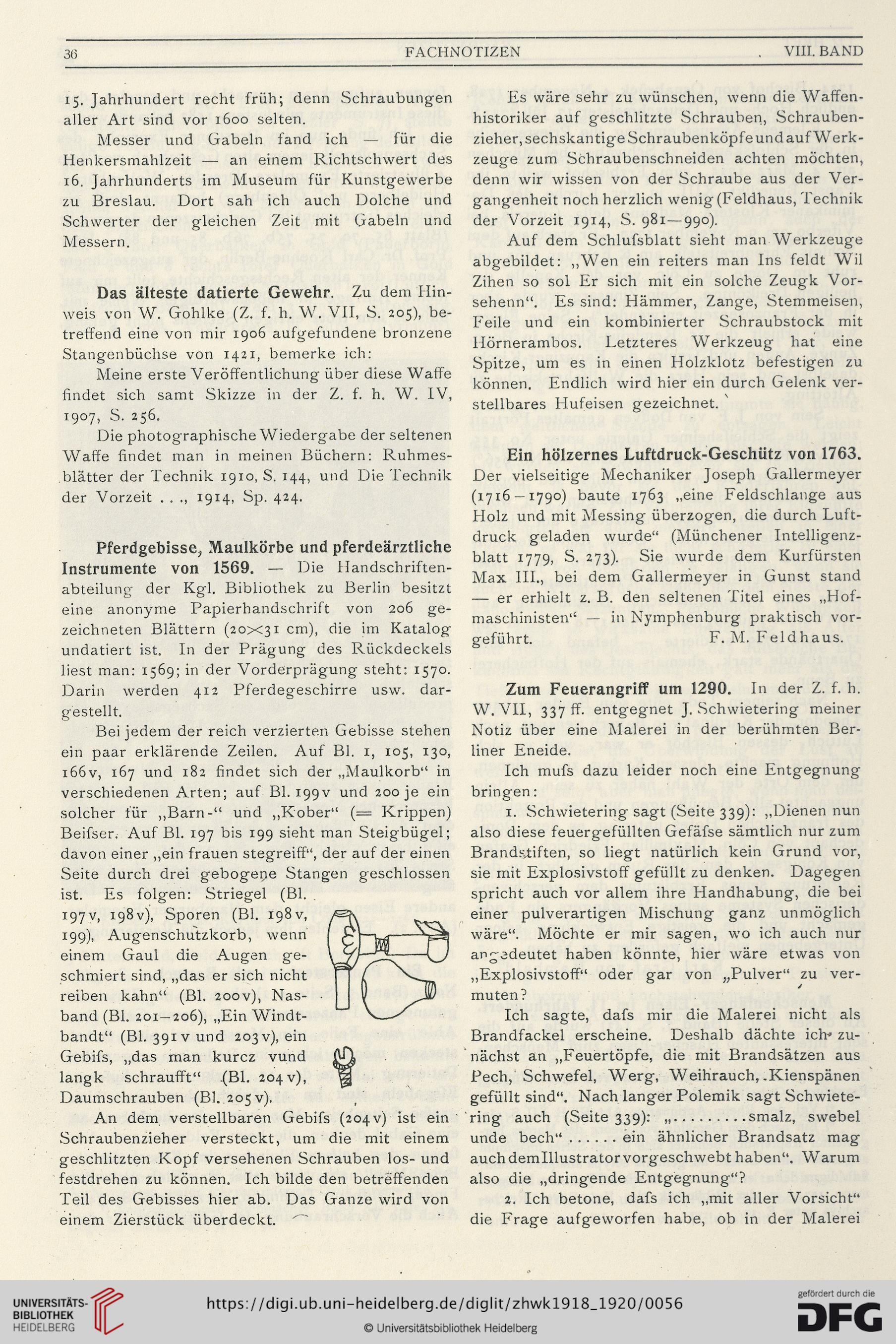36
FACHNOTIZEN
VIII. BAND
15. Jahrhundert recht früh; denn Schraubungen
aller Art sind vor 1600 selten.
Messer und Gabeln fand ich — für die
Henkersmahlzeit — an einem Richtschwert des
16. Jahrhunderts im Museum für Kunstgewerbe
zu Breslau. Dort sah ich auch Dolche und
Schwerter der gleichen Zeit mit Gabeln und
Messern.
Das älteste datierte Gewehr. Zu dem Hin-
weis von W. Gohlke (Z. f. h. W. VII, S. 205), be-
treffend eine von mir 1906 aufgefundene bronzene
Stangenbüchse von 1421, bemerke ich:
Meine erste Veröffentlichung über diese Waffe
findet sich samt Skizze in der Z. f. h. W. IV,
1907, S. 256.
Die photographische Wiedergabe der seltenen
Waffe findet man in meinen Büchern: Ruhmes-
Es wäre sehr zu wünschen, wenn die Waffen-
historiker auf geschlitzte Schrauben, Schrauben-
zieher, sechskantige Schraubenköpfe und auf Werk-
zeuge zum Schraubenschneiden achten möchten,
denn wir wissen von der Schraube aus der Ver-
gangenheit noch herzlich wenig (Feldhaus, Technik
der Vorzeit 1914, S. 981—990).
Auf dem Schlufsblatt sieht man Werkzeuge
abgebildet: „Wen ein reiters man Ins feldt Wil
Zihen so sol Er sich mit ein solche Zeugk Vor-
sehenn“. Es sind: Hämmer, Zange, Stemmeisen,
Feile und ein kombinierter Schraubstock mit
Hörnerambos. Letzteres Werkzeug hat eine
Spitze, um es in einen Holzklotz befestigen zu
können. Endlich wird hier ein durch Gelenk ver-
stellbares Hufeisen gezeichnet.
Ein hölzernes Luftdruck-Geschütz von 1763.
3
Der vielseitige Mechaniker Joseph Galiermeyer
(1716 — 1790) baute 1763 „eine Feldschlange aus
Holz und mit Messing überzogen, die durch Luft-
druck geladen wurde“ (Münchener Intelligenz-
blatt 1779, S. 273). Sie wurde dem Kurfürsten
Max III., bei dem Gallermeyer in Gunst stand
— er erhielt z. B. den seltenen Titel eines „Hof-
maschinisten“ — in Nymphenburg praktisch vor-
geführt. F. M. Feldhaus.
Zum Feuerangriff um 1290. In der Z. f. h.
W. VII, 337 ff. entgegnet J. Schwietering meiner
Notiz über eine Malerei in der berühmten Ber-
liner Eneide.
Ich mufs dazu leider noch eine Entgegnung
bringen:
1. Schwietering sagt (Seite 339): ,,Dienen nun
also diese feuergefüllten Gefäfse sämtlich nur zum
Brandstiften, so liegt natürlich kein Grund vor,
sie mit Explosivstoff gefüllt zu denken. Dagegen
spricht auch vor allem ihre Handhabung, die bei
einer pulverartigen Mischung ganz unmöglich
wäre“. Möchte er mir sagen, wo ich auch nur
angedeutet haben könnte, hier wäre etwas von
„Explosivstoff“ oder gar von „Pulver“ zu ver-
muten ?
Ich sagte, dafs mir die Malerei nicht als
Brandfackel erscheine. Deshalb dächte ich* zu-
nächst an „Feuertöpfe, die mit Brandsätzen aus
Pech, Schwefel, Werg, Weihrauch, .Kienspänen
gefüllt sind“. Nach langer Polemik sagt Schwiete-
„.smalz, swebel
unde bech“.ein ähnlicher Brandsatz mag
auch demlllustrator vorgeschwebt haben“. Warum
also die „dringende Entgegnung“?
2. Ich betone, dafs ich „mit aller Vorsicht“
die Frage aufgeworfen habe, ob in der Malerei
Pferdgebisse? Maulkörbe und pferdeärztliche
Instrumente von 1569. — Die Handschriften¬
abteilung der Kgl. Bibliothek zu Berlin besitzt
eine anonyme Papierhandschrift von 206 ge¬
zeichneten Blättern (20x31 cm), die im Katalog
undatiert ist. In der Prägung des Rückdeckels
liest man: 1569; in der Vorderprägung steht: 1570.
Darin werden 412 Pferdegeschirre usw. dar¬
gestellt.
Bei jedem der reich verzierten Gebisse stehen
ein paar erklärende Zeilen. Auf Bl. 1, 105, 130,
i66v, 167 und 182 findet sich der „Maulkorb“ in
verschiedenen Arten; auf Bl. 199v und 200 je ein
solcher für „Barn-“ und „Kober“ (= Krippen)
Beifser. Auf Bl. 197 bis 199 sieht man Steigbügel;
davon einer „ein frauen stegreiff“, der auf der einen
Seite durch drei gebogene Stangen geschlossen
ist. Es folgen: Striegel (Bl.
197V, 198V), Sporen (Bl. 198V,
199), Augenschutzkorb, wenn
einem Gaul die Augen ge¬
schmiert sind, „das er sich nicht
reiben kahn“ (Bl. 2oov), Nas- •
band (Bl. 201—206), „Ein Windt-
bandt“ (Bl. 391 v und 203 V), ein
Gebifs, „das man kurcz vund
langk schraufft“ .(Bl. 204 V),
Daumschrauben (Bl,.205 V).
An dem verstellbaren Gebifs (204 V) ist ein ring auch (Seite 339):
Schraubenzieher versteckt, um die mit einem
geschlitzten Kopf versehenen Schrauben los- und
festdrehen zu können. Ich bilde den betreffenden
Teil des Gebisses hier ab. Das Ganze wird von
einem Zierstück überdeckt. " '
blätter der Technik 1910, S. 144, und Die Technik
der Vorzeit . . ., 1914, Sp. 424.
FACHNOTIZEN
VIII. BAND
15. Jahrhundert recht früh; denn Schraubungen
aller Art sind vor 1600 selten.
Messer und Gabeln fand ich — für die
Henkersmahlzeit — an einem Richtschwert des
16. Jahrhunderts im Museum für Kunstgewerbe
zu Breslau. Dort sah ich auch Dolche und
Schwerter der gleichen Zeit mit Gabeln und
Messern.
Das älteste datierte Gewehr. Zu dem Hin-
weis von W. Gohlke (Z. f. h. W. VII, S. 205), be-
treffend eine von mir 1906 aufgefundene bronzene
Stangenbüchse von 1421, bemerke ich:
Meine erste Veröffentlichung über diese Waffe
findet sich samt Skizze in der Z. f. h. W. IV,
1907, S. 256.
Die photographische Wiedergabe der seltenen
Waffe findet man in meinen Büchern: Ruhmes-
Es wäre sehr zu wünschen, wenn die Waffen-
historiker auf geschlitzte Schrauben, Schrauben-
zieher, sechskantige Schraubenköpfe und auf Werk-
zeuge zum Schraubenschneiden achten möchten,
denn wir wissen von der Schraube aus der Ver-
gangenheit noch herzlich wenig (Feldhaus, Technik
der Vorzeit 1914, S. 981—990).
Auf dem Schlufsblatt sieht man Werkzeuge
abgebildet: „Wen ein reiters man Ins feldt Wil
Zihen so sol Er sich mit ein solche Zeugk Vor-
sehenn“. Es sind: Hämmer, Zange, Stemmeisen,
Feile und ein kombinierter Schraubstock mit
Hörnerambos. Letzteres Werkzeug hat eine
Spitze, um es in einen Holzklotz befestigen zu
können. Endlich wird hier ein durch Gelenk ver-
stellbares Hufeisen gezeichnet.
Ein hölzernes Luftdruck-Geschütz von 1763.
3
Der vielseitige Mechaniker Joseph Galiermeyer
(1716 — 1790) baute 1763 „eine Feldschlange aus
Holz und mit Messing überzogen, die durch Luft-
druck geladen wurde“ (Münchener Intelligenz-
blatt 1779, S. 273). Sie wurde dem Kurfürsten
Max III., bei dem Gallermeyer in Gunst stand
— er erhielt z. B. den seltenen Titel eines „Hof-
maschinisten“ — in Nymphenburg praktisch vor-
geführt. F. M. Feldhaus.
Zum Feuerangriff um 1290. In der Z. f. h.
W. VII, 337 ff. entgegnet J. Schwietering meiner
Notiz über eine Malerei in der berühmten Ber-
liner Eneide.
Ich mufs dazu leider noch eine Entgegnung
bringen:
1. Schwietering sagt (Seite 339): ,,Dienen nun
also diese feuergefüllten Gefäfse sämtlich nur zum
Brandstiften, so liegt natürlich kein Grund vor,
sie mit Explosivstoff gefüllt zu denken. Dagegen
spricht auch vor allem ihre Handhabung, die bei
einer pulverartigen Mischung ganz unmöglich
wäre“. Möchte er mir sagen, wo ich auch nur
angedeutet haben könnte, hier wäre etwas von
„Explosivstoff“ oder gar von „Pulver“ zu ver-
muten ?
Ich sagte, dafs mir die Malerei nicht als
Brandfackel erscheine. Deshalb dächte ich* zu-
nächst an „Feuertöpfe, die mit Brandsätzen aus
Pech, Schwefel, Werg, Weihrauch, .Kienspänen
gefüllt sind“. Nach langer Polemik sagt Schwiete-
„.smalz, swebel
unde bech“.ein ähnlicher Brandsatz mag
auch demlllustrator vorgeschwebt haben“. Warum
also die „dringende Entgegnung“?
2. Ich betone, dafs ich „mit aller Vorsicht“
die Frage aufgeworfen habe, ob in der Malerei
Pferdgebisse? Maulkörbe und pferdeärztliche
Instrumente von 1569. — Die Handschriften¬
abteilung der Kgl. Bibliothek zu Berlin besitzt
eine anonyme Papierhandschrift von 206 ge¬
zeichneten Blättern (20x31 cm), die im Katalog
undatiert ist. In der Prägung des Rückdeckels
liest man: 1569; in der Vorderprägung steht: 1570.
Darin werden 412 Pferdegeschirre usw. dar¬
gestellt.
Bei jedem der reich verzierten Gebisse stehen
ein paar erklärende Zeilen. Auf Bl. 1, 105, 130,
i66v, 167 und 182 findet sich der „Maulkorb“ in
verschiedenen Arten; auf Bl. 199v und 200 je ein
solcher für „Barn-“ und „Kober“ (= Krippen)
Beifser. Auf Bl. 197 bis 199 sieht man Steigbügel;
davon einer „ein frauen stegreiff“, der auf der einen
Seite durch drei gebogene Stangen geschlossen
ist. Es folgen: Striegel (Bl.
197V, 198V), Sporen (Bl. 198V,
199), Augenschutzkorb, wenn
einem Gaul die Augen ge¬
schmiert sind, „das er sich nicht
reiben kahn“ (Bl. 2oov), Nas- •
band (Bl. 201—206), „Ein Windt-
bandt“ (Bl. 391 v und 203 V), ein
Gebifs, „das man kurcz vund
langk schraufft“ .(Bl. 204 V),
Daumschrauben (Bl,.205 V).
An dem verstellbaren Gebifs (204 V) ist ein ring auch (Seite 339):
Schraubenzieher versteckt, um die mit einem
geschlitzten Kopf versehenen Schrauben los- und
festdrehen zu können. Ich bilde den betreffenden
Teil des Gebisses hier ab. Das Ganze wird von
einem Zierstück überdeckt. " '
blätter der Technik 1910, S. 144, und Die Technik
der Vorzeit . . ., 1914, Sp. 424.