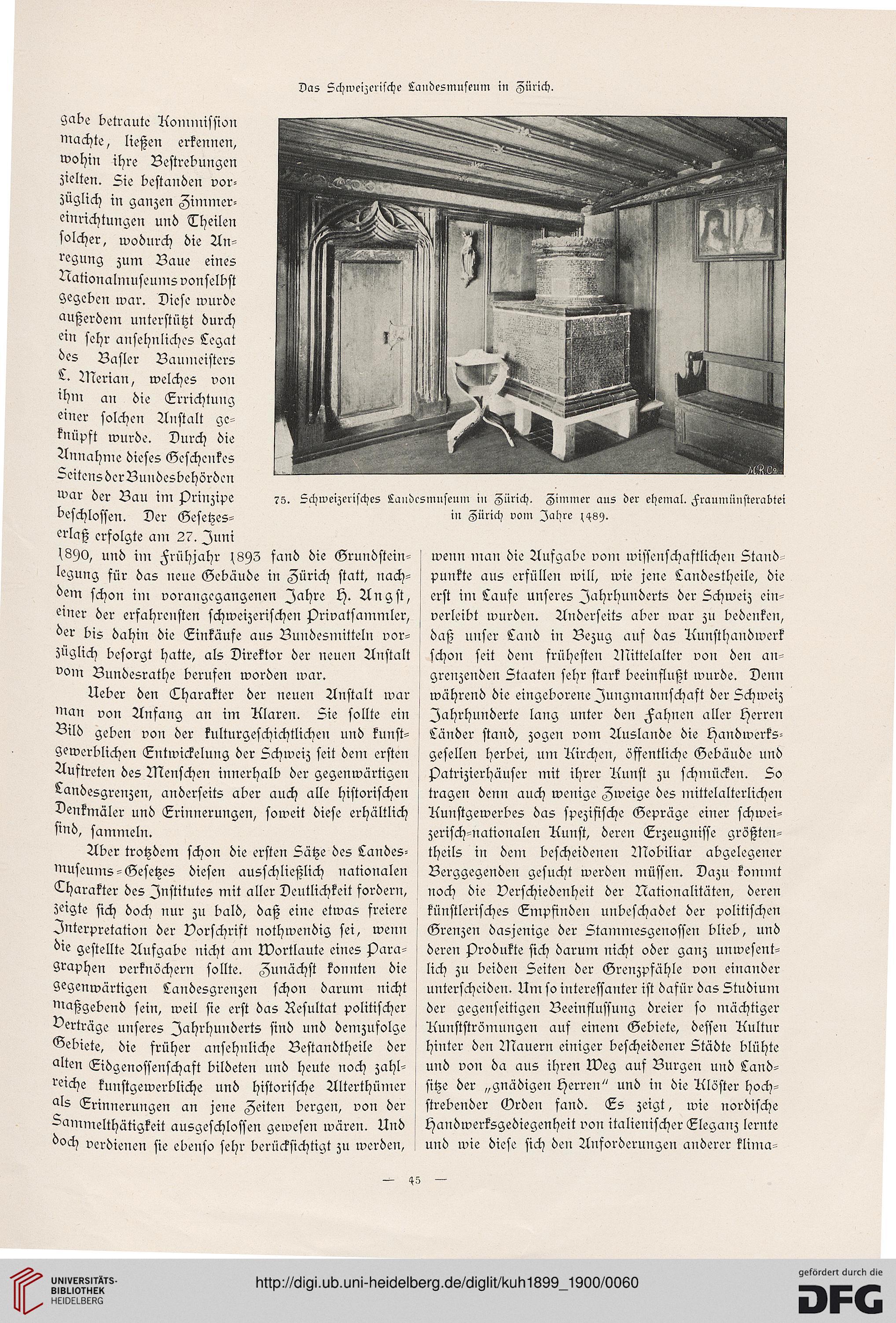Das Schweizerische Laudesmuseum in Zürich.
75. Schweizerisches Landcsmuseum in Zürich. Zimmer aus der ehemal. Fraumünsterabtei
in Zürich vom Jahre
Habe betraute Kommission
machte, ließen erkennen,
wohin ihre Bestrebungen
zielten. Sie bestanden vor-
züglich in ganzen Zimmer-
einrichtungen und Theilen
solcher, wodurch die An-
regung zum Baue eines
Nationalmuseums vonselbst
gegeben war. Diese wurde
außerdem unterstützt durch
ein sehr ansehnliches Legat
öes Basler Baumeisters
Merian, welches von
chm an die Errichtung
einer solchen Anstalt ge-
knüpft wurde. Durch die
Annahme dieses Geschenkes
seitens der Bundesbehörden
war der Bau in: Prinzips
beschlossen. Der Gesetzes-
erlaß erfolgte am 27. Juni
I890, und in: Frühjahr j893 fand die Grundstein-
legung für das neue Gebäude in Zürich statt, nach-
dem schon in: vorangcgangenen Jahre f). A1: g st,
einer der erfahrensten schweizerischen Privatsammler,
der bis dahin die Einkäufe aus Bundesmitteln vor-
züglich besorgt hatte, als Direktor der neuen Anstalt
van: Bundesrathe berufen worden war.
Ueber den Eharakter der neuen Anstalt war
wan von Anfang an in: Klaren. Sie sollte ein
Nild geben von der kulturgeschichtlichen und knnst-
gewerblichen Entwickelung der Schweiz seit den: ersten
Auftreten des Menschen innerhalb der gegenwärtigen
Tandesgrcnzen, anderseits aber auch alle historischen
Denkmäler und Erinnerungen, soweit diese erhältlich
sind, sammeln.
Aber trotzdem schon die ersten Sätze des Landes-
museums - Gesetzes diesen ausschließlich nationalen
Charakter des Institutes mit aller Deutlichkeit fordern,
Zeigte sich doch nur zu bald, daß eine etwas freiere
Interpretation der Vorschrift nothwendig sei, wenn
die gestellte Aufgabe nicht an: Wortlaute eines Para-
graphen verknöchern sollte. Zunächst konnten die
gegenwärtigen Landesgrenzen schon darum nicht
Maßgebend sein, weil sie erst das Resultat politischer
Verträge unseres Jahrhunderts sind und demzufolge
Gebiete, die früher ansehnliche Bestandtheile der
alten Eidgenossenschaft bildeten und heute noch zahl-
reiche kunstgewerbliche und historische Alterthümer
als Erinnerungen an jene Zeiten bergen, von der
-annnelthätigkeit ausgeschlossen gewesen wären. Und
doch verdienen sie ebenso sehr berücksichtigt zu werden,
wenn inan die Aufgabe von: wissenschaftlichen Stand
punkte aus erfüllen will, wie jene Landestheile, die
erst in: Laufe unseres Jahrhunderts der Schweiz ein-
verleibt wurden. Anderseits aber war zu bedenken,
daß unser Land in Bezug aus das Kunsthandwerk
schon seit den: frühesten Mittelalter von den an-
grenzenden Staaten sehr stark beeinflußt wurde. Dein:
während die eingeborene Iungmannschaft der Schweiz
Jahrhunderte lang unter den Fahnen aller Herren
Länder stai:d, zogen vom Auslande die pandwerks-
gesellen herbei, um Kirchen, öffentliche Gebäude und
Patrizierhäuser mit ihrer Kunst zu schmücken. So
tragen denn auch wenige Zweige des mittelalterlichen
Kunstgewerbes das spezifische Gepräge einer schwei-
zerisch-nationalen Kunst, dere:: Erzeugnisse größten-
theils in den: bescheidenen Mobiliar abgelegei:er
Berggegenden gesucht werden müssen. Dazu komii:t
noch die Verschiedenheit der Nationalitäten, deren
künstlerisches Empfinden unbeschadet der politischen
Grenzen dasjenige der Stammesgenossen blieb, und
deren Produkte sich darum nicht oder ganz unwesent-
lich zu beiden Seiten der Grenzpfähle von einander
unterscheiden. An: so interessanter ist dafür das Studiun:
der gegenseitigen Beeinflussung dreier so mächtiger
Kunstströmungen aus einen: Gebiete, dessen Kultur
hinter den Mauern einiger bescheidener Städte blühte
und von da aus ihren Weg auf Burgen und Land-
sitze der „gnädigen Herren" und in die Klöster hoch-
strebender Orden fand. Es zeigt, wie nordische
pandwerksgediegenheit von italienischer Eleganz lernte
und wie diese sich den Anforderungen anderer kliina-
75. Schweizerisches Landcsmuseum in Zürich. Zimmer aus der ehemal. Fraumünsterabtei
in Zürich vom Jahre
Habe betraute Kommission
machte, ließen erkennen,
wohin ihre Bestrebungen
zielten. Sie bestanden vor-
züglich in ganzen Zimmer-
einrichtungen und Theilen
solcher, wodurch die An-
regung zum Baue eines
Nationalmuseums vonselbst
gegeben war. Diese wurde
außerdem unterstützt durch
ein sehr ansehnliches Legat
öes Basler Baumeisters
Merian, welches von
chm an die Errichtung
einer solchen Anstalt ge-
knüpft wurde. Durch die
Annahme dieses Geschenkes
seitens der Bundesbehörden
war der Bau in: Prinzips
beschlossen. Der Gesetzes-
erlaß erfolgte am 27. Juni
I890, und in: Frühjahr j893 fand die Grundstein-
legung für das neue Gebäude in Zürich statt, nach-
dem schon in: vorangcgangenen Jahre f). A1: g st,
einer der erfahrensten schweizerischen Privatsammler,
der bis dahin die Einkäufe aus Bundesmitteln vor-
züglich besorgt hatte, als Direktor der neuen Anstalt
van: Bundesrathe berufen worden war.
Ueber den Eharakter der neuen Anstalt war
wan von Anfang an in: Klaren. Sie sollte ein
Nild geben von der kulturgeschichtlichen und knnst-
gewerblichen Entwickelung der Schweiz seit den: ersten
Auftreten des Menschen innerhalb der gegenwärtigen
Tandesgrcnzen, anderseits aber auch alle historischen
Denkmäler und Erinnerungen, soweit diese erhältlich
sind, sammeln.
Aber trotzdem schon die ersten Sätze des Landes-
museums - Gesetzes diesen ausschließlich nationalen
Charakter des Institutes mit aller Deutlichkeit fordern,
Zeigte sich doch nur zu bald, daß eine etwas freiere
Interpretation der Vorschrift nothwendig sei, wenn
die gestellte Aufgabe nicht an: Wortlaute eines Para-
graphen verknöchern sollte. Zunächst konnten die
gegenwärtigen Landesgrenzen schon darum nicht
Maßgebend sein, weil sie erst das Resultat politischer
Verträge unseres Jahrhunderts sind und demzufolge
Gebiete, die früher ansehnliche Bestandtheile der
alten Eidgenossenschaft bildeten und heute noch zahl-
reiche kunstgewerbliche und historische Alterthümer
als Erinnerungen an jene Zeiten bergen, von der
-annnelthätigkeit ausgeschlossen gewesen wären. Und
doch verdienen sie ebenso sehr berücksichtigt zu werden,
wenn inan die Aufgabe von: wissenschaftlichen Stand
punkte aus erfüllen will, wie jene Landestheile, die
erst in: Laufe unseres Jahrhunderts der Schweiz ein-
verleibt wurden. Anderseits aber war zu bedenken,
daß unser Land in Bezug aus das Kunsthandwerk
schon seit den: frühesten Mittelalter von den an-
grenzenden Staaten sehr stark beeinflußt wurde. Dein:
während die eingeborene Iungmannschaft der Schweiz
Jahrhunderte lang unter den Fahnen aller Herren
Länder stai:d, zogen vom Auslande die pandwerks-
gesellen herbei, um Kirchen, öffentliche Gebäude und
Patrizierhäuser mit ihrer Kunst zu schmücken. So
tragen denn auch wenige Zweige des mittelalterlichen
Kunstgewerbes das spezifische Gepräge einer schwei-
zerisch-nationalen Kunst, dere:: Erzeugnisse größten-
theils in den: bescheidenen Mobiliar abgelegei:er
Berggegenden gesucht werden müssen. Dazu komii:t
noch die Verschiedenheit der Nationalitäten, deren
künstlerisches Empfinden unbeschadet der politischen
Grenzen dasjenige der Stammesgenossen blieb, und
deren Produkte sich darum nicht oder ganz unwesent-
lich zu beiden Seiten der Grenzpfähle von einander
unterscheiden. An: so interessanter ist dafür das Studiun:
der gegenseitigen Beeinflussung dreier so mächtiger
Kunstströmungen aus einen: Gebiete, dessen Kultur
hinter den Mauern einiger bescheidener Städte blühte
und von da aus ihren Weg auf Burgen und Land-
sitze der „gnädigen Herren" und in die Klöster hoch-
strebender Orden fand. Es zeigt, wie nordische
pandwerksgediegenheit von italienischer Eleganz lernte
und wie diese sich den Anforderungen anderer kliina-