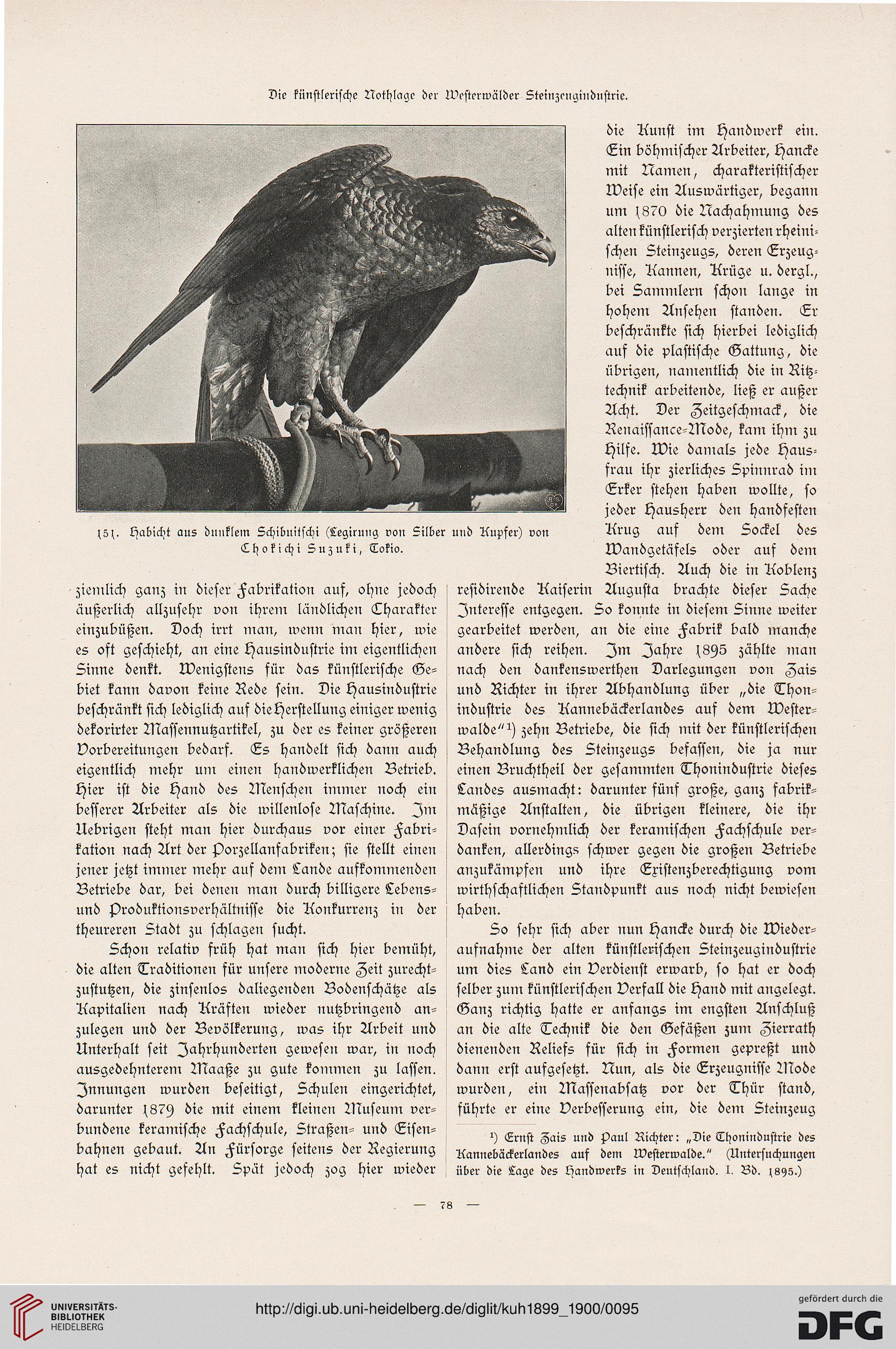Die künstlerische Nothlage der Mesterwälder Zteinzengindnstrie.
;5;. lsabicht aus bnuFfeitt Schibuitschi (Legirnng von Silber und Kupfer) von
Lhokichi Suzuki, Tokio.
ziemlich ganz in dieser Fabrikation auf, ohne jedoch
äußerlich allzusehr von ihrem ländlichen Charakter
einzubüßen. Doch irrt man, wenn man hier, wie
es oft geschieht, an eine Hausindustrie im eigentlichen
Sinne denkt, wenigstens für das künstlerische Ge-
biet kann davon keine Rede sein. Die Hausindustrie
beschränkt sich lediglich auf die Herstellung einiger wenig
dekorirter Massennutzartikel, zu der es keiner größeren
Vorbereitungen bedarf. Cs handelt sich dann auch
eigentlich inehr um einen handwerklichen Betrieb.
Hier ist die Hand des Menschen immer noch ein
besserer Arbeiter als die willenlose Maschine. Im
klebrigen steht man hier durchaus vor einer Fabri-
kation nach Art der Porzellanfabriken; sie stellt eine,:
jener jetzt immer mehr aus dem Lande aufkommenden
Betriebe dar, bei denen man durch billigere Lebens-
und Produktionsverhältnisse die Konkurrenz in der
theureren Stadt zu schlagen sucht.
Schon relativ früh hat man sich hier bemüht,
die alten Traditionen für unsere moderne Zeit zurecht-
zustutzen, die zinsenlos daliegenden Bodenschätze als
Rapitalien nach Rräften wieder nutzbringend an-
zulegen und der Bevölkerung, was ihr Arbeit und
Unterhalt seit Jahrhunderten gewesen war, in noch
ausgedehnterem Ulaaße zu gute kommen zu lassen.
Innungen wurden beseitigt, Schulen eingerichtet,
darunter ^879 die mit einem kleinen Museum ver-
bundene keramische Fachschule, Straßen- und Cisen-
bahnen gebaut. An Fürsorge seitens der Regierung
hat es nicht gefehlt. Spät jedoch zog hier wieder
die Runst im Handwerk ein.
Ein böhniischer Arbeiter, Hancke
niit Namen, charakteristischer
weise ein Auswärtiger, begann
um f870 die Nachahmung des
alten künstlerisch verzierten rheini-
schen Steinzeugs, deren Erzeug-
nisse, Rannen, Rrüge u. dergl.,
bei Sammlern schon lange in
hohem Ansehen standen. Cr
beschränkte sich hierbei lediglich
auf die plastische Gattung, die
übrigen, namentlich die in Ritz-
technik arbeitende, ließ er außer
Acht. Der Zeitgeschmack, die
Renaissance-Mode, kam ihm zu
Hilfe, wie damals jede Haus-
frau ihr zierliches Spinnrad im
Crker stehen haben wollte, so
jeder Hausherr den handfesten
Rrug auf dem Sockel des
Wandgetäfels oder auf dem
Biertisch. Auch die in Roblenz
residirende Raiserin Augusta brachte dieser Sache
Interesse entgegen. So konnte in diesem Sinne weiter
gearbeitet werden, an die eine Fabrik bald manche
andere sich reihen. Im Jahre {8^)5 zählte man
nach den dankenswerthen Darlegungen von Zais
und Richter in ihrer Abhandlung über „die Thon-
industrie des Rannebäckerlandes auf dem Wester-
walds" zehn Betriebe, die sich mit der künstlerischen
Behandlung des Steinzeugs befassen, die ja nur
einen Bruchtheil der gesummten Thonindustrie dieses
Landes ausmacht: darunter fünf große, ganz fabrik-
mäßige Anstalten, die übrigen kleinere, die ihr
Dasein vornehmlich der keramischen Fachschule ver-
danken, allerdings schwer gegen die großen Betriebe
anzukämpsen und ihre Existenzberechtigung vom
wirthschaftlichen Standpunkt aus noch nicht bewiesen
haben.
So sehr sich aber nun Hancke durch die Wieder-
aufnahme der alten künstlerischen Steinzeugindustrie
um dies Land ein Verdienst erwarb, so hat er doch
selber zum künstlerischen Verfall die Hand mit angelegt.
Ganz richtig hatte er anfangs im engsten Anschluß
an die alte Technik die den Gefäßen zum Zierrath
dienenden Reliefs für sich in Formen gepreßt und
dann erst aufgesetzt. Nun, als die Erzeugnisse Mode
wurden, ein Massenabsatz vor der Thür stand,
führte er eine Verbesserung ein, die dem Steinzeug
*) Ernst Zais und Paul Richter: „Die Thonindustrie des
Kannebäckerlandes auf dem Westerwalds." (Untersuchungen
über die Lage des Handwerks in Deutschland. I. Bd. ;8ys.)
78
;5;. lsabicht aus bnuFfeitt Schibuitschi (Legirnng von Silber und Kupfer) von
Lhokichi Suzuki, Tokio.
ziemlich ganz in dieser Fabrikation auf, ohne jedoch
äußerlich allzusehr von ihrem ländlichen Charakter
einzubüßen. Doch irrt man, wenn man hier, wie
es oft geschieht, an eine Hausindustrie im eigentlichen
Sinne denkt, wenigstens für das künstlerische Ge-
biet kann davon keine Rede sein. Die Hausindustrie
beschränkt sich lediglich auf die Herstellung einiger wenig
dekorirter Massennutzartikel, zu der es keiner größeren
Vorbereitungen bedarf. Cs handelt sich dann auch
eigentlich inehr um einen handwerklichen Betrieb.
Hier ist die Hand des Menschen immer noch ein
besserer Arbeiter als die willenlose Maschine. Im
klebrigen steht man hier durchaus vor einer Fabri-
kation nach Art der Porzellanfabriken; sie stellt eine,:
jener jetzt immer mehr aus dem Lande aufkommenden
Betriebe dar, bei denen man durch billigere Lebens-
und Produktionsverhältnisse die Konkurrenz in der
theureren Stadt zu schlagen sucht.
Schon relativ früh hat man sich hier bemüht,
die alten Traditionen für unsere moderne Zeit zurecht-
zustutzen, die zinsenlos daliegenden Bodenschätze als
Rapitalien nach Rräften wieder nutzbringend an-
zulegen und der Bevölkerung, was ihr Arbeit und
Unterhalt seit Jahrhunderten gewesen war, in noch
ausgedehnterem Ulaaße zu gute kommen zu lassen.
Innungen wurden beseitigt, Schulen eingerichtet,
darunter ^879 die mit einem kleinen Museum ver-
bundene keramische Fachschule, Straßen- und Cisen-
bahnen gebaut. An Fürsorge seitens der Regierung
hat es nicht gefehlt. Spät jedoch zog hier wieder
die Runst im Handwerk ein.
Ein böhniischer Arbeiter, Hancke
niit Namen, charakteristischer
weise ein Auswärtiger, begann
um f870 die Nachahmung des
alten künstlerisch verzierten rheini-
schen Steinzeugs, deren Erzeug-
nisse, Rannen, Rrüge u. dergl.,
bei Sammlern schon lange in
hohem Ansehen standen. Cr
beschränkte sich hierbei lediglich
auf die plastische Gattung, die
übrigen, namentlich die in Ritz-
technik arbeitende, ließ er außer
Acht. Der Zeitgeschmack, die
Renaissance-Mode, kam ihm zu
Hilfe, wie damals jede Haus-
frau ihr zierliches Spinnrad im
Crker stehen haben wollte, so
jeder Hausherr den handfesten
Rrug auf dem Sockel des
Wandgetäfels oder auf dem
Biertisch. Auch die in Roblenz
residirende Raiserin Augusta brachte dieser Sache
Interesse entgegen. So konnte in diesem Sinne weiter
gearbeitet werden, an die eine Fabrik bald manche
andere sich reihen. Im Jahre {8^)5 zählte man
nach den dankenswerthen Darlegungen von Zais
und Richter in ihrer Abhandlung über „die Thon-
industrie des Rannebäckerlandes auf dem Wester-
walds" zehn Betriebe, die sich mit der künstlerischen
Behandlung des Steinzeugs befassen, die ja nur
einen Bruchtheil der gesummten Thonindustrie dieses
Landes ausmacht: darunter fünf große, ganz fabrik-
mäßige Anstalten, die übrigen kleinere, die ihr
Dasein vornehmlich der keramischen Fachschule ver-
danken, allerdings schwer gegen die großen Betriebe
anzukämpsen und ihre Existenzberechtigung vom
wirthschaftlichen Standpunkt aus noch nicht bewiesen
haben.
So sehr sich aber nun Hancke durch die Wieder-
aufnahme der alten künstlerischen Steinzeugindustrie
um dies Land ein Verdienst erwarb, so hat er doch
selber zum künstlerischen Verfall die Hand mit angelegt.
Ganz richtig hatte er anfangs im engsten Anschluß
an die alte Technik die den Gefäßen zum Zierrath
dienenden Reliefs für sich in Formen gepreßt und
dann erst aufgesetzt. Nun, als die Erzeugnisse Mode
wurden, ein Massenabsatz vor der Thür stand,
führte er eine Verbesserung ein, die dem Steinzeug
*) Ernst Zais und Paul Richter: „Die Thonindustrie des
Kannebäckerlandes auf dem Westerwalds." (Untersuchungen
über die Lage des Handwerks in Deutschland. I. Bd. ;8ys.)
78