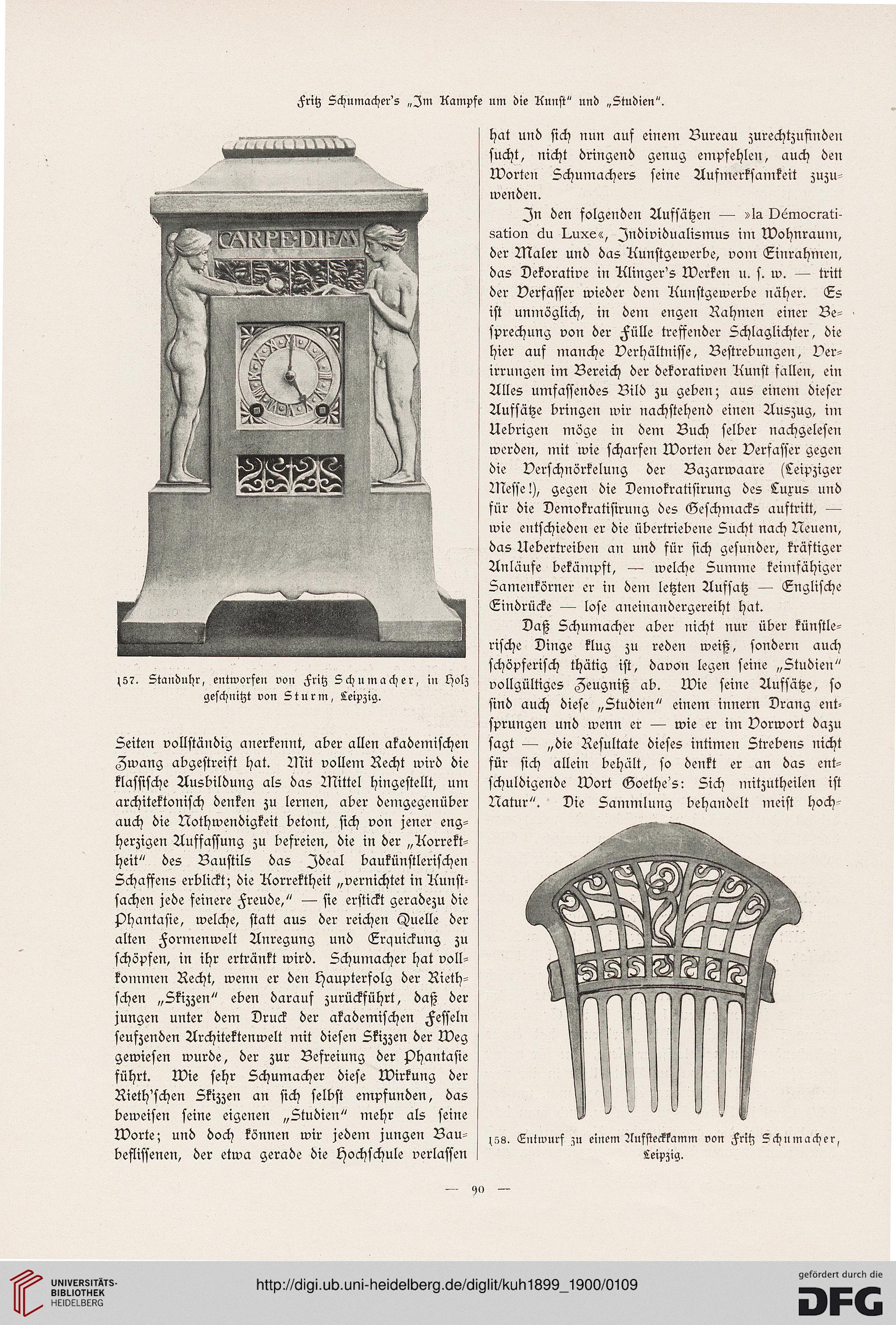Fritz Schumacher's „Im Kampfe um die Kunst" und „Studien".
J57. Standuhr, entworfen von Fritz Schumacher, in kfolz
geschnitzt von Sturm, Leipzig.
Leiten vollständig anerkennt, aber allen akademischen
Zwang abgestreift hat. Mit vollem Recht wird die
klassische Ausbildung als das Mittel hingestellt, um
architektonisch denken zu lernen, aber demgegenüber
auch die Nothwendigkeit betont, sich von jener eng-
herzigen Auffassung zu befreien, die in der „'Korrekt-
heit" des Baustils das Ideal baukünstlerischen
Schaffens erblickt; die Aorrektheit „veritichtet in Kunst -
fachen jede feinere Freude," — sie erstickt geradezu die
Phantasie, welche, statt aus der reichen Quelle der
alten Formsnwelt Anregung und Erquickung zu
schöpfen, in ihr ertränkt wird. Schumacher hat voll-
kommen Recht, wenn er den Paupterfolg der Rieth-
schen „Skizzen" eben darauf zurückführt, daß der
jungen unter dem Druck der akademischen Fesseln
seufzenden Architektenwelt mit diesen Skizzen der Weg
gewiesen wurde, der zur Befreiung der Phantasie
führt. Wie sehr Schumacher diese Wirkung der
Rieth'schen Skizzen an sich selbst empfunden, das
beweisen seine eigenen „Studien" mehr als seine
Worte; und doch können wir jedem jungen Bau-
beflissenen, der etwa gerade die Hochschule verlassen
hat und sich nun auf einein Bureau zurechtzusinden
sucht, nicht dringend genug empfehlen, auch den
Worten Schumachers seine Aufmerksamkeit zuzu
wenden.
Zn den folgenden Aufsätzen — »la Democrati-
sation du Luxe«, Individualismus im Wohnraum,
der Maler und das Kunstgewerbe, vom Einrahmen,
das Dekorative in Klinger's Werken u. s. w. — tritt
der Verfasser wieder dem Kunstgewerbe näher. Es
ist uninöglich, in dein engen Rahnien einer Be-
sprechung von der Fülle treffender Schlaglichter, die
hier auf manche Verhältnisse, Bestrebungen, Ver-
irrungen im Bereich der dekorativen Kunst fallen, ein
Alles umfassendes Bild zu geben; aus einem dieser
Aufsätze bringen wir iiachstehend einen Auszug, im
Uebrigen möge in dem Buch selber nachgelesen
werden, mit wie scharfeii Worteii der Verfasser gegen
die Verschnörkelung der Bazarwaare (Leipziger
Messel), gegen die Demokratisirung des Luxus uiid
für die Demokratisiruiig des Geschmacks auftritt, —
wie entschieden er die übertriebene Sucht nach Neuem,
das Uebertreiben an und für sich gesunder, kräftiger
Anläufe bekämpft, — welche Summe keimfähiger
Samenkörner er in dem letzten Aufsatz — Englische
Eindrücke — lose aneinandergereiht hat.
Daß Schumacher aber nicht nur über künstle-
rische Dinge klug zu reden weiß, sondern auch
schöpferisch thätig ist, davon legen seine „Studien"
vollgültiges Zeugniß ab. Wie feine Aufsätze, so
sind auch diese „Studien" einem innern Drang ent-
sprungen und wenn er — wie er im Vorwort dazu
sagt ■— „die Resultate dieses intimen Strebens nicht
für sich allein behält, so denkt er an das ent-
schuldigende Wort Goethe's: Sich mitzutheilen ist
Natur". Die Sammlung behandelt meist hoch-
;58. Entwurf zu einem Aufsteckkamm von Fritz Schumacher,
Leipzig.
yn
J57. Standuhr, entworfen von Fritz Schumacher, in kfolz
geschnitzt von Sturm, Leipzig.
Leiten vollständig anerkennt, aber allen akademischen
Zwang abgestreift hat. Mit vollem Recht wird die
klassische Ausbildung als das Mittel hingestellt, um
architektonisch denken zu lernen, aber demgegenüber
auch die Nothwendigkeit betont, sich von jener eng-
herzigen Auffassung zu befreien, die in der „'Korrekt-
heit" des Baustils das Ideal baukünstlerischen
Schaffens erblickt; die Aorrektheit „veritichtet in Kunst -
fachen jede feinere Freude," — sie erstickt geradezu die
Phantasie, welche, statt aus der reichen Quelle der
alten Formsnwelt Anregung und Erquickung zu
schöpfen, in ihr ertränkt wird. Schumacher hat voll-
kommen Recht, wenn er den Paupterfolg der Rieth-
schen „Skizzen" eben darauf zurückführt, daß der
jungen unter dem Druck der akademischen Fesseln
seufzenden Architektenwelt mit diesen Skizzen der Weg
gewiesen wurde, der zur Befreiung der Phantasie
führt. Wie sehr Schumacher diese Wirkung der
Rieth'schen Skizzen an sich selbst empfunden, das
beweisen seine eigenen „Studien" mehr als seine
Worte; und doch können wir jedem jungen Bau-
beflissenen, der etwa gerade die Hochschule verlassen
hat und sich nun auf einein Bureau zurechtzusinden
sucht, nicht dringend genug empfehlen, auch den
Worten Schumachers seine Aufmerksamkeit zuzu
wenden.
Zn den folgenden Aufsätzen — »la Democrati-
sation du Luxe«, Individualismus im Wohnraum,
der Maler und das Kunstgewerbe, vom Einrahmen,
das Dekorative in Klinger's Werken u. s. w. — tritt
der Verfasser wieder dem Kunstgewerbe näher. Es
ist uninöglich, in dein engen Rahnien einer Be-
sprechung von der Fülle treffender Schlaglichter, die
hier auf manche Verhältnisse, Bestrebungen, Ver-
irrungen im Bereich der dekorativen Kunst fallen, ein
Alles umfassendes Bild zu geben; aus einem dieser
Aufsätze bringen wir iiachstehend einen Auszug, im
Uebrigen möge in dem Buch selber nachgelesen
werden, mit wie scharfeii Worteii der Verfasser gegen
die Verschnörkelung der Bazarwaare (Leipziger
Messel), gegen die Demokratisirung des Luxus uiid
für die Demokratisiruiig des Geschmacks auftritt, —
wie entschieden er die übertriebene Sucht nach Neuem,
das Uebertreiben an und für sich gesunder, kräftiger
Anläufe bekämpft, — welche Summe keimfähiger
Samenkörner er in dem letzten Aufsatz — Englische
Eindrücke — lose aneinandergereiht hat.
Daß Schumacher aber nicht nur über künstle-
rische Dinge klug zu reden weiß, sondern auch
schöpferisch thätig ist, davon legen seine „Studien"
vollgültiges Zeugniß ab. Wie feine Aufsätze, so
sind auch diese „Studien" einem innern Drang ent-
sprungen und wenn er — wie er im Vorwort dazu
sagt ■— „die Resultate dieses intimen Strebens nicht
für sich allein behält, so denkt er an das ent-
schuldigende Wort Goethe's: Sich mitzutheilen ist
Natur". Die Sammlung behandelt meist hoch-
;58. Entwurf zu einem Aufsteckkamm von Fritz Schumacher,
Leipzig.
yn