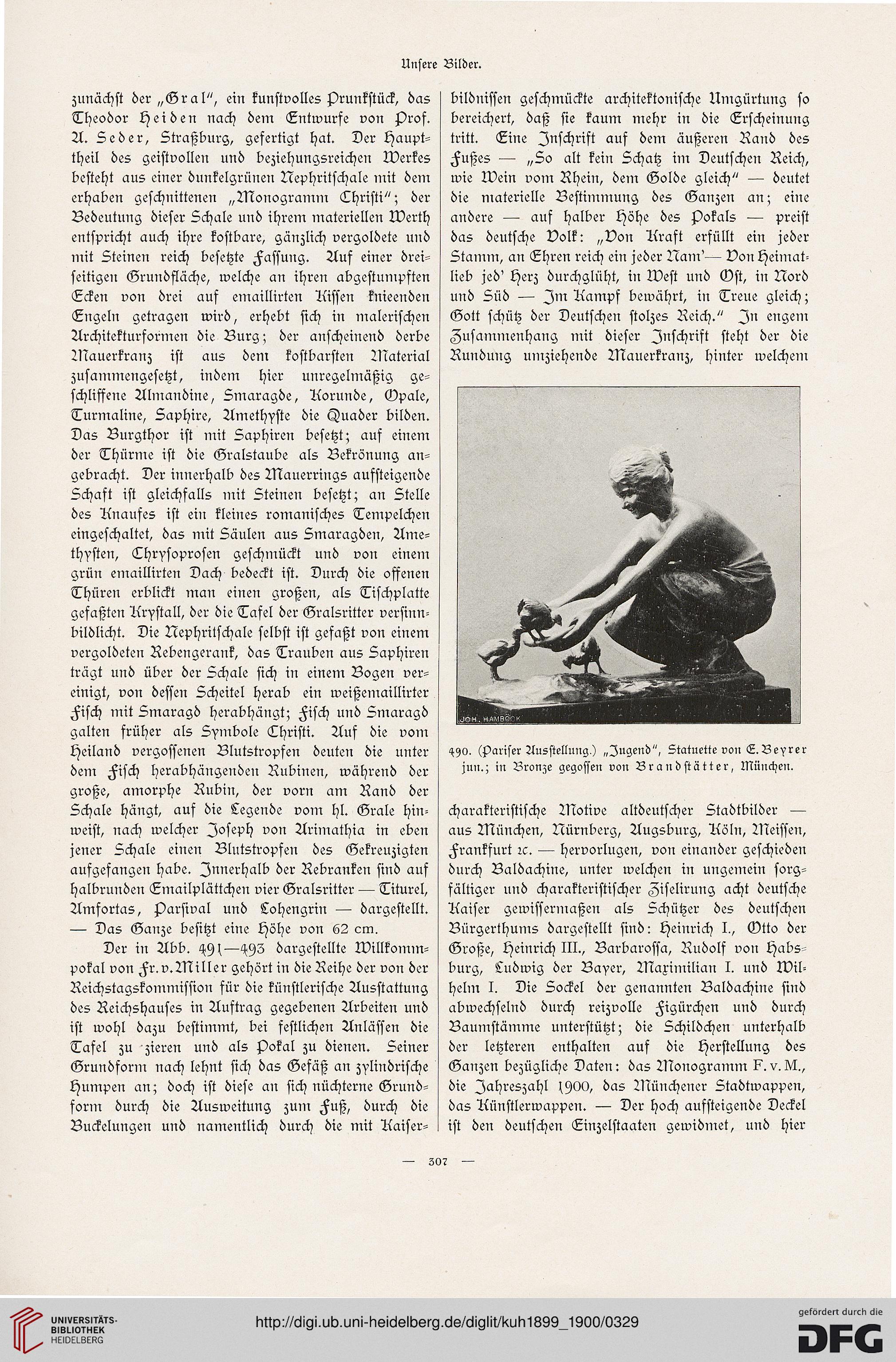Unsere Bilder.
zunächst der „Gral", ein kunstvolles Prunkstück, das
Theodor Heiden nach dem Entwurfs von Prof.
A. Seder, Straßburg, gefertigt hat. Der Haupt-
theil des geistvollen und beziehungsreichen Werkes
besteht aus einer dunkelgrünen Nephritschale mit dem
erhaben geschnittenen „Monogramm Thristi"; der
Bedeutung dieser Schale und ihrem materiellen Werth
entspricht auch ihre kostbare, gänzlich vergoldete und
mit Steinen reich besetzte Fassung. Auf einer drei-
seitigen Grundfläche, welche an ihren abgestumpften
Ecken von drei auf emaillirten Kissen knieenden
Engeln getragen wird, erhebt sich in malerischen
Architekturformen die Burg; der anscheinend derbe
Mauerkranz ist aus dem kostbarsten Material
zusammengesetzt, indem hier unregelmäßig ge-
schliffene Almandine, Smaragde, Korunde, Bpale,
Turmaline, Saphire, Amethyste die Quader bilden.
Das Burgthor ist mit Saphiren besetzt; auf einem
der Thürme ist die Gralstaube als Bekrönung an-
gebracht. Der innerhalb des Mauerrings aufsteigende
Schaft ist gleichfalls mit Steinen besetzt; an Stelle
des Knaufes ist ein kleines romanisches Tempelchen
eingeschaltet, das mit Säulen aus Smaragden, Ame-
thysten, Lhrysoprosen geschmückt und von einem
grün emaillirten Dach bedeckt ist. Durch die offenen
Thören erblickt man einen großen, als Tischplatte
gefaßten Krystall, der die Tafel der Gralsritter versinn-
bildlicht. Die Nephritschale selbst ist gefaßt von einem
vergoldeten Rebengerank, das Trauben aus Saphiren
trägt und über der Schale sich in einem Bogen ver-
einigt, von dessen Scheitel herab ein weißemaillirter
Fisch mit Smaragd herabhängt; Fisch und Smaragd
galten früher als Symbole Thristi. Auf die vom
Heiland vergossenen Blutstropfen deuten die unter
dem Fisch herabhängenden Rubinen, während der
große, amorphe Rubin, der vorn am Rand der
Schale hängt, auf die Legende vom HI. Grale hin-
weist, nach welcher Joseph von Arimathia in eben
jener Schale einen Blutstropfen des Gekreuzigten
aufgefangen habe. Innerhalb der Rebranken sind auf
halbrunden Emailplättchen vier Gralsritter ■— Titurel,
Amfortas, parsival und Lohengrin — dargestellt.
— Das Ganze besitzt eine Höhe von 62 cm.
Der in Abb. —HstZ dargestellte Willkomm-
pokal von Fr. v.Miller gehört in die Reihe der von der
Reichstagskommission für die künstlerische Ausstattung
des Reichshauses in Auftrag gegebenen Arbeiten und
ist wohl dazu bestimmt, bei festlichen Anlässen die
Tafel zu zieren und als Pokal zu dienen. Seiner
Grundform nach lehnt sich das Gefäß an zylindrische
Lumpen an; doch ist diese an sich nüchterne Grund-
form durch die Ausweitung zum Fuß, durch die
Buckelungen und namentlich durch die mit Kaiser-
bildnissen geschmückte architektonische Nmgürtung so
bereichert, daß sie kaum mehr in die Erscheinung
tritt. Eine Inschrift auf dem äußeren Rand des
Fußes — „So alt kein Schatz im Deutschen Reich,
wie Wein vom Rhein, dem Golde gleich" — deutet
die materielle Bestimmung des Ganzen an; eine
andere — auf halber Höhe des Pokals — preist
das deutsche Volk: „Bon Kraft erfüllt ein jeder
Stamm, an Ehren reich ein jeder Nam'— Von Heimat-
lieb jed' Herz durchglüht, iu West und Bst, in Nord
und Süd — Im Kampf bewährt, in Treue gleich;
Gott schütz der Deutschen stolzes Reich." In engein
Zusammenhang mit dieser Inschrift steht der die
Rundung uinziehende Mauerkranz, hinter welchem
490. (pariser Ausstellung.) „Jugend", Statuette von L.Beyrer
juu.; in Bronze gegossen von Brand st ätter, München.
charakteristische Motive altdeutscher Stadtbilder —
aus München, Nürnberg, Augsburg, Köln, Meissen,
Frankfurt rc. — hervorlugen, von einander geschieden
durch Baldachine, unter welchen in ungemein sorg-
fältiger und charakteristischer Ziselirung acht deutsche
Kaiser gewissermaßen als Schützer des deutschen
Bürgerthums dargestellt sind: Heinrich I., Btto der
Große, Heinrich III., Barbarossa, Rudolf von Habs-
burg, Ludwig der Bayer, Maximilian I. und Wil-
helm I. Die Sockel der genannten Baldachine sind
abwechselnd durch reizvolle Figürchen und durch
Baumstämme unterstützt; die Schildchen unterhalb
der letzteren enthalten auf die Herstellung des
Ganzen bezügliche Daten: das Monogramm F. v.M.,
die Jahreszahl fßOO, das Münchener Stadtwappen,
das Künstlerwappen. — Der hoch aufsteigende Deckel
ist den deutschen Einzelstaaten gewidmet, und hier
307
zunächst der „Gral", ein kunstvolles Prunkstück, das
Theodor Heiden nach dem Entwurfs von Prof.
A. Seder, Straßburg, gefertigt hat. Der Haupt-
theil des geistvollen und beziehungsreichen Werkes
besteht aus einer dunkelgrünen Nephritschale mit dem
erhaben geschnittenen „Monogramm Thristi"; der
Bedeutung dieser Schale und ihrem materiellen Werth
entspricht auch ihre kostbare, gänzlich vergoldete und
mit Steinen reich besetzte Fassung. Auf einer drei-
seitigen Grundfläche, welche an ihren abgestumpften
Ecken von drei auf emaillirten Kissen knieenden
Engeln getragen wird, erhebt sich in malerischen
Architekturformen die Burg; der anscheinend derbe
Mauerkranz ist aus dem kostbarsten Material
zusammengesetzt, indem hier unregelmäßig ge-
schliffene Almandine, Smaragde, Korunde, Bpale,
Turmaline, Saphire, Amethyste die Quader bilden.
Das Burgthor ist mit Saphiren besetzt; auf einem
der Thürme ist die Gralstaube als Bekrönung an-
gebracht. Der innerhalb des Mauerrings aufsteigende
Schaft ist gleichfalls mit Steinen besetzt; an Stelle
des Knaufes ist ein kleines romanisches Tempelchen
eingeschaltet, das mit Säulen aus Smaragden, Ame-
thysten, Lhrysoprosen geschmückt und von einem
grün emaillirten Dach bedeckt ist. Durch die offenen
Thören erblickt man einen großen, als Tischplatte
gefaßten Krystall, der die Tafel der Gralsritter versinn-
bildlicht. Die Nephritschale selbst ist gefaßt von einem
vergoldeten Rebengerank, das Trauben aus Saphiren
trägt und über der Schale sich in einem Bogen ver-
einigt, von dessen Scheitel herab ein weißemaillirter
Fisch mit Smaragd herabhängt; Fisch und Smaragd
galten früher als Symbole Thristi. Auf die vom
Heiland vergossenen Blutstropfen deuten die unter
dem Fisch herabhängenden Rubinen, während der
große, amorphe Rubin, der vorn am Rand der
Schale hängt, auf die Legende vom HI. Grale hin-
weist, nach welcher Joseph von Arimathia in eben
jener Schale einen Blutstropfen des Gekreuzigten
aufgefangen habe. Innerhalb der Rebranken sind auf
halbrunden Emailplättchen vier Gralsritter ■— Titurel,
Amfortas, parsival und Lohengrin — dargestellt.
— Das Ganze besitzt eine Höhe von 62 cm.
Der in Abb. —HstZ dargestellte Willkomm-
pokal von Fr. v.Miller gehört in die Reihe der von der
Reichstagskommission für die künstlerische Ausstattung
des Reichshauses in Auftrag gegebenen Arbeiten und
ist wohl dazu bestimmt, bei festlichen Anlässen die
Tafel zu zieren und als Pokal zu dienen. Seiner
Grundform nach lehnt sich das Gefäß an zylindrische
Lumpen an; doch ist diese an sich nüchterne Grund-
form durch die Ausweitung zum Fuß, durch die
Buckelungen und namentlich durch die mit Kaiser-
bildnissen geschmückte architektonische Nmgürtung so
bereichert, daß sie kaum mehr in die Erscheinung
tritt. Eine Inschrift auf dem äußeren Rand des
Fußes — „So alt kein Schatz im Deutschen Reich,
wie Wein vom Rhein, dem Golde gleich" — deutet
die materielle Bestimmung des Ganzen an; eine
andere — auf halber Höhe des Pokals — preist
das deutsche Volk: „Bon Kraft erfüllt ein jeder
Stamm, an Ehren reich ein jeder Nam'— Von Heimat-
lieb jed' Herz durchglüht, iu West und Bst, in Nord
und Süd — Im Kampf bewährt, in Treue gleich;
Gott schütz der Deutschen stolzes Reich." In engein
Zusammenhang mit dieser Inschrift steht der die
Rundung uinziehende Mauerkranz, hinter welchem
490. (pariser Ausstellung.) „Jugend", Statuette von L.Beyrer
juu.; in Bronze gegossen von Brand st ätter, München.
charakteristische Motive altdeutscher Stadtbilder —
aus München, Nürnberg, Augsburg, Köln, Meissen,
Frankfurt rc. — hervorlugen, von einander geschieden
durch Baldachine, unter welchen in ungemein sorg-
fältiger und charakteristischer Ziselirung acht deutsche
Kaiser gewissermaßen als Schützer des deutschen
Bürgerthums dargestellt sind: Heinrich I., Btto der
Große, Heinrich III., Barbarossa, Rudolf von Habs-
burg, Ludwig der Bayer, Maximilian I. und Wil-
helm I. Die Sockel der genannten Baldachine sind
abwechselnd durch reizvolle Figürchen und durch
Baumstämme unterstützt; die Schildchen unterhalb
der letzteren enthalten auf die Herstellung des
Ganzen bezügliche Daten: das Monogramm F. v.M.,
die Jahreszahl fßOO, das Münchener Stadtwappen,
das Künstlerwappen. — Der hoch aufsteigende Deckel
ist den deutschen Einzelstaaten gewidmet, und hier
307