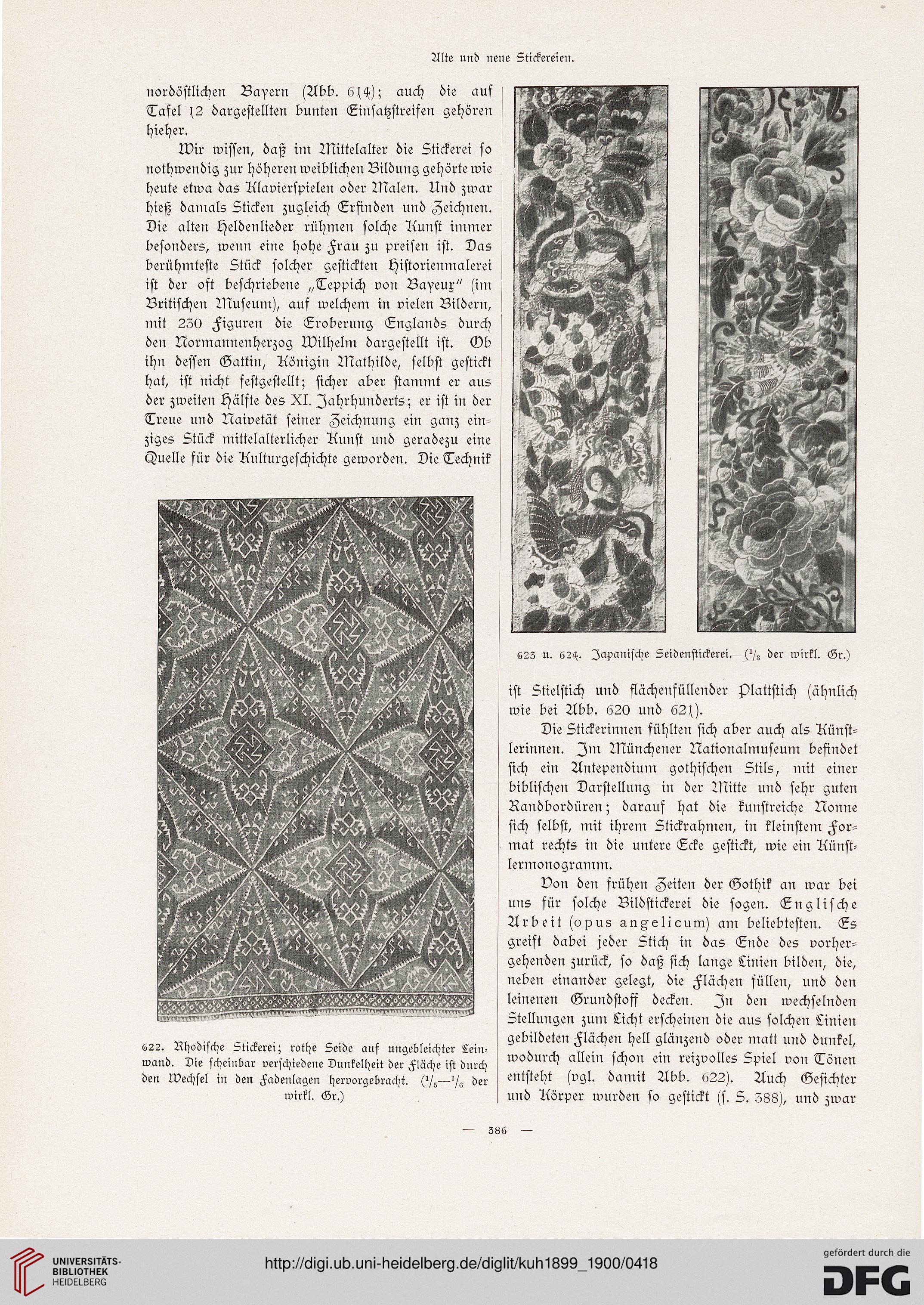Alte und neue Stickereien.
nordöstlichen Bayern (Abb. 6^); auch die auf
Tafel \2 dargestellten bunten Eiusatzstreifen gehören
hieher.
Wir wissen, daß in: Wittelalter die Stickerei so
nothwendig zur höheren weiblichen Bildung gehörte wie
heute etwa das Klavierspielen oder Walen. Und zwar
hieß dainals Lücken zugleich Erfinden und Zeichnen.
Die alten Heldenlieder rühmen solche Kunst immer
besonders, wenn eine hohe Frau zu preisen ist. Das
berühmteste Stück solcher gestickten Historienmalerei
ist der oft beschriebene „Teppich von Bayeux" (im
Britischen Wuseum), auf welchem in vielen Bildern,
mit 230 Figuren die Eroberung Englands durch
den Normannenherzog Wilhelm dargestellt ist. Gb
ihn dessen Gattin, Königin Wathilde, selbst gestickt
hat, ist nicht festgestellt; sicher aber stammt er aus
der zweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts; er ist in der
Treue und Naivetät seiner Zeichnung ein ganz ein-
ziges Stück mittelalterlicher Kunst und geradezu eine
Quelle für die Kulturgeschichte geworden. Die Technik
622. Rhodische Stickerei; rothe Seide aus ungebleichter Lein-
wand. Die scheinbar verschiedene Dunkelheit der Fläche ist durch
den Wechsel in den Fadenlagen hervorgebracht. (Hz—der
wirkt. Gr.)
623 u. S2H. Japanische Seidenstickerei. (Hz der wirkl. Gr.)
ist Stielstich und flächenfüllender Plattstich (ähnlich
wie bei Abb. 620 und 62s).
Die Stickerinnen fühlten sich aber auch als Künst-
lerinnen. Zn: Wünchener Nationalmuseum befindet
sich ein Antependium gothischen Stils, mit einer
biblischen Darstellung in der Witte und sehr guten
Randbordüren; darauf hat die kunstreiche Nonne
sich selbst, mit ihrem Stickrahmen, in kleinstem For-
mat rechts in die untere Ecke gestickt, wie ein Künst-
lermonogramm.
Bon den frühen Zeiten der Gothik an war bei
uns für solche Bildstickerei die sogen. Englische
Arbeit (opus angelicum) am beliebtesten. Es
greift dabei jeder Stich in das Ende des vorher-
gehenden zurück, so daß sich lange Linien bilden, die,
neben einander gelegt, die Flächei: füllen, und den
leinenen Grundstoff decken. Zn den wechselnden
Stellungen zun: Licht erscheinen die aus solchen Linien
gebildeten Flächen hell glänzend oder matt und dunkel,
wodurch allein schon ein reizvolles Spiel von Tönen
entsteht (vgl. damit Abb. 622). Auch Gesichter
und Körper wurden so gestickt (s. 5. 388), und zwar
286
nordöstlichen Bayern (Abb. 6^); auch die auf
Tafel \2 dargestellten bunten Eiusatzstreifen gehören
hieher.
Wir wissen, daß in: Wittelalter die Stickerei so
nothwendig zur höheren weiblichen Bildung gehörte wie
heute etwa das Klavierspielen oder Walen. Und zwar
hieß dainals Lücken zugleich Erfinden und Zeichnen.
Die alten Heldenlieder rühmen solche Kunst immer
besonders, wenn eine hohe Frau zu preisen ist. Das
berühmteste Stück solcher gestickten Historienmalerei
ist der oft beschriebene „Teppich von Bayeux" (im
Britischen Wuseum), auf welchem in vielen Bildern,
mit 230 Figuren die Eroberung Englands durch
den Normannenherzog Wilhelm dargestellt ist. Gb
ihn dessen Gattin, Königin Wathilde, selbst gestickt
hat, ist nicht festgestellt; sicher aber stammt er aus
der zweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts; er ist in der
Treue und Naivetät seiner Zeichnung ein ganz ein-
ziges Stück mittelalterlicher Kunst und geradezu eine
Quelle für die Kulturgeschichte geworden. Die Technik
622. Rhodische Stickerei; rothe Seide aus ungebleichter Lein-
wand. Die scheinbar verschiedene Dunkelheit der Fläche ist durch
den Wechsel in den Fadenlagen hervorgebracht. (Hz—der
wirkt. Gr.)
623 u. S2H. Japanische Seidenstickerei. (Hz der wirkl. Gr.)
ist Stielstich und flächenfüllender Plattstich (ähnlich
wie bei Abb. 620 und 62s).
Die Stickerinnen fühlten sich aber auch als Künst-
lerinnen. Zn: Wünchener Nationalmuseum befindet
sich ein Antependium gothischen Stils, mit einer
biblischen Darstellung in der Witte und sehr guten
Randbordüren; darauf hat die kunstreiche Nonne
sich selbst, mit ihrem Stickrahmen, in kleinstem For-
mat rechts in die untere Ecke gestickt, wie ein Künst-
lermonogramm.
Bon den frühen Zeiten der Gothik an war bei
uns für solche Bildstickerei die sogen. Englische
Arbeit (opus angelicum) am beliebtesten. Es
greift dabei jeder Stich in das Ende des vorher-
gehenden zurück, so daß sich lange Linien bilden, die,
neben einander gelegt, die Flächei: füllen, und den
leinenen Grundstoff decken. Zn den wechselnden
Stellungen zun: Licht erscheinen die aus solchen Linien
gebildeten Flächen hell glänzend oder matt und dunkel,
wodurch allein schon ein reizvolles Spiel von Tönen
entsteht (vgl. damit Abb. 622). Auch Gesichter
und Körper wurden so gestickt (s. 5. 388), und zwar
286