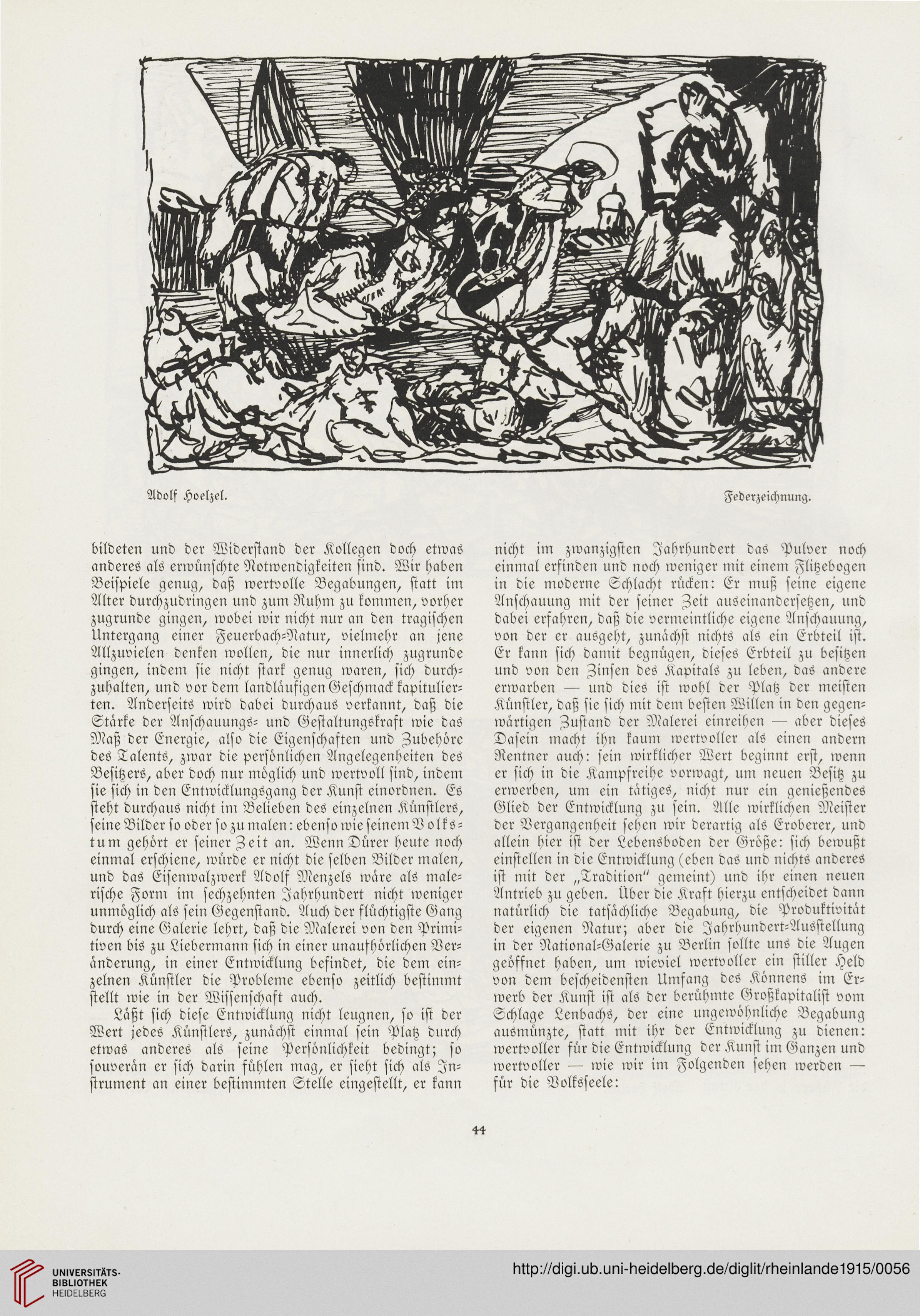Adolf Hoelzel.
Federzeichnung.
bildeten und der Widerstand der Kollegen doch etwas
anderes als erwünschte Notwendigkeiten sind. Wir haben
Beispiele genug, daß wertvolle Begabungen, statt inr
Alter durchzudringen und zum Ruhm zu kommen, vorher
zugrunde gingen, wobei wir nicht nur an den tragischen
Untergang einer Feuerbach-Natur, vielmehr an jene
Allzuvielen denken wollen, die nur innerlich zugrunde
gingen, indem sie nicht stark genug waren, sich durch-
zuhalten, und vor dem landläufigen Geschmack kapitulier-
ten. Anderseits wird dabei durchaus verkannt, daß die
Starke der Anschauungs- und Gestaltungskraft wie das
Maß der Energie, also die Eigenschaften und Aubehöre
des Talents, zwar die persönlichen Angelegenheiten des
Besitzers, aber doch nur möglich und wertvoll sind, indem
sie sich in den Entwicklungsgang der Kunst einordnen. Es
steht durchaus nicht im Belieben des einzelnen Künstlers,
seineBilder so oder sozumalen: ebenso wieseinemV olkö-
tum gehört er seiner Aeit an. Wenn Dürer heute noch
einmal erschiene, würde er nicht die selben Bilder malen,
und das Eisenwalzwerk Adolf Menzels ware als male-
rische Form im sechzehnten Jahrhundert nicht weniger
unmöglich als sein Gegenstand. Auch der slüchtigste Gang
durch eine Galerie lehrt, daß die Malerei von den Primi-
tiven bis zu Liebermann sich in einer unaufhörlichen Ver-
änderung, in einer Entwicklung befindet, die dem ein-
zelnen Künstler die Probleme ebenso zeitlich bestimmt
stellt wie in der Wissenschaft auch.
Läßt sich diese Entwicklung nicht leugnen, so ist der
Wert jedes Künstlers, zunachst einmal sein Platz durch
etwas anderes als seine Persönlichkeit bedingt; so
souverän er sich darin fühlen mag, er sieht sich als Jn-
strument an einer bestimmten Stelle eingestellt, er kann
nicht im zwanzigsten Jahrhundert das Pulver noch
einmal erfinden und noch weniger mit einem Flitzebogen
in die moderne Schlacht rücken: Er muß seine eigene
Anschauung mit der seiner Aeit auseinandersetzen, und
dabei erfahren, daß die vermeintliche eigene Anschauung,
von der er ausgeht, zunächst nichts als ein Erbteil ist.
Er kann sich damit begnügen, dieses Erbteil zu besitzen
und von den Ainsen des Kapitals zu leben, das andere
erwarben — und dies ist wohl der Platz der meisten
Künstler, daß sie sich mit dem besten Willen in den gegen-
wärtigen Iustand der Malerei einreihen — aber dieses
Dasein macht ihn kaum wertvoller als einen andern
Rentner auch: sein wirklicher Wert beginnt erst, wenn
er sich in die Kampfreihe vorwagt, um neuen Besitz zu
erwerben, um ein tätiges, nicht nur ein genießendes
Glied der Entwicklung zu sein. Alle wirklichen Meister
der Vergangenheit sehen wir derartig als Eroberer, und
allein hier ist der Lebensboden der Größe: sich bewußt
einstellen in die Entwicklung (eben das und nichts anderes
ist mit der „Tradition" gemeint) und ihr einen neuen
Antrieb zu geben. Über die Kraft hierzu entscheidet dann
natürlich die tatsächliche Begabung, die Produktivitat
der eigenen Natur; aber die Jahrhundert-Ausstellung
in der National-Galerie zu Berlin sollte uns die Augen
geöffnet haben, um wieviel wertvoller ein stiller Held
von dem bescheidensten Umfang des Könnens im Er-
werb der Kunst ist als der berühmte Großkapitalist vom
Schlage Lenbachs, der eine ungewöhnliche Begabung
ausmünzte, statt mit ihr der Entwicklung zu dienen:
wertvoller sür die Entwicklung der Kunst im Ganzen und
wertvoller — wie wir im Folgenden sehen werden —
für die Volksseele:
44
Federzeichnung.
bildeten und der Widerstand der Kollegen doch etwas
anderes als erwünschte Notwendigkeiten sind. Wir haben
Beispiele genug, daß wertvolle Begabungen, statt inr
Alter durchzudringen und zum Ruhm zu kommen, vorher
zugrunde gingen, wobei wir nicht nur an den tragischen
Untergang einer Feuerbach-Natur, vielmehr an jene
Allzuvielen denken wollen, die nur innerlich zugrunde
gingen, indem sie nicht stark genug waren, sich durch-
zuhalten, und vor dem landläufigen Geschmack kapitulier-
ten. Anderseits wird dabei durchaus verkannt, daß die
Starke der Anschauungs- und Gestaltungskraft wie das
Maß der Energie, also die Eigenschaften und Aubehöre
des Talents, zwar die persönlichen Angelegenheiten des
Besitzers, aber doch nur möglich und wertvoll sind, indem
sie sich in den Entwicklungsgang der Kunst einordnen. Es
steht durchaus nicht im Belieben des einzelnen Künstlers,
seineBilder so oder sozumalen: ebenso wieseinemV olkö-
tum gehört er seiner Aeit an. Wenn Dürer heute noch
einmal erschiene, würde er nicht die selben Bilder malen,
und das Eisenwalzwerk Adolf Menzels ware als male-
rische Form im sechzehnten Jahrhundert nicht weniger
unmöglich als sein Gegenstand. Auch der slüchtigste Gang
durch eine Galerie lehrt, daß die Malerei von den Primi-
tiven bis zu Liebermann sich in einer unaufhörlichen Ver-
änderung, in einer Entwicklung befindet, die dem ein-
zelnen Künstler die Probleme ebenso zeitlich bestimmt
stellt wie in der Wissenschaft auch.
Läßt sich diese Entwicklung nicht leugnen, so ist der
Wert jedes Künstlers, zunachst einmal sein Platz durch
etwas anderes als seine Persönlichkeit bedingt; so
souverän er sich darin fühlen mag, er sieht sich als Jn-
strument an einer bestimmten Stelle eingestellt, er kann
nicht im zwanzigsten Jahrhundert das Pulver noch
einmal erfinden und noch weniger mit einem Flitzebogen
in die moderne Schlacht rücken: Er muß seine eigene
Anschauung mit der seiner Aeit auseinandersetzen, und
dabei erfahren, daß die vermeintliche eigene Anschauung,
von der er ausgeht, zunächst nichts als ein Erbteil ist.
Er kann sich damit begnügen, dieses Erbteil zu besitzen
und von den Ainsen des Kapitals zu leben, das andere
erwarben — und dies ist wohl der Platz der meisten
Künstler, daß sie sich mit dem besten Willen in den gegen-
wärtigen Iustand der Malerei einreihen — aber dieses
Dasein macht ihn kaum wertvoller als einen andern
Rentner auch: sein wirklicher Wert beginnt erst, wenn
er sich in die Kampfreihe vorwagt, um neuen Besitz zu
erwerben, um ein tätiges, nicht nur ein genießendes
Glied der Entwicklung zu sein. Alle wirklichen Meister
der Vergangenheit sehen wir derartig als Eroberer, und
allein hier ist der Lebensboden der Größe: sich bewußt
einstellen in die Entwicklung (eben das und nichts anderes
ist mit der „Tradition" gemeint) und ihr einen neuen
Antrieb zu geben. Über die Kraft hierzu entscheidet dann
natürlich die tatsächliche Begabung, die Produktivitat
der eigenen Natur; aber die Jahrhundert-Ausstellung
in der National-Galerie zu Berlin sollte uns die Augen
geöffnet haben, um wieviel wertvoller ein stiller Held
von dem bescheidensten Umfang des Könnens im Er-
werb der Kunst ist als der berühmte Großkapitalist vom
Schlage Lenbachs, der eine ungewöhnliche Begabung
ausmünzte, statt mit ihr der Entwicklung zu dienen:
wertvoller sür die Entwicklung der Kunst im Ganzen und
wertvoller — wie wir im Folgenden sehen werden —
für die Volksseele:
44