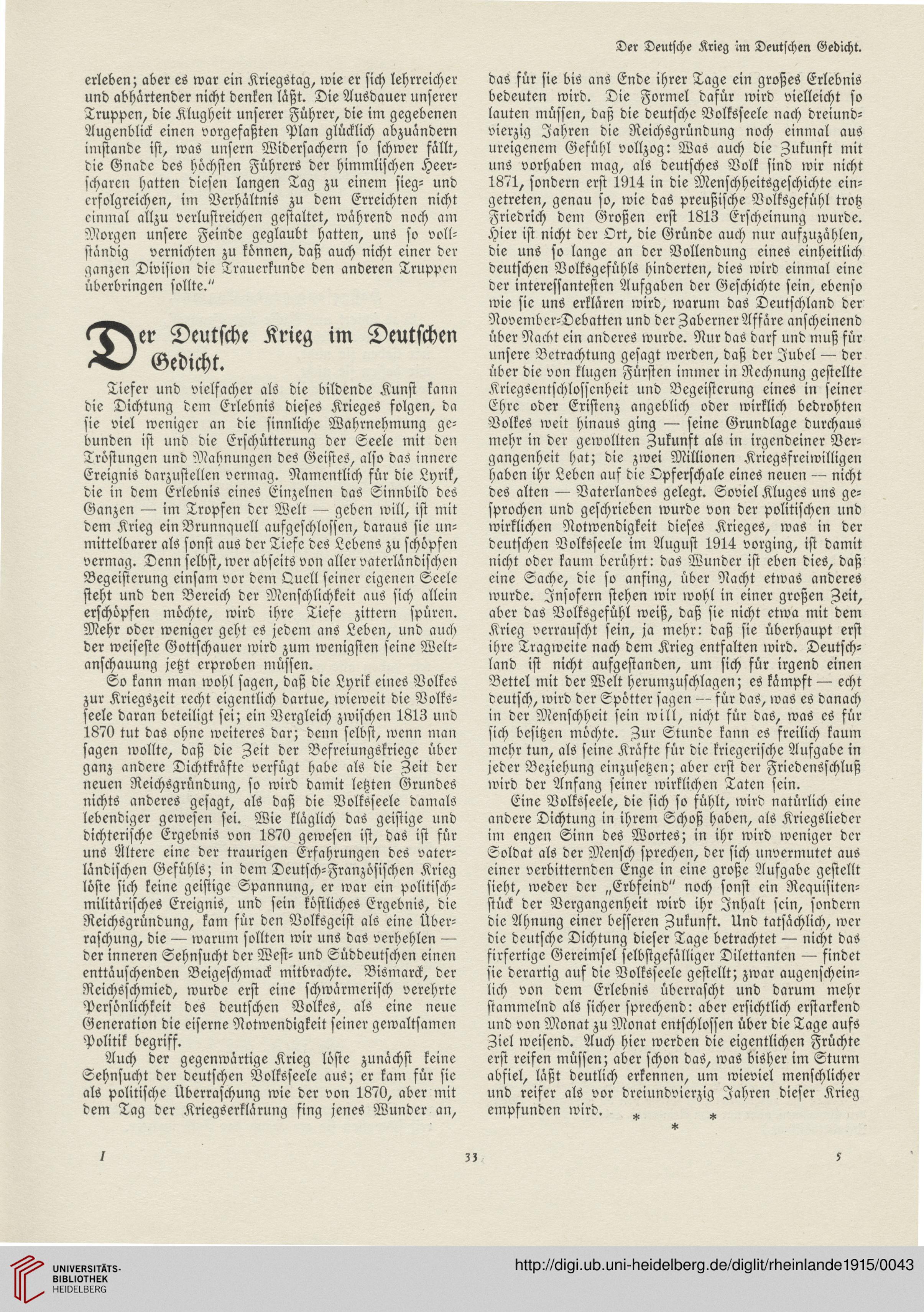Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht.
erleben; aber es war ein Kriegstag, wie er sich lehrreicher
und abhärtender nicht denken läßt. Die Ausdauer unserer
Truppen, die Klugheit unserer Führer, die im gegebenen
Augenblick einen vorgefaßten Plan glücklich abzuändern
imstande ist, was unsern Widersachern so schwer fällt,
die Gnade des höchsten Führers der himmlischen Heer-
scharen hatten diesen langen Tag zu einem sieg- und
erfolgreichen, im Verhältnis zu dem Erreichten nicht
cinmal allzu verlustreichen gestaltet, während noch am
Morgen unsere Feinde geglaubt hatten, uns so volt-
ständig vernichten zu können, daß auch nicht einer der
ganzen Division die Trauerkunde den anderen Truppen
überbringen sollte."
er Deutsche Krieg im Deutschen
Gedicht.
Tiefer und vielfacher als die bildende Kunst kann
die Dichtung dem Erlebnis dieses Krieges folgen, da
sie viel weniger an die sinnliche Wahrnehmung ge-
bunden ist und die Erschütterung der Seele mit den
Tröstungen und Mahnungen des Geistes, also das innere
Ereignis darzustellen vermag. Namentlich für die Lyrik,
die in dem Erlebnis eineö Einzelncn das Sinnbild des
Ganzen — im Tropfen der Welt — geben will, ist mit
dem Krieg einBrunnguell aufgeschlossen, daraus sie un-
mittelbarer als sonst aus der Tiefe des Lcbens zu schöpfen
vermag. Denn selbst, wer abseits von aller vaterländischen
Begeisterung einsam vor dem Quell seiner eigenen Seele
steht und den Bereich der Menschlichkeit aus sich allein
erschöpfen möchte, wird ihre Tiefe zittern spüren.
Mehr oder weniger geht es jedem ans Leben, und auch
der weiseste Gottschauer wird zum wenigsten seine Welt-
anschauung jetzt erproben müssen.
So kann man wohl sagen, daß die Lyrik eines Volkes
zur Kriegszeit recht eigentlich dartue, wieweit die Volks-
seele daran beteiligt sei; ein Nergleich zwischen 1813 und
1870 tut das ohne weiteres dar; denn selbst, wenn man
sagen wollte, daß die Aeit der Befreiungskriege über
ganz andere Dichtkräfte verfügt habe als die Aeit der
neuen Reichsgründung, so wird damit letzten Grundes
nichts anderes gesagt, als daß die Volksseele damalü
lebendiger gewesen sei. Wie kläglich das geistige und
dichterische Ergebnis von 1870 gewesen ist, das ist für
uns Altere eine der traurigen Erfahrungen des vater-
ländischen Gefühls; in dem Deutsch-Französischen Krieg
löste sich keine geistige Spannung, er war ein politisch-
militärisches Ereignis, und sein köstliches Ergebnis, die
Reichsgründung, kam für den Volksgeist als eine Über-
raschung, die — warum sollten wir uns das verhehlen —
der inneren Sehnsucht der West- und Süddeutschen einen
enttäuschenden Beigeschmack mitbrachte. Bismarck, der
Reichsschmied, wurde erst eine schwärmerisch verehrte
Persönlichkeit des deutschen Volkes, als eine neue
Generation die eiserne Notwendigkeit seiner gewaltsamen
Politik begriff.
Auch der gegenwärtige Krieg löste zunächst keine
Sehnsucht der deutschen Volksseele aus; er kam für sie
als politische Ilberraschung wie der von 1870, aber mit
dem Tag der Kriegserklärung fing jenes Wunder an.
das für sie bis ans Ende ihrer Tage ein großes Erlebnis
bedeuten wird. Die Formel dafür wird vielleicht so
lauten müssen, daß die deutsche Volksseele nach dreiund-
vierzig Jahren die Reichsgründung noch einmal aus
ureigenem Gefühl vollzog: Was auch die Aukunft mit
uns vorhaben mag, als deutsches Volk sind wir nicht
1871, sondern erst 1914 in die Menschheitsgeschichte ein-
getreten, genau so, wie das preußische Volksgefühl trotz
Friedrich dem Großen erst 1813 Erscheinung wurde.
Hier ist nicht der Ort, die Gründe auch nur aufzuzählen,
die uns so lange an der Vollendung eines einheitlich
deutschen Volksgefühls hinderten, dies wird einmal eine
der interessantesten Aufgaben der Geschichte sein, ebenso
wie sie uns erklären wird, warum das Deutschland der
November-Debatten und derIabernerAffäre anscheinend
über Nacbt ein anderes wurde. Nur das darf und muß für
unsere Betrachtung gesagt werden, daß der Jubel — der
über die von klugen Fürsten immer in Rechnung gestcllte
Kriegsentschlossenheit und Begeistcrung eines in seiner
Ehre oder Eristenz angeblich oder tvirklich bedrohten
Volkes weit hinaus ging — seine Grundlage durchaus
mehr in der getvollten Iukunft als in irgendeiner Ver-
gangenheit hat; die zwei Millionen Kriegsfreiwilligen
haben ihr Leben auf die Opferschale eines neuen — nicht
des alten — Vaterlandes gelegt. Soviel Kluges uns ge-
sprochen und geschrieben wurde von der politischen und
wirklichen Notwendigkeit dieses Krieges, was in der
deutschen Volksseele im August 1914 vorging, ist damit
nicht oder kaum berührt: das Wunder ist eben dies, daß
eine Sache, die so anfing, über Nacht etwas anderes
wurde. Jnsofern stehen wir wohl in einer großen Aeit,
aber das Volksgefühl weiß, daß sie nicht etwa mit dem
Krieg verrauscht sein, ja mehr: daß sie überhaupt erst
ihre Tragweite nach dem Krieg entfalten wird. Deutsch-
land ist nicht aufgestanden, um sich für irgend einen
Bettel mit der Welt herumzuschlagen; es kämpft — echt
deutsch, wird der Spötter sagen — für das, was es danach
in der Menschheit sein will, nicht für das, was es für
sich besitzen möchte. Aur Stunde kann es freilich kaum
mchr tun, als seine Kräfte sür die kriegerische Aufgabe in
jeder Beziehung einzusetzen; aber erst der Friedensschluß
wird der Anfang seiner wirklichen Taten sein.
Eine Volksseele, die sich so fühlt, wird natürlich eine
andere Dichtung in ihrem Schoß haben, als Kriegslieder
im engen Sinn des Wortes; in ihr wird weniger der
Soldat als der Mensch sprechen, der sich unvermutet aus
einer vcrbitternden Enge in eine große Aufgabe gestellt
sieht, weder der „Erbfeind" noch sonst ein Requisiten-
stück der Vergangenheit wird ihr Jnhalt scin, sondern
dic Ahnung einer besseren Aukunft. Und tatsächlich, wer
dic deutsche Dichtung dieser Tage betrachtet — nicht das
firfertige Gereimsel selbstgefälliger Dilettanten — findet
sie derartig auf die Volksseele gestellt; zwar augenschein-
lich von dem Erlebnis überrascht und darum mehr
stammelnd als sicher sprechend: aber ersichtlich erstarkend
und von Monat zu Monat entschlossen über die Tage aufs
Ziel weisend. Auch hier werden die eigentlichen Früchte
erst reifen müssen; aber schon das, was bisher im Sturm
abfiel, läßt deutlich erkennen, um wieviel menschlicher
und reifer als vor dreiundvierzig Jahren dieser Krieg
empfunden wird.
/
r
erleben; aber es war ein Kriegstag, wie er sich lehrreicher
und abhärtender nicht denken läßt. Die Ausdauer unserer
Truppen, die Klugheit unserer Führer, die im gegebenen
Augenblick einen vorgefaßten Plan glücklich abzuändern
imstande ist, was unsern Widersachern so schwer fällt,
die Gnade des höchsten Führers der himmlischen Heer-
scharen hatten diesen langen Tag zu einem sieg- und
erfolgreichen, im Verhältnis zu dem Erreichten nicht
cinmal allzu verlustreichen gestaltet, während noch am
Morgen unsere Feinde geglaubt hatten, uns so volt-
ständig vernichten zu können, daß auch nicht einer der
ganzen Division die Trauerkunde den anderen Truppen
überbringen sollte."
er Deutsche Krieg im Deutschen
Gedicht.
Tiefer und vielfacher als die bildende Kunst kann
die Dichtung dem Erlebnis dieses Krieges folgen, da
sie viel weniger an die sinnliche Wahrnehmung ge-
bunden ist und die Erschütterung der Seele mit den
Tröstungen und Mahnungen des Geistes, also das innere
Ereignis darzustellen vermag. Namentlich für die Lyrik,
die in dem Erlebnis eineö Einzelncn das Sinnbild des
Ganzen — im Tropfen der Welt — geben will, ist mit
dem Krieg einBrunnguell aufgeschlossen, daraus sie un-
mittelbarer als sonst aus der Tiefe des Lcbens zu schöpfen
vermag. Denn selbst, wer abseits von aller vaterländischen
Begeisterung einsam vor dem Quell seiner eigenen Seele
steht und den Bereich der Menschlichkeit aus sich allein
erschöpfen möchte, wird ihre Tiefe zittern spüren.
Mehr oder weniger geht es jedem ans Leben, und auch
der weiseste Gottschauer wird zum wenigsten seine Welt-
anschauung jetzt erproben müssen.
So kann man wohl sagen, daß die Lyrik eines Volkes
zur Kriegszeit recht eigentlich dartue, wieweit die Volks-
seele daran beteiligt sei; ein Nergleich zwischen 1813 und
1870 tut das ohne weiteres dar; denn selbst, wenn man
sagen wollte, daß die Aeit der Befreiungskriege über
ganz andere Dichtkräfte verfügt habe als die Aeit der
neuen Reichsgründung, so wird damit letzten Grundes
nichts anderes gesagt, als daß die Volksseele damalü
lebendiger gewesen sei. Wie kläglich das geistige und
dichterische Ergebnis von 1870 gewesen ist, das ist für
uns Altere eine der traurigen Erfahrungen des vater-
ländischen Gefühls; in dem Deutsch-Französischen Krieg
löste sich keine geistige Spannung, er war ein politisch-
militärisches Ereignis, und sein köstliches Ergebnis, die
Reichsgründung, kam für den Volksgeist als eine Über-
raschung, die — warum sollten wir uns das verhehlen —
der inneren Sehnsucht der West- und Süddeutschen einen
enttäuschenden Beigeschmack mitbrachte. Bismarck, der
Reichsschmied, wurde erst eine schwärmerisch verehrte
Persönlichkeit des deutschen Volkes, als eine neue
Generation die eiserne Notwendigkeit seiner gewaltsamen
Politik begriff.
Auch der gegenwärtige Krieg löste zunächst keine
Sehnsucht der deutschen Volksseele aus; er kam für sie
als politische Ilberraschung wie der von 1870, aber mit
dem Tag der Kriegserklärung fing jenes Wunder an.
das für sie bis ans Ende ihrer Tage ein großes Erlebnis
bedeuten wird. Die Formel dafür wird vielleicht so
lauten müssen, daß die deutsche Volksseele nach dreiund-
vierzig Jahren die Reichsgründung noch einmal aus
ureigenem Gefühl vollzog: Was auch die Aukunft mit
uns vorhaben mag, als deutsches Volk sind wir nicht
1871, sondern erst 1914 in die Menschheitsgeschichte ein-
getreten, genau so, wie das preußische Volksgefühl trotz
Friedrich dem Großen erst 1813 Erscheinung wurde.
Hier ist nicht der Ort, die Gründe auch nur aufzuzählen,
die uns so lange an der Vollendung eines einheitlich
deutschen Volksgefühls hinderten, dies wird einmal eine
der interessantesten Aufgaben der Geschichte sein, ebenso
wie sie uns erklären wird, warum das Deutschland der
November-Debatten und derIabernerAffäre anscheinend
über Nacbt ein anderes wurde. Nur das darf und muß für
unsere Betrachtung gesagt werden, daß der Jubel — der
über die von klugen Fürsten immer in Rechnung gestcllte
Kriegsentschlossenheit und Begeistcrung eines in seiner
Ehre oder Eristenz angeblich oder tvirklich bedrohten
Volkes weit hinaus ging — seine Grundlage durchaus
mehr in der getvollten Iukunft als in irgendeiner Ver-
gangenheit hat; die zwei Millionen Kriegsfreiwilligen
haben ihr Leben auf die Opferschale eines neuen — nicht
des alten — Vaterlandes gelegt. Soviel Kluges uns ge-
sprochen und geschrieben wurde von der politischen und
wirklichen Notwendigkeit dieses Krieges, was in der
deutschen Volksseele im August 1914 vorging, ist damit
nicht oder kaum berührt: das Wunder ist eben dies, daß
eine Sache, die so anfing, über Nacht etwas anderes
wurde. Jnsofern stehen wir wohl in einer großen Aeit,
aber das Volksgefühl weiß, daß sie nicht etwa mit dem
Krieg verrauscht sein, ja mehr: daß sie überhaupt erst
ihre Tragweite nach dem Krieg entfalten wird. Deutsch-
land ist nicht aufgestanden, um sich für irgend einen
Bettel mit der Welt herumzuschlagen; es kämpft — echt
deutsch, wird der Spötter sagen — für das, was es danach
in der Menschheit sein will, nicht für das, was es für
sich besitzen möchte. Aur Stunde kann es freilich kaum
mchr tun, als seine Kräfte sür die kriegerische Aufgabe in
jeder Beziehung einzusetzen; aber erst der Friedensschluß
wird der Anfang seiner wirklichen Taten sein.
Eine Volksseele, die sich so fühlt, wird natürlich eine
andere Dichtung in ihrem Schoß haben, als Kriegslieder
im engen Sinn des Wortes; in ihr wird weniger der
Soldat als der Mensch sprechen, der sich unvermutet aus
einer vcrbitternden Enge in eine große Aufgabe gestellt
sieht, weder der „Erbfeind" noch sonst ein Requisiten-
stück der Vergangenheit wird ihr Jnhalt scin, sondern
dic Ahnung einer besseren Aukunft. Und tatsächlich, wer
dic deutsche Dichtung dieser Tage betrachtet — nicht das
firfertige Gereimsel selbstgefälliger Dilettanten — findet
sie derartig auf die Volksseele gestellt; zwar augenschein-
lich von dem Erlebnis überrascht und darum mehr
stammelnd als sicher sprechend: aber ersichtlich erstarkend
und von Monat zu Monat entschlossen über die Tage aufs
Ziel weisend. Auch hier werden die eigentlichen Früchte
erst reifen müssen; aber schon das, was bisher im Sturm
abfiel, läßt deutlich erkennen, um wieviel menschlicher
und reifer als vor dreiundvierzig Jahren dieser Krieg
empfunden wird.
/
r