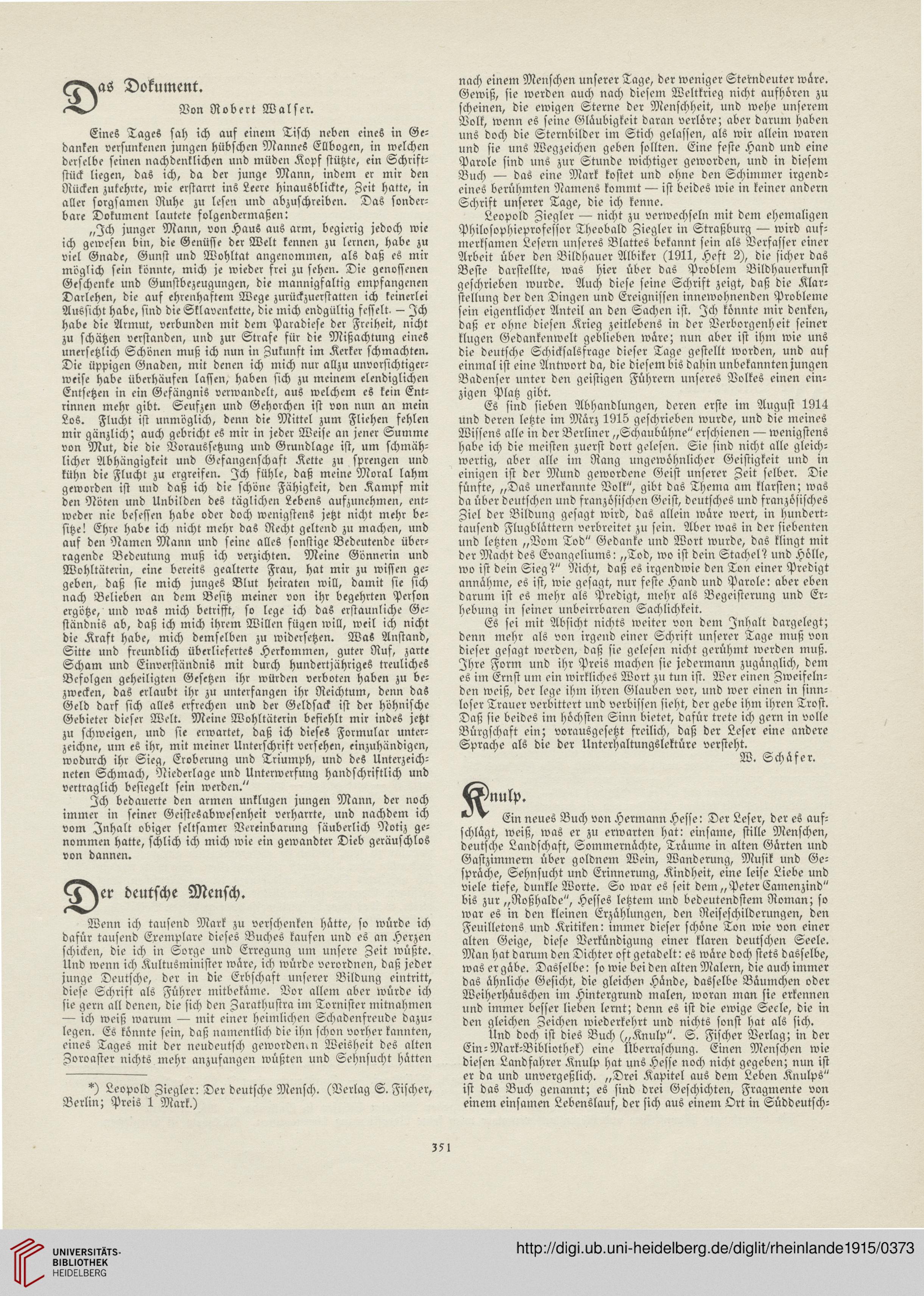as Dokument.
Von Robert Walser.
Cines Tages sah ich auf eincm Tisch neben eines in Ge-
danken versunkenen jungen hllbschen Mannes Cllbogen, in welchen
derselbe seinen nachdenklichen und müden Kopf stützte, ein Schrift-
stück licgen, das ich, da der jungc Mann, indem er mir den
Nllcken zukehrte, wie erstarrl ins Leerc hinausblickte, Zeit hatte, in
aller sorgsamen Nuhe zu leseu und abzuschreiben. Das sonder-
bare Dokument lautcte folgendermaßen:
„Jch junger Mann, von Haus aus arm, begierig jcdoch wie
ich gewesen bin, dic Genüffe dcr Welt kennen zu lernen, habe zu
viel Gnade, Gunst und Wohltat angenommen, als daß es mir
moglich sein könnte, mich je wicder frei zu sehen. Die genoffenen
Geschenke und Gunstbezeugungcn, die mannigfaltig empfangenen
Darlehcn, die auf ehrenhaftem Wege zurückzucrstatten ich keinerlci
Aussicht habe, sind dic Sklavenkette, die mich endgültig feffelt. — Jch
habe die Armut, vcrbunden mit dem Paradiese der Freiheit, nicht
zu schatzen verstanden, und zur Strafe für dic Mißachtung eincs
unersctzlich Schönen muß ich nun in Zukunft im Kerker schmachten.
Die üppigen Gnaden, mit denen ich mich nur allzu unvorsichtigcr-
weise habe übcrhäufen laffcn, haben sich zu meincm elendiglichen
Cntsetzen in ein Gefängnis verwandelt, aus welchem cs kein Ent-
rinnen mehr gibt. Seufzen und Gehorchen ist von nun an mcin
Los. Flucht ist unmöglich, denn dic Mittel zum Fliehen fehlen
mir gänzlich; auch gebricht cs mir in jcder Weise an jener Summe
von Mut, die die Doraussetzung und Grundlage ist, um schmäh-
licher Abhängigkeit und Gcfangenschaft Kelte zu sprengen und
kühn die Flucht zu ergreifen. Jch fühle, daß meine Moral lahm
gcwvrden ist und daß ich die schöne Fähigkeit, den Kampf mit
den Nötcn und Unbilden des täglichen Lebens aufzunehmen, ent-
wedcr nie besessen habe odcr doch wenigstens jetzt nicht mchr be-
sitze! Ehre habc ich nicht mchr das Necht geltend zu machen, und
auf dcn Namen Mann und seine alles sonstigc Bcdeutende über-
ragende Bedeutung muß ich verzichtcn. Meine GLnnerin und
Wohltäterin, cinc bercits gcalterte Frau, hat mir zu wiffen ge-
geben, daß sie mich junges Blut heiraten will, damit sie sich
nach Belicben an dem Besih meiner von ihr begehrtcn Person
ergötze, und was mich bctrifft, so lcge ich das erstaunliche Ge-
ständnis ab, daß ich mich ihrem Willen fügcn will, wcil ich nicht
die Kraft habe, mich demselben zu widersetzen. Was Anstand,
Sitte und frcundlich überliefcrtcs Herkommen, guter Nuf, zarte
Scham und Cinverständnis mit durch hundcrtjähriges treuliches
Befolgen geheiligten Gesctzen ihr würden verboten haben zu be-
zwccken, das crlaubt ihr zu unterfangen ihr Reichtum, denn das
Geld darf sich alles crfrcchen und der Geldsack ist der HLHnische
Gebietcr dicscr Welt. Meine Wohltätcrin besiehlt mir indes jetzt
zu schweigen, und sie erwartet, daß ich diescs Formular unter-
zcichne, um cs ihr, mit mciner Uuterschrift versehen, einzuhändigen,
wodurch ihr Sicg, Croberung und Triumph, und des Unterzeich-
ncten Schmach, Niederlage und Unterwerfung handschriftlich und
vertraglich besiegelt sein werden."
Jch bcdaucrte den armen unklugen jungcn Mann, der »och
immer in seiner Geistesabwesenheit verharrte, und nachdem ich
vom Inhalt obiger seltsamcr Vereinbarung säuberlich Notiz ge-
nommcn hatte, schlich ich mich wie ein gewandter Dieb geräuschlos
von dannen.
er deutsche Mensch.
Wenn ich tausend Mark zu verschenken hätte, so würde ich
dafür tausend Exemplare dieses Buches kaufen und es an Herzen
schicken, die ich in Sorge und Erregung um unsere Zeit wüßte.
Und wenn ich Kultusminister wäre, rch würde verordnen, daß jeder
junge Deutsche, der in die Erbschaft unserer Bildung eintritt,
diese Schrift als Führer mitbekäme. Dor allem aber würde ich
sie gern all denen, die sich den Iarathustra im Tornister mitnahmen
— ich weiß warum — mit einer heimlichen Schadenfreude dazu-
legen. Cs könnte sein, daß namentlich die ihn schon vorher kannten,
eines Tages mit der neudeutsch gewordemn Weisheit des alten
Aoroaster nichts mehr anzufangen wüßten und Sehnsucht hätten
*) Leopold Ziegler: Der deutsche Mensch. (Verlag S. Fischer,
Berlin; Preis 1 Mark.)
nach einem Menschen unserer Tage, der weniger Stekndeuter wäre.
Gewiß, sie werden auch nach diesem Weltkrieg nicht aufhören zu
scheinen, die ewigen Sterne der Menschheit, und wehe unserem
Volk, wenn es seine Gläubigkeit daran verlöre; aber darum haben
uns doch die Sternbilder im Stich gelassen, als wir allein waren
und sie uns Wegzeichen geben sollten. Eine feste Hand und eine
Parole sind uns zur Stunde wichtiger geworden, und in diesem
Buch — das eine Mark kostet und ohne den Schimmer irgend-
eines berühmten Namens kommt — ist beides wie in keiner andern
Schrift unserer Tage, die ich kenne.
Leopold Ziegler — nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen
Philosophieprofessor Theobald Ziegler in Straßburg — wird auf-
merksamen Lesern unseres Blattes bekannt sein als Derfasser einer
Arbeit über den Bildhauer Albiker (1911, Heft 2), die sicher das
Beste darstellte, was hier über das Problem Bildhauerkunst
geschrieben wurde. Auch diese seine Schrift zeigt, daß die Klar-
stellung der den Dingen und Creignissen inuewohnendcn Probleme
sein eigentlicher Anteil an den Sachen ist. Ich könnte mir denken,
daß er ohne diesen Krieg zeitlebens in der Verborgenheit seiner
klugen Gedankenwelt geblieben wäre; nun aber ist ihm wie uns
die deutsche Schicksalsfrage dieser Tage gestellt worden, und auf
einmal ist eine Antwort da, die diesem bis dahin unbekanntenjungen
Badenser unter den geistigen Führern unseres Volkes einen ein-
zigen Platz gibt.
Es sind sieben Abhandlungen, deren erste im August 1914
und deren lehte im März 1915 geschrieben wurde, und die meines
Wissens alle in der Berliner „Schaubühne" erschienen — wenigstens
habe ich die meisten zuerst dort gelesen. Sie sind nicht alle gleich-
wertig, aber alle im Rang ungewöhnlicher Geistigkeit und in
einigen ist der Mund gewordene Geist unserer Zeit selber. Die
fünfte, „Das unerkannte Dolk", gibt das Thema am klarsten; was
da über deutschen und französischen Geist, deutsches und französisches
Iiel der Bildung gesagt wird, das allein wäre wert, in hundert-
tausend Flugblättern verbreitet zu sein. Aber was in der siebenten
und lehten „Vom Tod" Gedanke und Wort wurde, das klingt mit
der Macht des Evangeliums: „Tod, wo ist dein Stachel? und Hölle,
wo ist dein Sieg?" Nicht, daß es irgendwie den Ton einer Predigt
annähme, es ist, wie gesagt, nur feste Hand und Parole: aber eben
darum ist es mehr als Predigt, mehr als Begeisterung und Er-
hebung in seiner unbeirrbaren Sachlichkeit.
Es sei mit Absicht nichts weiter von dem Jnhalt dargelegt;
denn mehr als von irgeud einer Schrift unserer Tage muß von
dieser gesagt werden, daß sie gelesen nicht gerühmt werden muß.
Jhre Form und ihr Preis machen sie jedermann zugänglich, dem
es im Ernst um ein wirkliches Wort zu tun ist. Wer einen Zweifeln-
den weiß, der lege ihm ihren Glauben vor, und wer einen in sinn-
loser Trauer verbittert und verbissen sieht, der gebe ihm ihren Trost.
Daß sie beides im höchsten Sinn bietet, dafür trete ich gern in volle
Bürgschaft ein; vorausgesetzt frcilich, daß der Leser eine andere
Sprache als die der Unterhaltungslektüre versteht.
W. Schäfer.
^nulp.
^ ^ Cin neues Buch von Hermann Hesse: Der Leser, der es auf-
schlägt, weiß, was er zu erwarten hat: einsame, stille Menschen,
deutsche Landschaft, Sommernächte, Träume in alten Gärten und
Gastzimmern über goldnem Wein, Wanderung, Musik und Ge-
spräche, Sehnsucht und Erinnerung, Kindheit, eine leise Liebe und
viele tiefe, dunkle Worte. So war es seit dem„Peter Camenzind"
bis zur „Roßhalde", Hesses letztem und bedeutendstem Roman; so
war es in den kleinen Erzählungen, den Reiseschilderungen, den
Feuilletons und Kritiken: immer dieser schöne Ton wie von einer
alten Geige, diese Verkündigung einer klaren deutschen Seele.
Man hat darum den Dichter oft getadelt: es wäre doch stets dasselbe,
was ergäbe. Dasselbe: so wie beiden altenMalern, die auchimmer
das ähnliche Gesicht, die gleichen Hände, dasselbe BLumchen oder
Weiherhäuschen im Hintergrund malen, woran man sie erkennen
und immer besser lieben lernt; denn es ist die ewige Seele, die in
den gleichen Zeichen wiederkehrt und nichts sonst hat als sich.
Und docl, ist dies Buch („Knulp". S. Fischer Verlag; in der
Cin-Mark-Bibliothek) eine Überraschung. Einen Menschen wie
diesen Landfahrer Knulp hat uns Hesse noch nicht gegeben; nun ist
er da und unvergeßlich. „Drei Kapitel aus dem Leben Knulps"
ist das Buch genannt; es sind drei Geschichten, Fragmente von
einem einsamen Lebenslauf, der sich aus einem Ort in Süddeutsch-
Von Robert Walser.
Cines Tages sah ich auf eincm Tisch neben eines in Ge-
danken versunkenen jungen hllbschen Mannes Cllbogen, in welchen
derselbe seinen nachdenklichen und müden Kopf stützte, ein Schrift-
stück licgen, das ich, da der jungc Mann, indem er mir den
Nllcken zukehrte, wie erstarrl ins Leerc hinausblickte, Zeit hatte, in
aller sorgsamen Nuhe zu leseu und abzuschreiben. Das sonder-
bare Dokument lautcte folgendermaßen:
„Jch junger Mann, von Haus aus arm, begierig jcdoch wie
ich gewesen bin, dic Genüffe dcr Welt kennen zu lernen, habe zu
viel Gnade, Gunst und Wohltat angenommen, als daß es mir
moglich sein könnte, mich je wicder frei zu sehen. Die genoffenen
Geschenke und Gunstbezeugungcn, die mannigfaltig empfangenen
Darlehcn, die auf ehrenhaftem Wege zurückzucrstatten ich keinerlci
Aussicht habe, sind dic Sklavenkette, die mich endgültig feffelt. — Jch
habe die Armut, vcrbunden mit dem Paradiese der Freiheit, nicht
zu schatzen verstanden, und zur Strafe für dic Mißachtung eincs
unersctzlich Schönen muß ich nun in Zukunft im Kerker schmachten.
Die üppigen Gnaden, mit denen ich mich nur allzu unvorsichtigcr-
weise habe übcrhäufen laffcn, haben sich zu meincm elendiglichen
Cntsetzen in ein Gefängnis verwandelt, aus welchem cs kein Ent-
rinnen mehr gibt. Seufzen und Gehorchen ist von nun an mcin
Los. Flucht ist unmöglich, denn dic Mittel zum Fliehen fehlen
mir gänzlich; auch gebricht cs mir in jcder Weise an jener Summe
von Mut, die die Doraussetzung und Grundlage ist, um schmäh-
licher Abhängigkeit und Gcfangenschaft Kelte zu sprengen und
kühn die Flucht zu ergreifen. Jch fühle, daß meine Moral lahm
gcwvrden ist und daß ich die schöne Fähigkeit, den Kampf mit
den Nötcn und Unbilden des täglichen Lebens aufzunehmen, ent-
wedcr nie besessen habe odcr doch wenigstens jetzt nicht mchr be-
sitze! Ehre habc ich nicht mchr das Necht geltend zu machen, und
auf dcn Namen Mann und seine alles sonstigc Bcdeutende über-
ragende Bedeutung muß ich verzichtcn. Meine GLnnerin und
Wohltäterin, cinc bercits gcalterte Frau, hat mir zu wiffen ge-
geben, daß sie mich junges Blut heiraten will, damit sie sich
nach Belicben an dem Besih meiner von ihr begehrtcn Person
ergötze, und was mich bctrifft, so lcge ich das erstaunliche Ge-
ständnis ab, daß ich mich ihrem Willen fügcn will, wcil ich nicht
die Kraft habe, mich demselben zu widersetzen. Was Anstand,
Sitte und frcundlich überliefcrtcs Herkommen, guter Nuf, zarte
Scham und Cinverständnis mit durch hundcrtjähriges treuliches
Befolgen geheiligten Gesctzen ihr würden verboten haben zu be-
zwccken, das crlaubt ihr zu unterfangen ihr Reichtum, denn das
Geld darf sich alles crfrcchen und der Geldsack ist der HLHnische
Gebietcr dicscr Welt. Meine Wohltätcrin besiehlt mir indes jetzt
zu schweigen, und sie erwartet, daß ich diescs Formular unter-
zcichne, um cs ihr, mit mciner Uuterschrift versehen, einzuhändigen,
wodurch ihr Sicg, Croberung und Triumph, und des Unterzeich-
ncten Schmach, Niederlage und Unterwerfung handschriftlich und
vertraglich besiegelt sein werden."
Jch bcdaucrte den armen unklugen jungcn Mann, der »och
immer in seiner Geistesabwesenheit verharrte, und nachdem ich
vom Inhalt obiger seltsamcr Vereinbarung säuberlich Notiz ge-
nommcn hatte, schlich ich mich wie ein gewandter Dieb geräuschlos
von dannen.
er deutsche Mensch.
Wenn ich tausend Mark zu verschenken hätte, so würde ich
dafür tausend Exemplare dieses Buches kaufen und es an Herzen
schicken, die ich in Sorge und Erregung um unsere Zeit wüßte.
Und wenn ich Kultusminister wäre, rch würde verordnen, daß jeder
junge Deutsche, der in die Erbschaft unserer Bildung eintritt,
diese Schrift als Führer mitbekäme. Dor allem aber würde ich
sie gern all denen, die sich den Iarathustra im Tornister mitnahmen
— ich weiß warum — mit einer heimlichen Schadenfreude dazu-
legen. Cs könnte sein, daß namentlich die ihn schon vorher kannten,
eines Tages mit der neudeutsch gewordemn Weisheit des alten
Aoroaster nichts mehr anzufangen wüßten und Sehnsucht hätten
*) Leopold Ziegler: Der deutsche Mensch. (Verlag S. Fischer,
Berlin; Preis 1 Mark.)
nach einem Menschen unserer Tage, der weniger Stekndeuter wäre.
Gewiß, sie werden auch nach diesem Weltkrieg nicht aufhören zu
scheinen, die ewigen Sterne der Menschheit, und wehe unserem
Volk, wenn es seine Gläubigkeit daran verlöre; aber darum haben
uns doch die Sternbilder im Stich gelassen, als wir allein waren
und sie uns Wegzeichen geben sollten. Eine feste Hand und eine
Parole sind uns zur Stunde wichtiger geworden, und in diesem
Buch — das eine Mark kostet und ohne den Schimmer irgend-
eines berühmten Namens kommt — ist beides wie in keiner andern
Schrift unserer Tage, die ich kenne.
Leopold Ziegler — nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen
Philosophieprofessor Theobald Ziegler in Straßburg — wird auf-
merksamen Lesern unseres Blattes bekannt sein als Derfasser einer
Arbeit über den Bildhauer Albiker (1911, Heft 2), die sicher das
Beste darstellte, was hier über das Problem Bildhauerkunst
geschrieben wurde. Auch diese seine Schrift zeigt, daß die Klar-
stellung der den Dingen und Creignissen inuewohnendcn Probleme
sein eigentlicher Anteil an den Sachen ist. Ich könnte mir denken,
daß er ohne diesen Krieg zeitlebens in der Verborgenheit seiner
klugen Gedankenwelt geblieben wäre; nun aber ist ihm wie uns
die deutsche Schicksalsfrage dieser Tage gestellt worden, und auf
einmal ist eine Antwort da, die diesem bis dahin unbekanntenjungen
Badenser unter den geistigen Führern unseres Volkes einen ein-
zigen Platz gibt.
Es sind sieben Abhandlungen, deren erste im August 1914
und deren lehte im März 1915 geschrieben wurde, und die meines
Wissens alle in der Berliner „Schaubühne" erschienen — wenigstens
habe ich die meisten zuerst dort gelesen. Sie sind nicht alle gleich-
wertig, aber alle im Rang ungewöhnlicher Geistigkeit und in
einigen ist der Mund gewordene Geist unserer Zeit selber. Die
fünfte, „Das unerkannte Dolk", gibt das Thema am klarsten; was
da über deutschen und französischen Geist, deutsches und französisches
Iiel der Bildung gesagt wird, das allein wäre wert, in hundert-
tausend Flugblättern verbreitet zu sein. Aber was in der siebenten
und lehten „Vom Tod" Gedanke und Wort wurde, das klingt mit
der Macht des Evangeliums: „Tod, wo ist dein Stachel? und Hölle,
wo ist dein Sieg?" Nicht, daß es irgendwie den Ton einer Predigt
annähme, es ist, wie gesagt, nur feste Hand und Parole: aber eben
darum ist es mehr als Predigt, mehr als Begeisterung und Er-
hebung in seiner unbeirrbaren Sachlichkeit.
Es sei mit Absicht nichts weiter von dem Jnhalt dargelegt;
denn mehr als von irgeud einer Schrift unserer Tage muß von
dieser gesagt werden, daß sie gelesen nicht gerühmt werden muß.
Jhre Form und ihr Preis machen sie jedermann zugänglich, dem
es im Ernst um ein wirkliches Wort zu tun ist. Wer einen Zweifeln-
den weiß, der lege ihm ihren Glauben vor, und wer einen in sinn-
loser Trauer verbittert und verbissen sieht, der gebe ihm ihren Trost.
Daß sie beides im höchsten Sinn bietet, dafür trete ich gern in volle
Bürgschaft ein; vorausgesetzt frcilich, daß der Leser eine andere
Sprache als die der Unterhaltungslektüre versteht.
W. Schäfer.
^nulp.
^ ^ Cin neues Buch von Hermann Hesse: Der Leser, der es auf-
schlägt, weiß, was er zu erwarten hat: einsame, stille Menschen,
deutsche Landschaft, Sommernächte, Träume in alten Gärten und
Gastzimmern über goldnem Wein, Wanderung, Musik und Ge-
spräche, Sehnsucht und Erinnerung, Kindheit, eine leise Liebe und
viele tiefe, dunkle Worte. So war es seit dem„Peter Camenzind"
bis zur „Roßhalde", Hesses letztem und bedeutendstem Roman; so
war es in den kleinen Erzählungen, den Reiseschilderungen, den
Feuilletons und Kritiken: immer dieser schöne Ton wie von einer
alten Geige, diese Verkündigung einer klaren deutschen Seele.
Man hat darum den Dichter oft getadelt: es wäre doch stets dasselbe,
was ergäbe. Dasselbe: so wie beiden altenMalern, die auchimmer
das ähnliche Gesicht, die gleichen Hände, dasselbe BLumchen oder
Weiherhäuschen im Hintergrund malen, woran man sie erkennen
und immer besser lieben lernt; denn es ist die ewige Seele, die in
den gleichen Zeichen wiederkehrt und nichts sonst hat als sich.
Und docl, ist dies Buch („Knulp". S. Fischer Verlag; in der
Cin-Mark-Bibliothek) eine Überraschung. Einen Menschen wie
diesen Landfahrer Knulp hat uns Hesse noch nicht gegeben; nun ist
er da und unvergeßlich. „Drei Kapitel aus dem Leben Knulps"
ist das Buch genannt; es sind drei Geschichten, Fragmente von
einem einsamen Lebenslauf, der sich aus einem Ort in Süddeutsch-