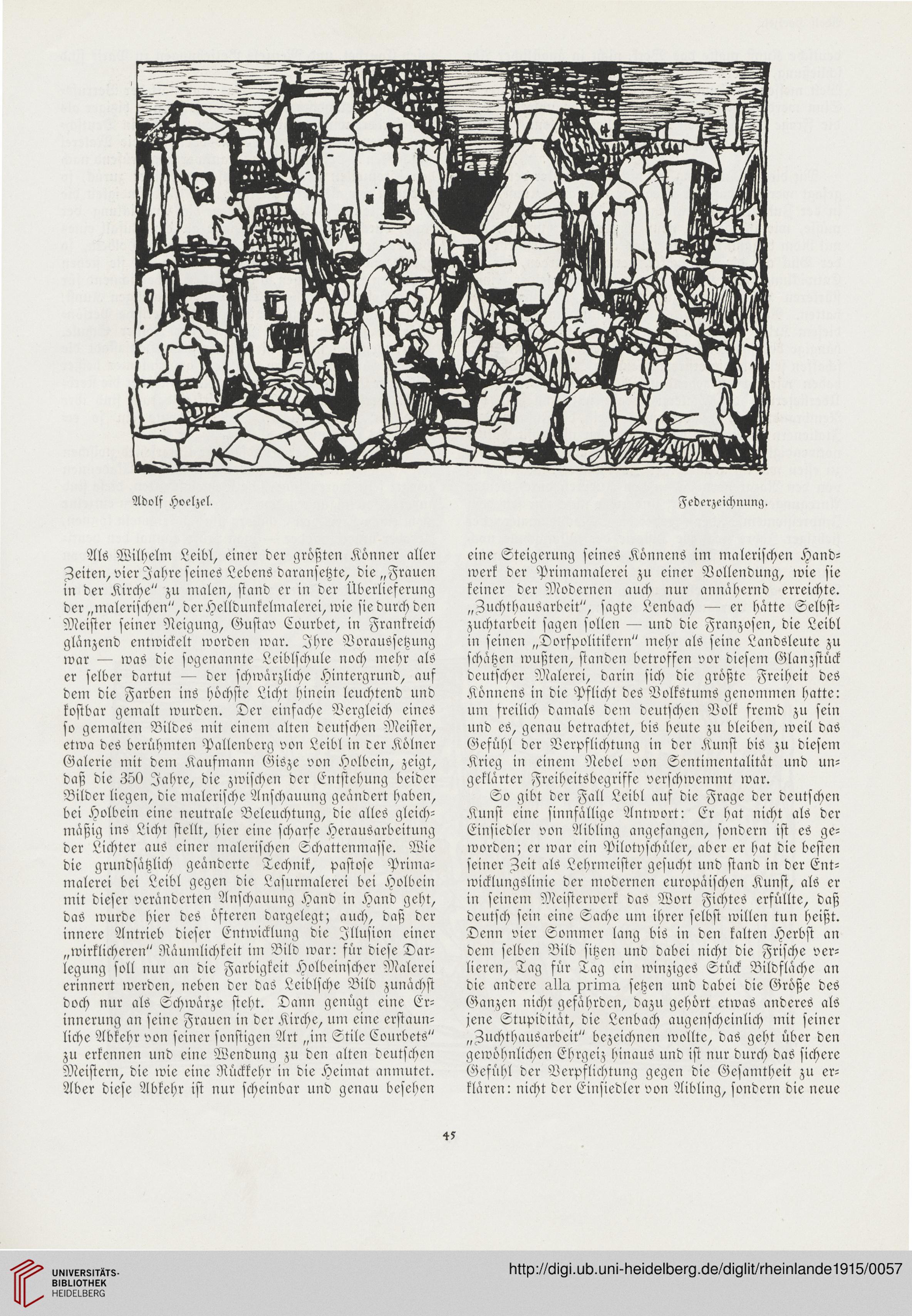Adolf Hvelzel.
Federzeichnung.
Als Wilhelm Leibl, einer der größten Könner aller
Ieiten, vier Jahre seines Lebens daransetzte, die „Frauen
in der Kirche" zu malen, stand er in der Überlieferung
der „malerischen", derHelldunkelmalerei, wie sie durch den
Meister seiner Neigung, Gustav Courbet, in Frankreich
glanzend entwickelt worden war. Jhre Voraussetzung
war — was die sogenannte Leiblschule noch inehr als
er selber dartut — der schwarzliche Hintergrund, auf
dem die Farben ins höchste Licht hinein leuchtend und
kostbar gemalt wurden. Der einfache Vergleich eines
so gemalten Bildes mit einem alten deutschen Meister,
etwa des berühmten Pallenberg von Leibl in cer Kölner
Galerie mit dem Kaufmann Gisze von Holbein, zeigt,
daß die 350 Jahre, die zwischen der Entstehung beider
Bilder liegen, die malerische Anschauung geandert haben,
bei Holbein eine neutrale Beleuchtung, die alles gleich-
mäßig ins Licht stellt, hier eine scharfe Herausarbeitung
der Lichter aus einer malerischen Schattenmasse. Wie
die grundsätzlich geänderte Technik, pastose Prima-
malerei bei Leibl gegen die Lasurmalerei bei Holbein
mit dieser veränderten Anschauung Hand in Hand geht,
das wurde hier des öfteren dargelegt; auch, daß der
innere Antrieb dieser Entwicklung die Jllusion einer
„wirklicheren" Räumlichkeit im Bild war: für diese Dar-
legung soll nur an die Farbigkeit Holbeinscher Malerei
erinnert werden, neben der das Leiblsche Bild zunachst
doch nur als Schwarze steht. Dann genügt eine Er-
innerung an seine Frauen in der Kirche, um eine erstaun-
liche Abkehr von seiner sonstigen Art „im Stile Courbets"
zu erkennen und eine Wendung zu den alten deutschen
Meistern, die wie eine Rückkehr in die Heimat anmutet.
Aber diese Abkehr ist nur scheinbar und genau besehen
eine Steigerung seines Könnens im malerischen Hand-
werk der Primamalerei zu einer Vollendung, wie sie
keiner der Modernen auch nur annähernd erreichte.
„Auchthausarbeit", sagte Lenbach — er hätte Selbst-
zuchtarbeit sagen sollen — und die Franzosen, die Leibl
in seinen „Dorfpolitikern" mehr als seine Landsleute zu
schätzen wußten, standen betroffen vor diesem Glanzstück
deutscher Malerei, darin sich die größte Freiheit des
Könnens in die Pflicht des Volkstums genommen hatte:
um freilich damals dem deutschen Volk fremd zu sein
und es, genau betrachtet, bis heute zu bleiben, weil das
Gefühl der Verpflichtung in der Kunst biö zu diesem
Krieg in einem Nebel von Sentimentalität und un-
geklärter Freiheitsbegriffe verschwemmt war.
So gibt der Fall Leibl auf die Frage der deutschen
Kunst eine sinnfällige Antwort: Er hat nicht als der
Einsiedler von Aibling angefangen, sondern ist es ge-
worden; er war ein Pilotyschüler, aber er hat die besten
seiner Aeit als Lehrmeister gesucht und stand in der Ent-
wicklungslinie der modernen europäischen Kunst, als er
in seinem Meisterwerk das Wort Fichtes erfüllte, daß
deutsch sein eine Sache um ihrer selbst willen tun heißt.
Denn vier Sommer lang bis in den kalten Herbst an
dem selben Bild sitzen und dabei nicht die Frische ver-
lieren, Tag für Tag ein winziges Stück Bildflache an
die andere ullu primg. setzen und dabei die Größe des
Ganzen nicht gefährden, dazu gehört etwas anderes als
jene Stupidität, die Lenbach augenscheinlich mit seiner
„Auchthausarbeit" bezeichnen wollte, das geht über den
gewöhnlichen Ehrgeiz hinaus und ist nur durch das sichere
Gefühl der Verpflichtung gegen die Gesamtheit zu er-
klären: nicht der Einsiedler von Aibling, sondern die neue
45
Federzeichnung.
Als Wilhelm Leibl, einer der größten Könner aller
Ieiten, vier Jahre seines Lebens daransetzte, die „Frauen
in der Kirche" zu malen, stand er in der Überlieferung
der „malerischen", derHelldunkelmalerei, wie sie durch den
Meister seiner Neigung, Gustav Courbet, in Frankreich
glanzend entwickelt worden war. Jhre Voraussetzung
war — was die sogenannte Leiblschule noch inehr als
er selber dartut — der schwarzliche Hintergrund, auf
dem die Farben ins höchste Licht hinein leuchtend und
kostbar gemalt wurden. Der einfache Vergleich eines
so gemalten Bildes mit einem alten deutschen Meister,
etwa des berühmten Pallenberg von Leibl in cer Kölner
Galerie mit dem Kaufmann Gisze von Holbein, zeigt,
daß die 350 Jahre, die zwischen der Entstehung beider
Bilder liegen, die malerische Anschauung geandert haben,
bei Holbein eine neutrale Beleuchtung, die alles gleich-
mäßig ins Licht stellt, hier eine scharfe Herausarbeitung
der Lichter aus einer malerischen Schattenmasse. Wie
die grundsätzlich geänderte Technik, pastose Prima-
malerei bei Leibl gegen die Lasurmalerei bei Holbein
mit dieser veränderten Anschauung Hand in Hand geht,
das wurde hier des öfteren dargelegt; auch, daß der
innere Antrieb dieser Entwicklung die Jllusion einer
„wirklicheren" Räumlichkeit im Bild war: für diese Dar-
legung soll nur an die Farbigkeit Holbeinscher Malerei
erinnert werden, neben der das Leiblsche Bild zunachst
doch nur als Schwarze steht. Dann genügt eine Er-
innerung an seine Frauen in der Kirche, um eine erstaun-
liche Abkehr von seiner sonstigen Art „im Stile Courbets"
zu erkennen und eine Wendung zu den alten deutschen
Meistern, die wie eine Rückkehr in die Heimat anmutet.
Aber diese Abkehr ist nur scheinbar und genau besehen
eine Steigerung seines Könnens im malerischen Hand-
werk der Primamalerei zu einer Vollendung, wie sie
keiner der Modernen auch nur annähernd erreichte.
„Auchthausarbeit", sagte Lenbach — er hätte Selbst-
zuchtarbeit sagen sollen — und die Franzosen, die Leibl
in seinen „Dorfpolitikern" mehr als seine Landsleute zu
schätzen wußten, standen betroffen vor diesem Glanzstück
deutscher Malerei, darin sich die größte Freiheit des
Könnens in die Pflicht des Volkstums genommen hatte:
um freilich damals dem deutschen Volk fremd zu sein
und es, genau betrachtet, bis heute zu bleiben, weil das
Gefühl der Verpflichtung in der Kunst biö zu diesem
Krieg in einem Nebel von Sentimentalität und un-
geklärter Freiheitsbegriffe verschwemmt war.
So gibt der Fall Leibl auf die Frage der deutschen
Kunst eine sinnfällige Antwort: Er hat nicht als der
Einsiedler von Aibling angefangen, sondern ist es ge-
worden; er war ein Pilotyschüler, aber er hat die besten
seiner Aeit als Lehrmeister gesucht und stand in der Ent-
wicklungslinie der modernen europäischen Kunst, als er
in seinem Meisterwerk das Wort Fichtes erfüllte, daß
deutsch sein eine Sache um ihrer selbst willen tun heißt.
Denn vier Sommer lang bis in den kalten Herbst an
dem selben Bild sitzen und dabei nicht die Frische ver-
lieren, Tag für Tag ein winziges Stück Bildflache an
die andere ullu primg. setzen und dabei die Größe des
Ganzen nicht gefährden, dazu gehört etwas anderes als
jene Stupidität, die Lenbach augenscheinlich mit seiner
„Auchthausarbeit" bezeichnen wollte, das geht über den
gewöhnlichen Ehrgeiz hinaus und ist nur durch das sichere
Gefühl der Verpflichtung gegen die Gesamtheit zu er-
klären: nicht der Einsiedler von Aibling, sondern die neue
45