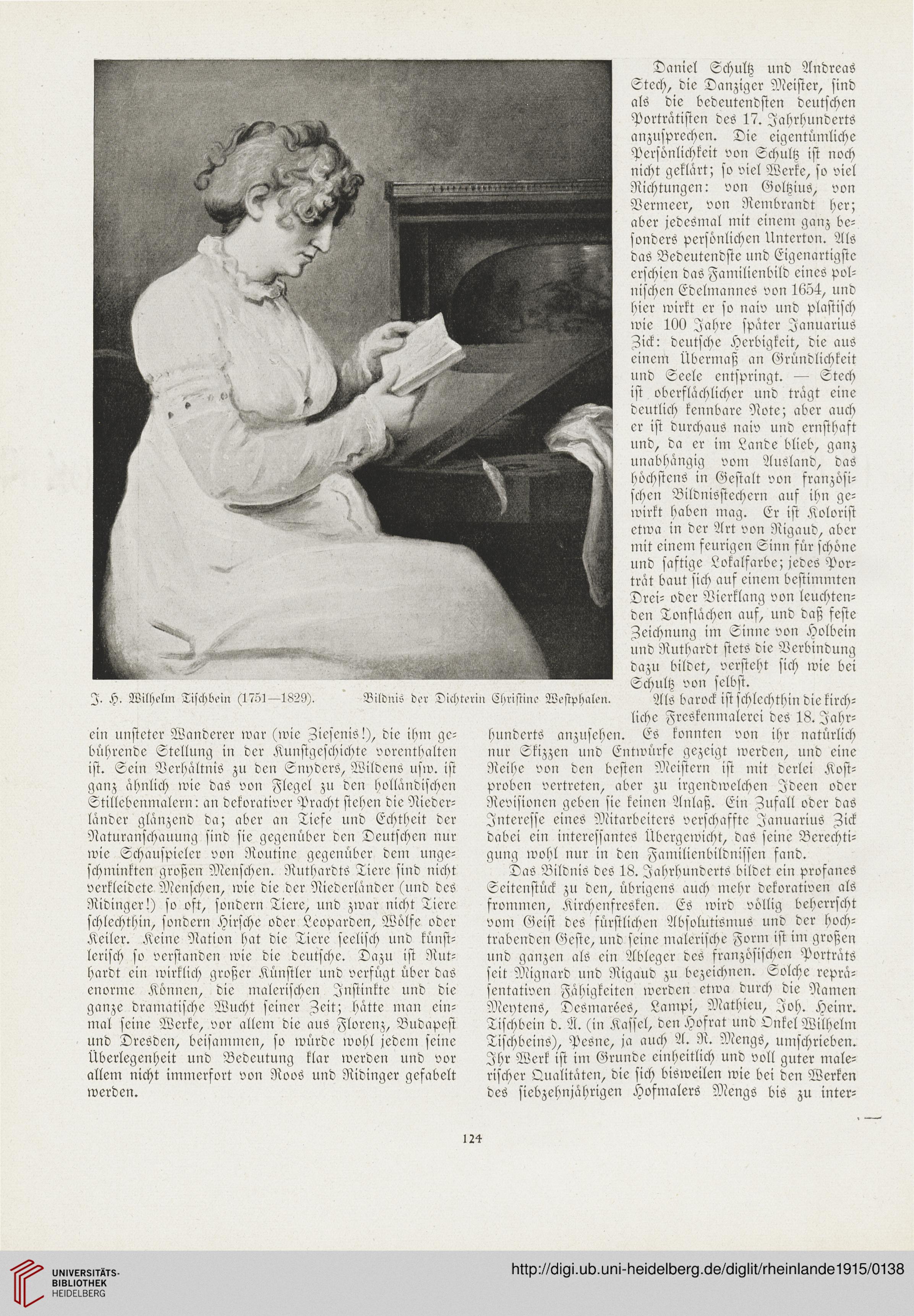I. H. Wilhelm Tischbcin (1?5l—1829). Bildnis der Dichteri» Chrisiine Wesiphalen.
ein unsteter Wanderer war (>vie Aiesenis!), die ihm ge-
bührende Stellung in der Kunstgeschichte vorenthalten
ist. Sein Verhaltnis zu den Snyderch Wildens usw. ist
ganz ahnlich wie das von Flegel zu den hollandischen
Stillebenmalern: an dekorativer Pracht stehen die Nieder-
lander glanzend da; aber an Tiefe und Echtheit der
Naturanschauung sind sie gegenüber den Deutschen nur
wie Schauspieler von Routine gegenüber de>n unge-
schminkten großen Menschen. Ruthardts Tiere sind nicht
verkleidete Menschen, ivie die der Niederländer (und des
Ridinger!) so oft, sondern Tiere, und zwar nicht Tiere
schlechthin, sondern Hirsche oder Leoparden, Wölfe oder
Keiler. Keine Nation hat die Tiere seelisch und künst-
lerisch so verstanden wie die deutsche. Dazu ist Rut-
hardt ein wirklich großer Künstler und versügt über das
enorme Können, die malerischen Jnstinkte und die
ganze dramatische Wucht seiner Aeit; hatte man ein-
n>al seine Werke, vor allem die aus Florenz, Budapest
und Dresden, beisammen, so würde wohl jedem seine
Überlegenheit und Bedeutung klar werden und vor
allem nicht immerfort von Roos und Ridinger gefabelt
werden.
Daniel Schultz und Andreas
Stech, die Danziger Meister, sind
als die bedeutendsten deutschen
Portratisten des 17. Jahrhunderts
anzusprechen. Die eigentümliche
Persönlichkeit von Schultz ist noch
nicht geklärt; so viel Werke, so viel
Richtungen: von Goltzius, von
Vermeer, von Rembrandt her;
aber jedesmal niit einem ganz be-
sonders persönlichen Unterton. Als
das Bedeutendste und Eigenartigstc
erschien das Familienbild eines pol-
nischen Edelmannes von 1654, und
hier wirkt er so naiv und plastisch
>vie 100 Jahre später Januarius
Aick: deutsche Herbigkeit, die aus
einein Ubermaß an Gründlichkeit
und Seele entspringt. — Stech
ist oberflachlicher und tragt eine
deutlich kennbare Note; aber auch
er ist durchaus naiv und ernsthaft
und, da er im Lande blieb, ganz
unabhängig voni Ausland, das
höchstens in Gestalt von sranzösi-
schen Bildnisstechern auf ihn ge-
wirkt haben mag. Er ist Kolorist
etwa in der Art von Rigaud, aber
mit einem feurigen Sinn für schöne
und saftige Lokalfarbe; jedes Por-
trät baut sich auf einem bestimmten
Drei- oder Vierklang von leuchten-
den Tonflächen auf, und daß feste
Aeichnung im Sinne von Holbein
und Ruthardt stets die Verbindung
dazu bildet, versteht sich wie bei
Schultz von selbst.
Als barock ist schlechthin die kirch-
liche Freskenmalerei des 18. Jahr-
hunderts anzusehen. Es konnten von ihr natürlich
»ur Skizzen und Entwürfe gezeigt werden, und eine
Reihe von den bcsten Meistern ist mit derlei Kost-
proben vertreten, aber zu irgendwelchen Ideen oder
Revisionen geben sie keinen Anlaß. Ein Aufall oder das
Jnteresse eines Mitarbeiters verschaffte Januarius Aick
dabei ein interessantes Übergewicht, das seine Berechti-
gung wohl nur in den Familienbildnissen fand.
Das Bildnis des 18. Jahrhunderts bildet ein profanes
Seitenstück zu den, übrigens auch mehr dekorativen als
frommen, Kirchenfresken. Es wird völlig beherrscht
vom Geist des fürstlichen Absolutismus und der hoch-
trabenden Geste, und seine malerische Form ist i»> großen
und ganzen als ein Ableger des französischen Porträts
seit Mignard und Rigaud zu bezeichnen. Solche repra-
sentativen Fahigkeiten werden etiva durch die Namen
Meytens, Desmaroes, Lampi, Mathieu, Joh. Heinr.
Tischbei» d. Ä. (in Kassel, den Hofrat und Onkel Wilhelm
Tischbeins), Pesne, ja auch A. R. Mengs, umschrieben.
Jhr Werk ist im Grunde einheitlich und voll guter male-
rischer Qualitätcn, die sich bisweilen wie bei den Werken
des siebzehnjährigen Hofmalers Mengs bis zu inter-
124
ein unsteter Wanderer war (>vie Aiesenis!), die ihm ge-
bührende Stellung in der Kunstgeschichte vorenthalten
ist. Sein Verhaltnis zu den Snyderch Wildens usw. ist
ganz ahnlich wie das von Flegel zu den hollandischen
Stillebenmalern: an dekorativer Pracht stehen die Nieder-
lander glanzend da; aber an Tiefe und Echtheit der
Naturanschauung sind sie gegenüber den Deutschen nur
wie Schauspieler von Routine gegenüber de>n unge-
schminkten großen Menschen. Ruthardts Tiere sind nicht
verkleidete Menschen, ivie die der Niederländer (und des
Ridinger!) so oft, sondern Tiere, und zwar nicht Tiere
schlechthin, sondern Hirsche oder Leoparden, Wölfe oder
Keiler. Keine Nation hat die Tiere seelisch und künst-
lerisch so verstanden wie die deutsche. Dazu ist Rut-
hardt ein wirklich großer Künstler und versügt über das
enorme Können, die malerischen Jnstinkte und die
ganze dramatische Wucht seiner Aeit; hatte man ein-
n>al seine Werke, vor allem die aus Florenz, Budapest
und Dresden, beisammen, so würde wohl jedem seine
Überlegenheit und Bedeutung klar werden und vor
allem nicht immerfort von Roos und Ridinger gefabelt
werden.
Daniel Schultz und Andreas
Stech, die Danziger Meister, sind
als die bedeutendsten deutschen
Portratisten des 17. Jahrhunderts
anzusprechen. Die eigentümliche
Persönlichkeit von Schultz ist noch
nicht geklärt; so viel Werke, so viel
Richtungen: von Goltzius, von
Vermeer, von Rembrandt her;
aber jedesmal niit einem ganz be-
sonders persönlichen Unterton. Als
das Bedeutendste und Eigenartigstc
erschien das Familienbild eines pol-
nischen Edelmannes von 1654, und
hier wirkt er so naiv und plastisch
>vie 100 Jahre später Januarius
Aick: deutsche Herbigkeit, die aus
einein Ubermaß an Gründlichkeit
und Seele entspringt. — Stech
ist oberflachlicher und tragt eine
deutlich kennbare Note; aber auch
er ist durchaus naiv und ernsthaft
und, da er im Lande blieb, ganz
unabhängig voni Ausland, das
höchstens in Gestalt von sranzösi-
schen Bildnisstechern auf ihn ge-
wirkt haben mag. Er ist Kolorist
etwa in der Art von Rigaud, aber
mit einem feurigen Sinn für schöne
und saftige Lokalfarbe; jedes Por-
trät baut sich auf einem bestimmten
Drei- oder Vierklang von leuchten-
den Tonflächen auf, und daß feste
Aeichnung im Sinne von Holbein
und Ruthardt stets die Verbindung
dazu bildet, versteht sich wie bei
Schultz von selbst.
Als barock ist schlechthin die kirch-
liche Freskenmalerei des 18. Jahr-
hunderts anzusehen. Es konnten von ihr natürlich
»ur Skizzen und Entwürfe gezeigt werden, und eine
Reihe von den bcsten Meistern ist mit derlei Kost-
proben vertreten, aber zu irgendwelchen Ideen oder
Revisionen geben sie keinen Anlaß. Ein Aufall oder das
Jnteresse eines Mitarbeiters verschaffte Januarius Aick
dabei ein interessantes Übergewicht, das seine Berechti-
gung wohl nur in den Familienbildnissen fand.
Das Bildnis des 18. Jahrhunderts bildet ein profanes
Seitenstück zu den, übrigens auch mehr dekorativen als
frommen, Kirchenfresken. Es wird völlig beherrscht
vom Geist des fürstlichen Absolutismus und der hoch-
trabenden Geste, und seine malerische Form ist i»> großen
und ganzen als ein Ableger des französischen Porträts
seit Mignard und Rigaud zu bezeichnen. Solche repra-
sentativen Fahigkeiten werden etiva durch die Namen
Meytens, Desmaroes, Lampi, Mathieu, Joh. Heinr.
Tischbei» d. Ä. (in Kassel, den Hofrat und Onkel Wilhelm
Tischbeins), Pesne, ja auch A. R. Mengs, umschrieben.
Jhr Werk ist im Grunde einheitlich und voll guter male-
rischer Qualitätcn, die sich bisweilen wie bei den Werken
des siebzehnjährigen Hofmalers Mengs bis zu inter-
124