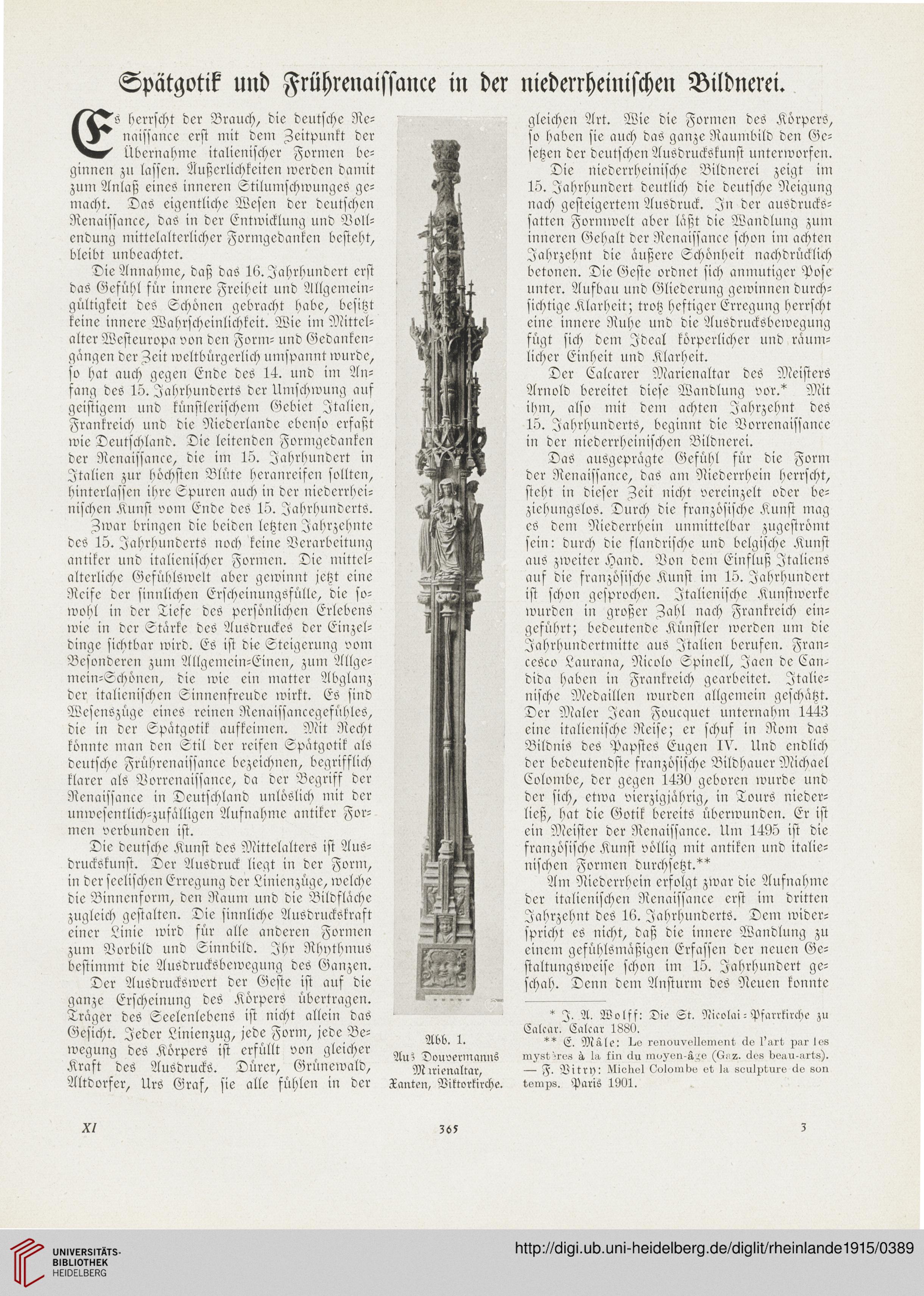Spätgotik und FrLjhrenmssance in der niederrheinischen Bildnerei.
s herrscht der Brauch, die deutsche Re-
R nnissance erst mit dem Aeitpunkt der
Übernahme italienischer Formen be-
ginnen zu lassen. Außerlichkeiten werden dannt
zum Anlaß eines inneren Stilumschwunges ge-
ncacht. Das eigentliche Wesen der deutschen
Renaissance, das in der Entwicklung und Voll-
endung mittelalterlicher Formgedanken besteht,
bleibt unbeachtet.
Die Annahme, daß das 16.Jahrhundert erst
das Gefühl für inncre Freiheit und Allgemein-
gültigkeit des Schönen gebracht habe, besitzt
keine innere Wahrscheinlichkeit. Wie inr Mittel-
alter Westeuropa von den Form- und Gedanken-
gängen der Aeit weltbürgerlich umspannt >vurde,
so hat auch gegen Ende des 14. und im An-
fang des 15. Jahrhunderts der Umschwung aus
geistigem und künstlerischeni Gebiet Jtalien,
Frankreich und die Niederlande ebenso erfaßt
wie Deutschland. Die leitenden Formgedanken
der Renaissance, die im 15. Jahrhundert in
Jtalien zur höchsten Blüte heranreifen sollten,
hinterlassen ihre Spuren auch in der niederrhei-
nischen Kunsi vom Ende des 15. Jahrhunderts.
Awar bringen die beiden letzte» Jahrzehntc
des 15. Jahrhunderts noch keine Verarbeitung
antiker und italienischer Formen. Die mittel-
alterliche Gefühlswelt aber gewinnt jetzt eine
Reife der sinnlichen Erscheinungsfülle, die so-
wohl in der Tiefe des persönlichen Erlebens
wie in dcr Starke des Ausdruckes der Einzel-
dinge sichtbar wird. Es ist die Steigerung vom
Besonderen zum Allgemein-Eincn, zum Allge-
mcin-Schönen, die wie ein matter Abglanz
der italienischen Sinnenfreude wirkt. Es sind
Wesenszüge eines reinen Renaissancegefühles,
die in der Spätgotik auskeimen. Mit Recht
könnte man den Stil der reifen Spatgotik alS
deutsche Frührenaissance bezeichnen, begrifflich
klarer als Vorrenaissance, da der Begriff der
Renaissance in Dcutschland unlöslich mit der
unwesentlich-zufalligen Aufnahme antiker For-
nien verbunden ist.
Die deutsche Kunst des Mittelalters ist Aus-
druckskunst. Der Ausdruck liegt in der Form,
in der seelischen Erregung der Linienzüge, welche
die Binnenform, den Naum und die Bildfläche
zugleich gestalten. Die sinnliche Ausdruckskraft
einer Linie wird für alle anderen Formen
zum Vorbild und Sinnbild. Jhr Rhythmus
bestimmt die Ausdrucksbewegung des Ganzen.
Der Ausdruckswert der Geste ist auf die
ganze Erscheinung des Körpers übertragen.
Träger des Seelenlebens ist nicht allein daS
Gesicht. Jeder Linienzug, jede Form, jede Be-
wegung des Körpers ist erfüllt von gleicher
Kraft des Ausdrucks. Dürer, Grünewald,
Altdorser, Urs Graf, sie alle fühlen in der
Abb. 1.
Au°> Douoermanns
M irienaltar,
Zkanten, Biktorkirche.
gleichen Art. Wie die Formeu des Körpers,
so haben sie auch das ganze Raumbild den Ge-
setzen der deutschen AusdruckSkunst unterworfen.
Die niederrheinische Bildnerei zeigt im
15. Jahrhundert deutlich die deutsche Neigung
nach gesteigerteni Ausdruck. Jn der ausdrucks-
satten Formwelt aber läßt die Wandlung zum
inneren Gehalt der Renaissance schon im achten
Jahrzehnt die äußere Schönhcit nachdrücklich
betonen. Die Geste ordnet sich anniutiger Pose
unter. Aufbau und Gliederung gewinnen durch-
sichtige Klarheit; trotz heftiger Erregung herrscht
eine innere Ruhe und die AuSdrucksbewegung
fügt sich dem Jdeal körperlicher und räum-
licher Einheit und Klarheit.
Der Calcarer Marienaltar des Meisters
Arnold bereitet diese Wandlung vor/ Mit
ihm, also mit dem achten Jahrzehnt des
15. JahrhundertS, beginnt die Vorrenaissance
in der niederrheinischen Bildnerei.
Das auSgepragte Gefühl für die Form
der Renaissance, das am Niederrhein herrscht,
steht in dieser Aeit nicht vereinzelt oder be-
ziehungslos. Durch die französische Kunst mag
es deni Niederrhein unmittelbar zugeströmt
sein i durch die flandrische und belgische Kunst
aus zweiter Hand. Von dem Einsluß Jtaliens
auf die französische Kunst im 15. Jahrhundert
ist schon gesprochen. Jtalienische Kunstwerke
ivurden in großer Aahl nach Frankreich ein-
geführt; bedeutende Künstler werden uni die
Jahrhundertmitte aus Jtalien berufen. Fran-
cesco Laurana, Nicolo Spinell, Jaen de Can-
dida haben in Frankreich gearbeitet. Jtalie-
nische Medaillen wurden allgemein geschätzt.
Der Maler Jean Foucquet unternahm 1443
eine italienische Reise; er schuf in Rom das
Bildnis des Papstes Eugen IV. Und endlich
der bedeutendste französische Bildhauer Michael
Colombe, der gegen 1430 geboren wurde und
der sich, etwa vierzigjährig, in Tours nieder-
ließ, hat die Gotik bereits überwunden. Er ist
ein Meister der Renaissance. Um 1495 ist die
sranzösische Kunst völlig mit antiken und italie-
nischen Formen durchsetzt.* **
Äm Niederrhein ersolgt zwar die Aufnahme
der italienischen Renaissance erst im dritten
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Deni wider-
spricht es nicht, daß die innere Wandlung zu
einem gefühlsmäßigen Erfassen der neuen Ge-
staltungsweise schon im 15. Jahrhundert ge-
schah. Denn dem Ansturni des Neuen konnte
* I. A. Wolff: Die St. Nicolai - Pfarrkirche zu
Calcar. Calcar 1880.
E. Mülc: 6s rsiiouvslloment cls I'art ziar Iss
ruxstlrss ä. la tiu ctu movcasurs (6n clss bsau-arts).
—. F. Vitryl Nisicsl Ooloiubs st la soulyturs cts sou
tsmps. Paris 1901.
Z05
X/
Z
s herrscht der Brauch, die deutsche Re-
R nnissance erst mit dem Aeitpunkt der
Übernahme italienischer Formen be-
ginnen zu lassen. Außerlichkeiten werden dannt
zum Anlaß eines inneren Stilumschwunges ge-
ncacht. Das eigentliche Wesen der deutschen
Renaissance, das in der Entwicklung und Voll-
endung mittelalterlicher Formgedanken besteht,
bleibt unbeachtet.
Die Annahme, daß das 16.Jahrhundert erst
das Gefühl für inncre Freiheit und Allgemein-
gültigkeit des Schönen gebracht habe, besitzt
keine innere Wahrscheinlichkeit. Wie inr Mittel-
alter Westeuropa von den Form- und Gedanken-
gängen der Aeit weltbürgerlich umspannt >vurde,
so hat auch gegen Ende des 14. und im An-
fang des 15. Jahrhunderts der Umschwung aus
geistigem und künstlerischeni Gebiet Jtalien,
Frankreich und die Niederlande ebenso erfaßt
wie Deutschland. Die leitenden Formgedanken
der Renaissance, die im 15. Jahrhundert in
Jtalien zur höchsten Blüte heranreifen sollten,
hinterlassen ihre Spuren auch in der niederrhei-
nischen Kunsi vom Ende des 15. Jahrhunderts.
Awar bringen die beiden letzte» Jahrzehntc
des 15. Jahrhunderts noch keine Verarbeitung
antiker und italienischer Formen. Die mittel-
alterliche Gefühlswelt aber gewinnt jetzt eine
Reife der sinnlichen Erscheinungsfülle, die so-
wohl in der Tiefe des persönlichen Erlebens
wie in dcr Starke des Ausdruckes der Einzel-
dinge sichtbar wird. Es ist die Steigerung vom
Besonderen zum Allgemein-Eincn, zum Allge-
mcin-Schönen, die wie ein matter Abglanz
der italienischen Sinnenfreude wirkt. Es sind
Wesenszüge eines reinen Renaissancegefühles,
die in der Spätgotik auskeimen. Mit Recht
könnte man den Stil der reifen Spatgotik alS
deutsche Frührenaissance bezeichnen, begrifflich
klarer als Vorrenaissance, da der Begriff der
Renaissance in Dcutschland unlöslich mit der
unwesentlich-zufalligen Aufnahme antiker For-
nien verbunden ist.
Die deutsche Kunst des Mittelalters ist Aus-
druckskunst. Der Ausdruck liegt in der Form,
in der seelischen Erregung der Linienzüge, welche
die Binnenform, den Naum und die Bildfläche
zugleich gestalten. Die sinnliche Ausdruckskraft
einer Linie wird für alle anderen Formen
zum Vorbild und Sinnbild. Jhr Rhythmus
bestimmt die Ausdrucksbewegung des Ganzen.
Der Ausdruckswert der Geste ist auf die
ganze Erscheinung des Körpers übertragen.
Träger des Seelenlebens ist nicht allein daS
Gesicht. Jeder Linienzug, jede Form, jede Be-
wegung des Körpers ist erfüllt von gleicher
Kraft des Ausdrucks. Dürer, Grünewald,
Altdorser, Urs Graf, sie alle fühlen in der
Abb. 1.
Au°> Douoermanns
M irienaltar,
Zkanten, Biktorkirche.
gleichen Art. Wie die Formeu des Körpers,
so haben sie auch das ganze Raumbild den Ge-
setzen der deutschen AusdruckSkunst unterworfen.
Die niederrheinische Bildnerei zeigt im
15. Jahrhundert deutlich die deutsche Neigung
nach gesteigerteni Ausdruck. Jn der ausdrucks-
satten Formwelt aber läßt die Wandlung zum
inneren Gehalt der Renaissance schon im achten
Jahrzehnt die äußere Schönhcit nachdrücklich
betonen. Die Geste ordnet sich anniutiger Pose
unter. Aufbau und Gliederung gewinnen durch-
sichtige Klarheit; trotz heftiger Erregung herrscht
eine innere Ruhe und die AuSdrucksbewegung
fügt sich dem Jdeal körperlicher und räum-
licher Einheit und Klarheit.
Der Calcarer Marienaltar des Meisters
Arnold bereitet diese Wandlung vor/ Mit
ihm, also mit dem achten Jahrzehnt des
15. JahrhundertS, beginnt die Vorrenaissance
in der niederrheinischen Bildnerei.
Das auSgepragte Gefühl für die Form
der Renaissance, das am Niederrhein herrscht,
steht in dieser Aeit nicht vereinzelt oder be-
ziehungslos. Durch die französische Kunst mag
es deni Niederrhein unmittelbar zugeströmt
sein i durch die flandrische und belgische Kunst
aus zweiter Hand. Von dem Einsluß Jtaliens
auf die französische Kunst im 15. Jahrhundert
ist schon gesprochen. Jtalienische Kunstwerke
ivurden in großer Aahl nach Frankreich ein-
geführt; bedeutende Künstler werden uni die
Jahrhundertmitte aus Jtalien berufen. Fran-
cesco Laurana, Nicolo Spinell, Jaen de Can-
dida haben in Frankreich gearbeitet. Jtalie-
nische Medaillen wurden allgemein geschätzt.
Der Maler Jean Foucquet unternahm 1443
eine italienische Reise; er schuf in Rom das
Bildnis des Papstes Eugen IV. Und endlich
der bedeutendste französische Bildhauer Michael
Colombe, der gegen 1430 geboren wurde und
der sich, etwa vierzigjährig, in Tours nieder-
ließ, hat die Gotik bereits überwunden. Er ist
ein Meister der Renaissance. Um 1495 ist die
sranzösische Kunst völlig mit antiken und italie-
nischen Formen durchsetzt.* **
Äm Niederrhein ersolgt zwar die Aufnahme
der italienischen Renaissance erst im dritten
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Deni wider-
spricht es nicht, daß die innere Wandlung zu
einem gefühlsmäßigen Erfassen der neuen Ge-
staltungsweise schon im 15. Jahrhundert ge-
schah. Denn dem Ansturni des Neuen konnte
* I. A. Wolff: Die St. Nicolai - Pfarrkirche zu
Calcar. Calcar 1880.
E. Mülc: 6s rsiiouvslloment cls I'art ziar Iss
ruxstlrss ä. la tiu ctu movcasurs (6n clss bsau-arts).
—. F. Vitryl Nisicsl Ooloiubs st la soulyturs cts sou
tsmps. Paris 1901.
Z05
X/
Z