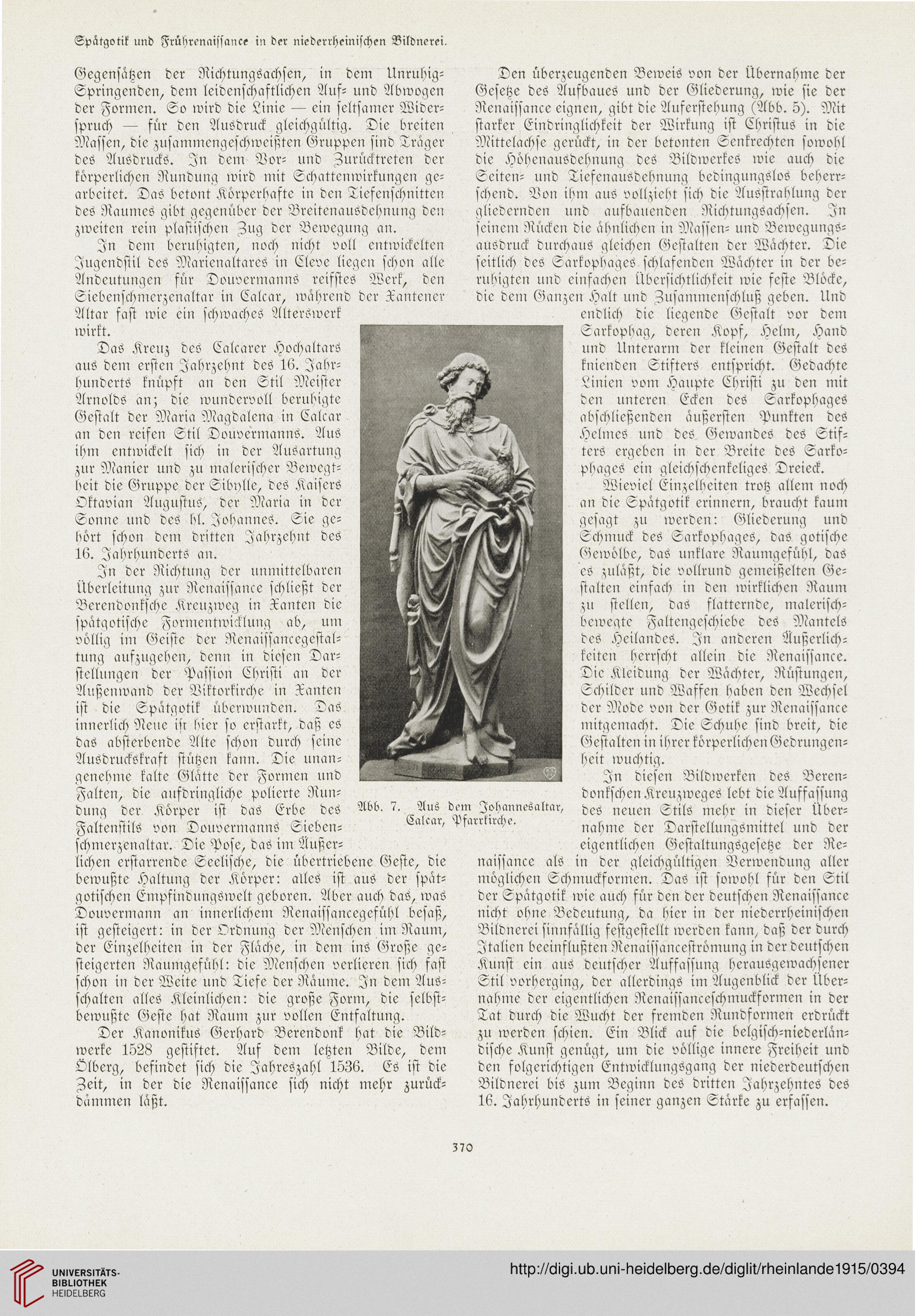Spätgotik und Frührenaissance in dcr niederrheinischen Bildnerei.
Gegensätzen der Richtungsachsen, in dem Unruhig-
Springenden, dem leidenschaftlichen Auf- und Abwogen
der Formen. So wird die Linie — ein seltsamer Wider-
spruch — für den Ausdruck gleichgültig. Die breiten
Massen, die zusammengeschweißten Gruppen sind Trager
des Ausdrucks. Jn dem Vor- und Aurücktreten der
körperlichen Rundrmg wird mit Schattenwirkungen ge-
arbeitet. Das betont Körperhafte in den Ticfenschnitten
des Raumcs gibt gegenüber der Breitenausdehnung den
zweiten rein plastischen Aug der Bewegung an.
Jn dem bcruhigten, noch nicht voll entuückelten
Jugendfiil des Marienaltares in Cleve liegen schon alle
Andecttungen für Douvermanns reisstes Werk, den
Siebenschmerzenaltar in Calcar, wahrend der Rantcncr
Altar fast wie cin schwaches Alterswcrk
wirkt.
Das Kreuz des Calcarer Hochaltars
aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jabr-
htluderts knüpft an den Stil Meister
Arnolds an; die wundervoll berulügte
Gestalt der Maria Magdalena in Calcar
an den reifen Stil Douvermanns. Aus
ihm entwickelt sich in der Ausartung
zur Manier und zu malerischer Bewegt-
heit die Gruppe der Sibvllc, des Kaiscrs
Oktavian Augustus, der Maria in dcr
Sonne und des bl. Johannes. Sie ge-
bört schon dem drittcn Jahrzehnt des
16. Jahrhunderts an.
Jn der Nichtung der unmittelbaren
llberleitung zur Renaissance schließt der
Berendonksche Kreuzweg in Ranten die
spatgotische Fornientwicklung ab, um
völlig im Geiste der Renaissancegestal-
tung aufzugehen, dcnn in dicsen Dar-
stellungen der Passion Christi an der
Außemvand der Viktorkirche in Ranten
ist die Spätgotik überuumden. Das
innerlich Neue ist bier so erstarkt, daß es
das absterbende Alte schon durch seine
Ausdruckskraft stützen kann. Die unan-
genehnie kalte Glatte der Formen und
Falten, die aufdringliche polierte Run-
dung der Körper ist das Erbe des
Faltenstils von Douvermanns Sieben-
schmerzenaltar. Die Pose, das im Äußer-
lichen erstarrende Seelische, die übertriebene Geste, die
bewußte Haltung der Körper: alles ist aus der spat-
gotischen Empfindungswelt geboren. Aber auch das, waS
Douvermann an innerlichem Renaissancegefühl besaß,
ist gesteigert: in der Ordnung der Menschcn im Raum,
der Einzelheiten in der Fläche, in dem ins Große ge-
steigerten Raumgefübl: die Menschen verlieren sich fast
schon in der Weite und Tiefe der Räume. Jn dem Aus-
schalten alles Kleinlichen: die große Form, die selbst-
bewußte Geste hat Raum zur vollen Entfaltung.
Der Kanonikus Gerhard Berendonk hat die Bild-
werke 1528 gestiftet. Auf dem letzten Bilde, dem
Ölberg, befindet sich die Jahreszahl 1536. Es ist die
Aeit, in der die Renaissance sich nicht mehr zurück-
dämmen läßt.
Den überzeugenden Beweis von der Übernahme der
Gesetze des Aufbaues und der Gliederung, wie sie der
Renaissance eignen, gibt die Auferstehung (Abb. 5). Mit
starker Eindringlichkeit der Wirkung ist Christus in die
Mittelachse gerückt, in der betonten Senkrechten sowohl
die Höhenausdehnung deS Bildwcrkes wie auch die
Seiten- und Tiefenausdehnung bedingungslos beherr-
schend. Von ihm auS vollzieht sich die Ausstrahlung der
gliedernden und aufbauenden Richtungsachsen. Jn
seineni Rücken die ähnlichen in Massen- und Bewegungs-
ausdruck durchaus gleichen Gestalten der Wachter. Die
seitlich des Sarkopbages schlafenden Wächter in der be-
ruhigten und einfachen Übersichtlichkeit wie feste Blöcke,
die dem Ganzen Halt und Ausammenschluß geben. llnd
endlich die liegende Gestalt vor dem
Sarkophag, deren Kopf, Helm, Hand
und Unterarm der kleinen Gestalt des
knienden Stifters entspricht. Gedachte
Linien vom Haupte Christi zu den niit
den untcreu Ecken des Sarkophages
abschließenden äußersten Punkten des
Helmes und des Gewandes des Stif-
ters ergeben in der Breite des Sarko-
phages ein gleichschenkeliges Dreieck.
Wieviel Einzelheiten trotz allem noch
an die Spätgotik erinnern, braucht kaum
gesagt zu werden: Gliederung und
Schmuck des Sarkophages, das gotische
Gewölbe, das unklare Raumgefühl, das
es zuläßt, die vollrund gemeißelten Ge-
stalten einfach in den wirklichen Raum
zu stellen, das flatternde, malerisch-
bcwegtc Faltengeschiebe des Mantels
des Heilandes. Jn anderen Äußerlich-
keiteu herrscht allein die Renaissance.
Die Kleidung der Wachter, Rüstungen,
Schilder und Waffen haben den Wechsel
der Mode von der Gotik zur Renaissance
mitgemacht. Die Schuhe sind breit, die
Gestalten in ihrer körperlichenGedrungen-
heit wuchtig.
Jn diesen Bildwerken des Beren-
donkschen Kreuzweges lebt die Auffassung
des neuen Stils mehr in dieser Uber-
nahme der Darstellungsmittel und der
eigentlichen Gestaltungsgesetze der Re-
naissance als in der gleichgültigen Verwendung aller
möglichen Schmuckformcn. Das ist sowohl für den Stil
dcr Spätgotik wie auch für den der deutschen Renaissance
nicht ohne Bedeutung, da hier in der niederrheinischen
Bildnerei sinnfällig festgestellt werden kann, daß der durch
Jtalien beeinflußten Renaissanceströmung in der deutschen
Kunst ein aus deutscher Auffassung herausgewachsener
Stil vorherging, der allerdings im Äugenblick der Über-
nahme der eigentlicheu Renaissanceschmuckformen in der
Tat durch die Wucht der fremden Rundformen erdrückt
zu werden schien. Ein Blick auf die belgisch-niederlän-
dische Kunst genügt, um die völlige innere Freiheit und
den folgerichtigen Entwicklungsgang der niederdeutschen
Bildnerei bis zum Beginn des dritten Jahrzehntes des
16. Jahrhunderts in seiner ganzen Starke zu erfassen.
Abb. 7. Aus dem Johannesaltar,
Calcar, Pfarrkirche.
Gegensätzen der Richtungsachsen, in dem Unruhig-
Springenden, dem leidenschaftlichen Auf- und Abwogen
der Formen. So wird die Linie — ein seltsamer Wider-
spruch — für den Ausdruck gleichgültig. Die breiten
Massen, die zusammengeschweißten Gruppen sind Trager
des Ausdrucks. Jn dem Vor- und Aurücktreten der
körperlichen Rundrmg wird mit Schattenwirkungen ge-
arbeitet. Das betont Körperhafte in den Ticfenschnitten
des Raumcs gibt gegenüber der Breitenausdehnung den
zweiten rein plastischen Aug der Bewegung an.
Jn dem bcruhigten, noch nicht voll entuückelten
Jugendfiil des Marienaltares in Cleve liegen schon alle
Andecttungen für Douvermanns reisstes Werk, den
Siebenschmerzenaltar in Calcar, wahrend der Rantcncr
Altar fast wie cin schwaches Alterswcrk
wirkt.
Das Kreuz des Calcarer Hochaltars
aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jabr-
htluderts knüpft an den Stil Meister
Arnolds an; die wundervoll berulügte
Gestalt der Maria Magdalena in Calcar
an den reifen Stil Douvermanns. Aus
ihm entwickelt sich in der Ausartung
zur Manier und zu malerischer Bewegt-
heit die Gruppe der Sibvllc, des Kaiscrs
Oktavian Augustus, der Maria in dcr
Sonne und des bl. Johannes. Sie ge-
bört schon dem drittcn Jahrzehnt des
16. Jahrhunderts an.
Jn der Nichtung der unmittelbaren
llberleitung zur Renaissance schließt der
Berendonksche Kreuzweg in Ranten die
spatgotische Fornientwicklung ab, um
völlig im Geiste der Renaissancegestal-
tung aufzugehen, dcnn in dicsen Dar-
stellungen der Passion Christi an der
Außemvand der Viktorkirche in Ranten
ist die Spätgotik überuumden. Das
innerlich Neue ist bier so erstarkt, daß es
das absterbende Alte schon durch seine
Ausdruckskraft stützen kann. Die unan-
genehnie kalte Glatte der Formen und
Falten, die aufdringliche polierte Run-
dung der Körper ist das Erbe des
Faltenstils von Douvermanns Sieben-
schmerzenaltar. Die Pose, das im Äußer-
lichen erstarrende Seelische, die übertriebene Geste, die
bewußte Haltung der Körper: alles ist aus der spat-
gotischen Empfindungswelt geboren. Aber auch das, waS
Douvermann an innerlichem Renaissancegefühl besaß,
ist gesteigert: in der Ordnung der Menschcn im Raum,
der Einzelheiten in der Fläche, in dem ins Große ge-
steigerten Raumgefübl: die Menschen verlieren sich fast
schon in der Weite und Tiefe der Räume. Jn dem Aus-
schalten alles Kleinlichen: die große Form, die selbst-
bewußte Geste hat Raum zur vollen Entfaltung.
Der Kanonikus Gerhard Berendonk hat die Bild-
werke 1528 gestiftet. Auf dem letzten Bilde, dem
Ölberg, befindet sich die Jahreszahl 1536. Es ist die
Aeit, in der die Renaissance sich nicht mehr zurück-
dämmen läßt.
Den überzeugenden Beweis von der Übernahme der
Gesetze des Aufbaues und der Gliederung, wie sie der
Renaissance eignen, gibt die Auferstehung (Abb. 5). Mit
starker Eindringlichkeit der Wirkung ist Christus in die
Mittelachse gerückt, in der betonten Senkrechten sowohl
die Höhenausdehnung deS Bildwcrkes wie auch die
Seiten- und Tiefenausdehnung bedingungslos beherr-
schend. Von ihm auS vollzieht sich die Ausstrahlung der
gliedernden und aufbauenden Richtungsachsen. Jn
seineni Rücken die ähnlichen in Massen- und Bewegungs-
ausdruck durchaus gleichen Gestalten der Wachter. Die
seitlich des Sarkopbages schlafenden Wächter in der be-
ruhigten und einfachen Übersichtlichkeit wie feste Blöcke,
die dem Ganzen Halt und Ausammenschluß geben. llnd
endlich die liegende Gestalt vor dem
Sarkophag, deren Kopf, Helm, Hand
und Unterarm der kleinen Gestalt des
knienden Stifters entspricht. Gedachte
Linien vom Haupte Christi zu den niit
den untcreu Ecken des Sarkophages
abschließenden äußersten Punkten des
Helmes und des Gewandes des Stif-
ters ergeben in der Breite des Sarko-
phages ein gleichschenkeliges Dreieck.
Wieviel Einzelheiten trotz allem noch
an die Spätgotik erinnern, braucht kaum
gesagt zu werden: Gliederung und
Schmuck des Sarkophages, das gotische
Gewölbe, das unklare Raumgefühl, das
es zuläßt, die vollrund gemeißelten Ge-
stalten einfach in den wirklichen Raum
zu stellen, das flatternde, malerisch-
bcwegtc Faltengeschiebe des Mantels
des Heilandes. Jn anderen Äußerlich-
keiteu herrscht allein die Renaissance.
Die Kleidung der Wachter, Rüstungen,
Schilder und Waffen haben den Wechsel
der Mode von der Gotik zur Renaissance
mitgemacht. Die Schuhe sind breit, die
Gestalten in ihrer körperlichenGedrungen-
heit wuchtig.
Jn diesen Bildwerken des Beren-
donkschen Kreuzweges lebt die Auffassung
des neuen Stils mehr in dieser Uber-
nahme der Darstellungsmittel und der
eigentlichen Gestaltungsgesetze der Re-
naissance als in der gleichgültigen Verwendung aller
möglichen Schmuckformcn. Das ist sowohl für den Stil
dcr Spätgotik wie auch für den der deutschen Renaissance
nicht ohne Bedeutung, da hier in der niederrheinischen
Bildnerei sinnfällig festgestellt werden kann, daß der durch
Jtalien beeinflußten Renaissanceströmung in der deutschen
Kunst ein aus deutscher Auffassung herausgewachsener
Stil vorherging, der allerdings im Äugenblick der Über-
nahme der eigentlicheu Renaissanceschmuckformen in der
Tat durch die Wucht der fremden Rundformen erdrückt
zu werden schien. Ein Blick auf die belgisch-niederlän-
dische Kunst genügt, um die völlige innere Freiheit und
den folgerichtigen Entwicklungsgang der niederdeutschen
Bildnerei bis zum Beginn des dritten Jahrzehntes des
16. Jahrhunderts in seiner ganzen Starke zu erfassen.
Abb. 7. Aus dem Johannesaltar,
Calcar, Pfarrkirche.