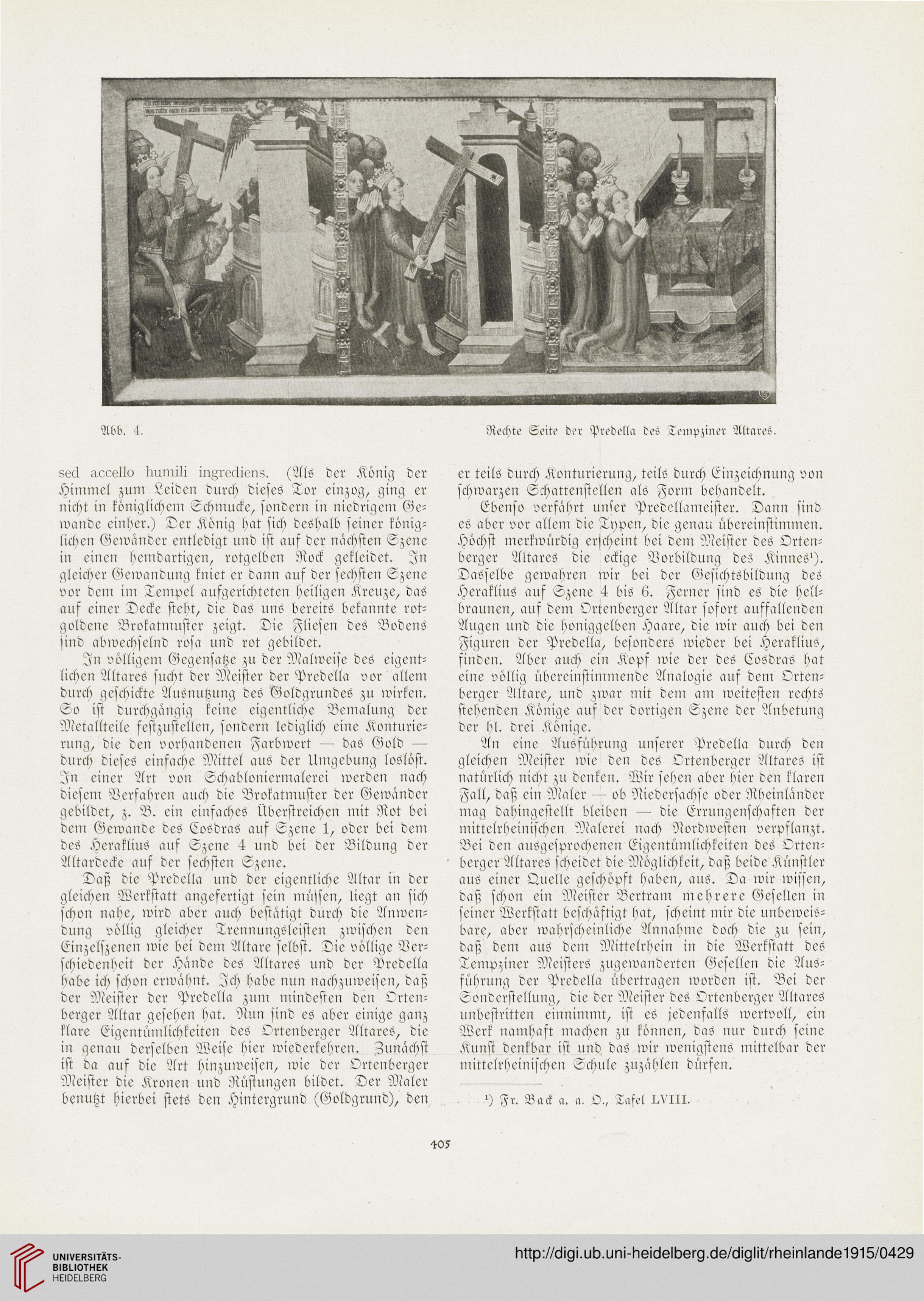Abb. 4.
8sä g.ccs11o luurlili inArsc1ieli3. (Als der König der
Himmel zum Leiden durch dieses Tor einzog, ging er
nicht in königlichem Schmucke, sondern in niedrigem Ge-
wande cinher.) Der König hat sich deshalb seiner könig-
lichen Gewander entledigt und ist auf der nachsten Szene
in einen hemdartigen, rotgelben Rock gekleidet. Jn
gleicher Gewandung kniet er dann auf der sechsten Szene
vor dem im Tempel aufgerichteten heiligen Kreuze, das
auf einer Decke steht, die das uns bereits bekannte rot-
goldene Brokatmuster zeigt. Die Fliesen des Bodens
sind abwechselnd rosa und rot gebildet.
Jn völligem Gegensatze zu der Malweise des eigent-
lichen Altares sucht der Meister der Predella vor allem
durch geschickte Ausnutzung des Goldgrilndes zu wirken.
So ist durchgangig keine eigentliche Bemalung der
Metallteile festzustellen, sondern lediglich eine Konturie-
rung, die den vorhandenen Farbwcrt — das Gold —
durch dieses einfache Mittel aus der Umgebung loslöst.
Jn einer Art von Schabloniermalerei werden nach
diesem Verfahren auch die Brokatmuster der Gewänder
gebildet, z. B. ein einfaches Uberstreichen mit Rot bei
dem Gewande des Cosdras auf Szene 1, oder bei dem
des Heraklius auf Szene 4 und bei der Bildung der
Altardecke auf der sechsten Szene.
Daß die Predella und der eigentliche Altar in der
gleichen Werkstatt angefertigt sein müssen, liegt an sich
schon nahe, wird aber auch bestätigt durch die Anwen-
dung völlig gleicher Trennungsleisten zwischen den
Einzelszenen wie bei dem Altare selbst. Die völlige Ver-
schiedenheit der Hande des Altares und der Predella
habe ich schon erwähnt. Jch habe nun nachzuweisen, daß
der Meister der Predella zuni mindesten den Orten-
berger Altar gesehen hat. Nun sind es aber einige ganz
klare Eigentümlichkciten des Ortenberger Altares, die
in genau derselben Weise hier wiederkehren. Aunachst
ist da auf die Art hinzuweisen, wie der Ortenberger
Meister die Kronen und Rüstungen bildet. Der Maler
benutzt hierbei stets den Hintergrund (Goldgrund), den
Rechte Seite der Predella des Tempziner Altares.
er teils durch Konturierung, teils durch Einzeichnung von
schwarzen Schattenstellen als Form behandelt.
Ebenso verfährt unser Predellameister. Dann sind
es aber vor allem die Typen, die genau übereinstimmen.
Höchst merkwürdig erscheint bei dem Meister des Orten-
berger Altares die eckige Vorbildung des KinnesH.
Dasselbe gewahren wir bei der Gesichtsbildung des
Heraklius auf Szene 4 bis 6. Ferner sind es die hell-
braunen, auf dem Ortenberger Altar sofort auffallenden
Augen und die honiggelben Haare, die wir auch bei den
Figuren der Predella, besonders wieder bei Heraklius,
finden. Aber auch ein Kopf wie der des Cosdras hat
eine völlig übereinstimmende Analogie auf dem Orten-
berger Altare, und zwar mit dem am weitesten rechts
stehenden Könige auf der dortigen Szene der Anbetung
der hl. drei Könige.
An eine Ausführung unserer Predella durch den
gleichen Meister wie den des Ortenberger Altares ist
natürlich nicht zu denken. Wir sehen aber hier den klaren
Fall, daß ein Maler — ob Niedersachse oder Rheinländer
mag dahingestellt bleiben — die Errungenschaften der
mittelrheinischen Malerei nach Nordwesten verpflanzt.
Bei den ausgesprochenen Eigentümlichkeiten des Orten-
berger Altares scheidet die Möglichkeit, daß beide Künstler
aus einer Ouelle geschöpft haben, aus. Da wir wissen,
daß schon ein Meister Bertram mehrere Gesellen in
seiner Werkstatt beschäftigt hat, scheint mir die unbeweis-
bare, aber wahrscheinliche Annahme doch die zu sein,
daß dem aus dem Mittelrhein in die Werkstatt des
Tempziner Meisters zugewanderten Gesellen die Aus-
führung der Predella übertragen worden ist. Bei der
Sonderstellung, die der Meister des Ortenberger Altares
unbestritten einnimmt, ist es jedenfalls wertvoll, ein
Werk namhaft machen zu können, das nur durch seine
Kunst denkbar ist und. das wir wenigstens mittelbar der
mittelrheinischen Schule zuzahlen dürfen.
405
H Fr. Back a. a. O., Tafel TVIII.
8sä g.ccs11o luurlili inArsc1ieli3. (Als der König der
Himmel zum Leiden durch dieses Tor einzog, ging er
nicht in königlichem Schmucke, sondern in niedrigem Ge-
wande cinher.) Der König hat sich deshalb seiner könig-
lichen Gewander entledigt und ist auf der nachsten Szene
in einen hemdartigen, rotgelben Rock gekleidet. Jn
gleicher Gewandung kniet er dann auf der sechsten Szene
vor dem im Tempel aufgerichteten heiligen Kreuze, das
auf einer Decke steht, die das uns bereits bekannte rot-
goldene Brokatmuster zeigt. Die Fliesen des Bodens
sind abwechselnd rosa und rot gebildet.
Jn völligem Gegensatze zu der Malweise des eigent-
lichen Altares sucht der Meister der Predella vor allem
durch geschickte Ausnutzung des Goldgrilndes zu wirken.
So ist durchgangig keine eigentliche Bemalung der
Metallteile festzustellen, sondern lediglich eine Konturie-
rung, die den vorhandenen Farbwcrt — das Gold —
durch dieses einfache Mittel aus der Umgebung loslöst.
Jn einer Art von Schabloniermalerei werden nach
diesem Verfahren auch die Brokatmuster der Gewänder
gebildet, z. B. ein einfaches Uberstreichen mit Rot bei
dem Gewande des Cosdras auf Szene 1, oder bei dem
des Heraklius auf Szene 4 und bei der Bildung der
Altardecke auf der sechsten Szene.
Daß die Predella und der eigentliche Altar in der
gleichen Werkstatt angefertigt sein müssen, liegt an sich
schon nahe, wird aber auch bestätigt durch die Anwen-
dung völlig gleicher Trennungsleisten zwischen den
Einzelszenen wie bei dem Altare selbst. Die völlige Ver-
schiedenheit der Hande des Altares und der Predella
habe ich schon erwähnt. Jch habe nun nachzuweisen, daß
der Meister der Predella zuni mindesten den Orten-
berger Altar gesehen hat. Nun sind es aber einige ganz
klare Eigentümlichkciten des Ortenberger Altares, die
in genau derselben Weise hier wiederkehren. Aunachst
ist da auf die Art hinzuweisen, wie der Ortenberger
Meister die Kronen und Rüstungen bildet. Der Maler
benutzt hierbei stets den Hintergrund (Goldgrund), den
Rechte Seite der Predella des Tempziner Altares.
er teils durch Konturierung, teils durch Einzeichnung von
schwarzen Schattenstellen als Form behandelt.
Ebenso verfährt unser Predellameister. Dann sind
es aber vor allem die Typen, die genau übereinstimmen.
Höchst merkwürdig erscheint bei dem Meister des Orten-
berger Altares die eckige Vorbildung des KinnesH.
Dasselbe gewahren wir bei der Gesichtsbildung des
Heraklius auf Szene 4 bis 6. Ferner sind es die hell-
braunen, auf dem Ortenberger Altar sofort auffallenden
Augen und die honiggelben Haare, die wir auch bei den
Figuren der Predella, besonders wieder bei Heraklius,
finden. Aber auch ein Kopf wie der des Cosdras hat
eine völlig übereinstimmende Analogie auf dem Orten-
berger Altare, und zwar mit dem am weitesten rechts
stehenden Könige auf der dortigen Szene der Anbetung
der hl. drei Könige.
An eine Ausführung unserer Predella durch den
gleichen Meister wie den des Ortenberger Altares ist
natürlich nicht zu denken. Wir sehen aber hier den klaren
Fall, daß ein Maler — ob Niedersachse oder Rheinländer
mag dahingestellt bleiben — die Errungenschaften der
mittelrheinischen Malerei nach Nordwesten verpflanzt.
Bei den ausgesprochenen Eigentümlichkeiten des Orten-
berger Altares scheidet die Möglichkeit, daß beide Künstler
aus einer Ouelle geschöpft haben, aus. Da wir wissen,
daß schon ein Meister Bertram mehrere Gesellen in
seiner Werkstatt beschäftigt hat, scheint mir die unbeweis-
bare, aber wahrscheinliche Annahme doch die zu sein,
daß dem aus dem Mittelrhein in die Werkstatt des
Tempziner Meisters zugewanderten Gesellen die Aus-
führung der Predella übertragen worden ist. Bei der
Sonderstellung, die der Meister des Ortenberger Altares
unbestritten einnimmt, ist es jedenfalls wertvoll, ein
Werk namhaft machen zu können, das nur durch seine
Kunst denkbar ist und. das wir wenigstens mittelbar der
mittelrheinischen Schule zuzahlen dürfen.
405
H Fr. Back a. a. O., Tafel TVIII.