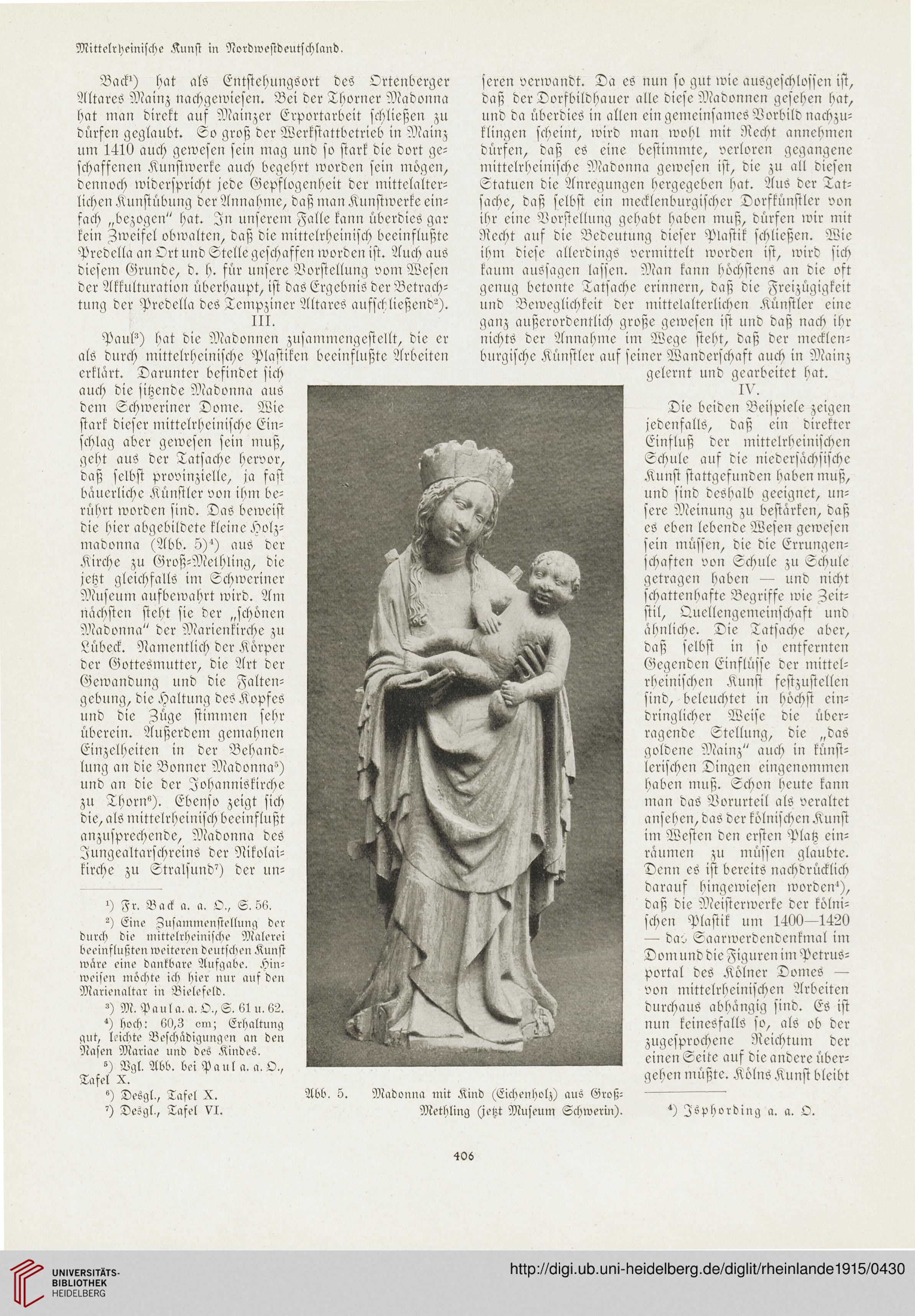Mittelrheinische Aunst in Nordwestdeutschland.
BackH hat als Entstehungsort des Ortenberger
Altareü Mainz nachgewiesen. Bei der Thorner Madonna
hat man direkt auf Mainzer Erportarbeit schließen zu
dürfen geglaubt. So groß der Werkstattbetrieb in Mainz
um 1410 auch gewesen sein mag und so stark die dort ge-
schaffenen Kunstwerke auch begehrt worden sein mögen,
dennoch widerspricht jede Gepflogenheit der mittelalter-
lichen Kunstübung derAnnahme, daß manKunstwerke ein-
fach „bezogen" hat. Jn unserem Falle kann überdies gar
kein Aweifel obwalten, daß die mittelrheinisch beeinflußte
Predella an Ort und Stelle geschaffen worden ist. Auch aus
diesem Grunde, d. h. für unsere Vorstellung vom Wesen
der Akkulturation überhaupt, ist das Ergebnis der Betrach-
tung der Predella des Tempziner Altares aufschließendch.
III.
Paulch hat die Madonnen zusammengestellt, die er
als dllrch mittelrheinische Plastiken beeinflußte Arbeiten
erklart. Darunter befindet sich
auch die sitzende Madonna aus
dem Schweriner Dome. Wie
stark dieser mittelrheinische Ein-
schlag aber gewesen sein muß,
geht aus der Tatsache hervor,
daß setbst provinzielle, ja fast
bäuerliche Künstler von ihm be-
rührt worden sind. Das beweist
die hier abgebildete kleine Holz-
madonna (Abb. 5)^) aus der
Kirche zu Groß-Methling, die
jetzt gleichfalls inl Schweriner
Museum aufbewahrt wird. Am
nachsten steht sie der „schönen
Madonna" der Marienkirche zu
Lübeck. Namentlich der Körper
der Gottesmutter, die Art der
Gewandung und die Falten-
gebung, die Haltung deS Kopfes
und die Aüge stimmen sehr
überein. Außerdem gemahnen
Einzelheiten in der Behand-
lung an die Bonner MadonnaH
und an die der Johanniskirche
zu ThornH. Ebenso zeigt sich
die, als mittelrheinisch beeinflußt
anzusprechende, Madonna des
Jungealtarschreins der Nikolai-
kirche zu StralsundH der un-
i) Fr. Back a. a. O„ S. 56.
^) Eine Zusammenstellung der
durch die mittelrheinische Malerei
beeinflußten weiteren deutschen Kunst
wäre eine dankbare Aufgabe. Hin-
weisen möchte icb hier nur auf den
Marienaltar in Bielefeld.
-) M.Paula.a.O.,S. 61u.62.
H hoch: 60,3 vm; Erhaltung
gut, leichte Beschädigungsn an den
Nasen Mariae und des Kindes.
H Bgl. Abb. bei Paula. a. O.,
Tafel X.
°) Desgl., Tafel X.
0 Desgl., Tafel VI.
seren verwandt. Da es nun so gut wie ausgeschlossen ist,
daß der Dorfbildhauer alle diese Madonnen gesehen hat,
und da überdies in allen ein gemeinsames Vorbild nachzu-
klingen scheint, wird man wohl mit Recht annehmen
dürfen, daß es eine bestimmte, verloren gegangene
mittelrheinische Madonna gewesen ist, die zu all diesen
Statuen die Anregungen hergegeben hat. Aus der Tat-
sache, daß selbst ein mecklenburgischer Dorfkünstler von
ibr eine Vorstcllung gehabt haben muß, dürfen wir mit
Necht auf die Bedeutung dieser Plastik schließen. Wie
ihm diese allerdings vermittelt worden ist, wird sich
kacmt aussagen lassen. Man kann höchstens an die oft
genug betonte Tatsache erinnern, daß die Freizügigkeit
und Beweglichkeit der mittelalterlichen Künstler eine
ganz außerordentlich große gewesen ist und daß nach ihr
nichts der Annahme ini Wege steht, daß der mecklen-
burgische Künstler auf seiner Wanderschaft auch in Mainz
gelernt und gearbeitet hat.
IV.
Die beiden Beispiele zeigen
jedenfalls, daß ein direkter
Einfluß der mittelrheinischen
Schule auf die niedersachsische
Kunft stattgefunden haben muß,
und sind deshalb geeignet, un-
sere Meinung zu bestärken, daß
es eben lebende Wesen gewesen
sein niüssen, die die Errungen-
schaften von Schule zu Schule
getragen haben — und nicht
schattenhafte Begriffe wie Aeit-
stil, O.uellengemeinschaft und
ahnliche. Die Tatsache aber,
daß selbst in so entfernten
Gegenden Einflüfse der mittel-
rheinischen Kunst festzustellen
sind, beleuchtet in höchst cin-
dringlicher Weise die über-
ragende Stellung, die „das
goldene Mainz" auch in künst-
lerischen Dingen eingenonimen
haben muß. Schon heute kann
man das Vorurteil als veraltet
ansehen, das der kölnischen Kunst
im Westen den ersten Platz ein-
räumen zu müssen glaubte.
Denn es ist bereits nachdrücklich
darauf hingewiesen wordenH,
5. Madonna mit Kind (Eichenholz) aus Groß-
Methling (jeßt Museum Schwerin).
daß die Meisterwerke der kölni-
schen Plastik um 1400—1420
— dao Saarwerdendenkmal im
Dom und die Figuren im Petrus-
portal des Kölner Domes -
von mittelrheinischen Arbeiten
durchaus abhangig sind. Es ist
nun keinesfalls so, als ob der
zugesprochene Reichtum der
einen Seite auf die andere über-
gehen niüßte. Kölns Kunst bleibt
^) Isvbordina a. a. O.
40-
BackH hat als Entstehungsort des Ortenberger
Altareü Mainz nachgewiesen. Bei der Thorner Madonna
hat man direkt auf Mainzer Erportarbeit schließen zu
dürfen geglaubt. So groß der Werkstattbetrieb in Mainz
um 1410 auch gewesen sein mag und so stark die dort ge-
schaffenen Kunstwerke auch begehrt worden sein mögen,
dennoch widerspricht jede Gepflogenheit der mittelalter-
lichen Kunstübung derAnnahme, daß manKunstwerke ein-
fach „bezogen" hat. Jn unserem Falle kann überdies gar
kein Aweifel obwalten, daß die mittelrheinisch beeinflußte
Predella an Ort und Stelle geschaffen worden ist. Auch aus
diesem Grunde, d. h. für unsere Vorstellung vom Wesen
der Akkulturation überhaupt, ist das Ergebnis der Betrach-
tung der Predella des Tempziner Altares aufschließendch.
III.
Paulch hat die Madonnen zusammengestellt, die er
als dllrch mittelrheinische Plastiken beeinflußte Arbeiten
erklart. Darunter befindet sich
auch die sitzende Madonna aus
dem Schweriner Dome. Wie
stark dieser mittelrheinische Ein-
schlag aber gewesen sein muß,
geht aus der Tatsache hervor,
daß setbst provinzielle, ja fast
bäuerliche Künstler von ihm be-
rührt worden sind. Das beweist
die hier abgebildete kleine Holz-
madonna (Abb. 5)^) aus der
Kirche zu Groß-Methling, die
jetzt gleichfalls inl Schweriner
Museum aufbewahrt wird. Am
nachsten steht sie der „schönen
Madonna" der Marienkirche zu
Lübeck. Namentlich der Körper
der Gottesmutter, die Art der
Gewandung und die Falten-
gebung, die Haltung deS Kopfes
und die Aüge stimmen sehr
überein. Außerdem gemahnen
Einzelheiten in der Behand-
lung an die Bonner MadonnaH
und an die der Johanniskirche
zu ThornH. Ebenso zeigt sich
die, als mittelrheinisch beeinflußt
anzusprechende, Madonna des
Jungealtarschreins der Nikolai-
kirche zu StralsundH der un-
i) Fr. Back a. a. O„ S. 56.
^) Eine Zusammenstellung der
durch die mittelrheinische Malerei
beeinflußten weiteren deutschen Kunst
wäre eine dankbare Aufgabe. Hin-
weisen möchte icb hier nur auf den
Marienaltar in Bielefeld.
-) M.Paula.a.O.,S. 61u.62.
H hoch: 60,3 vm; Erhaltung
gut, leichte Beschädigungsn an den
Nasen Mariae und des Kindes.
H Bgl. Abb. bei Paula. a. O.,
Tafel X.
°) Desgl., Tafel X.
0 Desgl., Tafel VI.
seren verwandt. Da es nun so gut wie ausgeschlossen ist,
daß der Dorfbildhauer alle diese Madonnen gesehen hat,
und da überdies in allen ein gemeinsames Vorbild nachzu-
klingen scheint, wird man wohl mit Recht annehmen
dürfen, daß es eine bestimmte, verloren gegangene
mittelrheinische Madonna gewesen ist, die zu all diesen
Statuen die Anregungen hergegeben hat. Aus der Tat-
sache, daß selbst ein mecklenburgischer Dorfkünstler von
ibr eine Vorstcllung gehabt haben muß, dürfen wir mit
Necht auf die Bedeutung dieser Plastik schließen. Wie
ihm diese allerdings vermittelt worden ist, wird sich
kacmt aussagen lassen. Man kann höchstens an die oft
genug betonte Tatsache erinnern, daß die Freizügigkeit
und Beweglichkeit der mittelalterlichen Künstler eine
ganz außerordentlich große gewesen ist und daß nach ihr
nichts der Annahme ini Wege steht, daß der mecklen-
burgische Künstler auf seiner Wanderschaft auch in Mainz
gelernt und gearbeitet hat.
IV.
Die beiden Beispiele zeigen
jedenfalls, daß ein direkter
Einfluß der mittelrheinischen
Schule auf die niedersachsische
Kunft stattgefunden haben muß,
und sind deshalb geeignet, un-
sere Meinung zu bestärken, daß
es eben lebende Wesen gewesen
sein niüssen, die die Errungen-
schaften von Schule zu Schule
getragen haben — und nicht
schattenhafte Begriffe wie Aeit-
stil, O.uellengemeinschaft und
ahnliche. Die Tatsache aber,
daß selbst in so entfernten
Gegenden Einflüfse der mittel-
rheinischen Kunst festzustellen
sind, beleuchtet in höchst cin-
dringlicher Weise die über-
ragende Stellung, die „das
goldene Mainz" auch in künst-
lerischen Dingen eingenonimen
haben muß. Schon heute kann
man das Vorurteil als veraltet
ansehen, das der kölnischen Kunst
im Westen den ersten Platz ein-
räumen zu müssen glaubte.
Denn es ist bereits nachdrücklich
darauf hingewiesen wordenH,
5. Madonna mit Kind (Eichenholz) aus Groß-
Methling (jeßt Museum Schwerin).
daß die Meisterwerke der kölni-
schen Plastik um 1400—1420
— dao Saarwerdendenkmal im
Dom und die Figuren im Petrus-
portal des Kölner Domes -
von mittelrheinischen Arbeiten
durchaus abhangig sind. Es ist
nun keinesfalls so, als ob der
zugesprochene Reichtum der
einen Seite auf die andere über-
gehen niüßte. Kölns Kunst bleibt
^) Isvbordina a. a. O.
40-