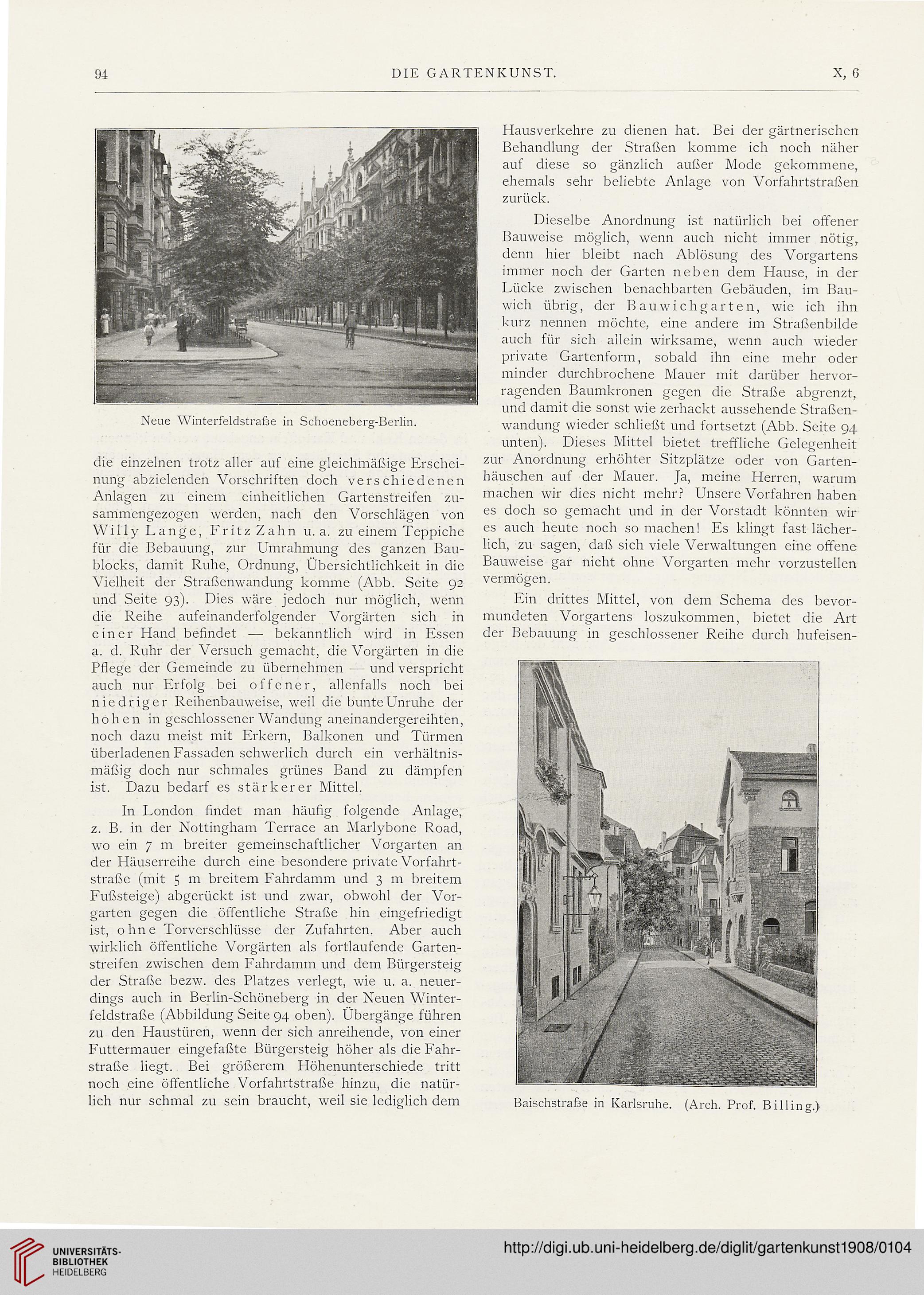94
DIE GARTENKUNST.
X, 6
Neue Winterfeldstraße in Schoeneberg-Berlin.
die einzelnen trotz aller auf eine gleichmäßige Erschei-
nung abzielenden Vorschriften doch verschiedenen
Anlagen zu einem einheitlichen Gartenstreifen zu-
sammengezogen werden, nach den Vorschlägen von
Willy Lange, Fritz Zahn u. a. zu einem Teppiche
für die Bebauung, zur Umrahmung des ganzen Bau-
blocks, damit Ruhe, Ordnung, Übersichtlichkeit in die
Vielheit der Straßenwandung komme (Abb. Seite 92
und Seite 93). Dies wäre jedoch nur möglich, wenn
die Reihe aufeinanderfolgender Vorgärten sich in
einer Hand befindet — bekanntlich wird in Essen
a. d. Ruhr der Versuch gemacht, die Vorgärten in die
Pflege der Gemeinde zu übernehmen — und verspricht
auch nur Erfolg bei offener, allenfalls noch bei
niedriger Reihenbauweise, weil die bunte Unruhe der
hohen in geschlossener Wandung aneinandergereihten,
noch dazu meist mit Erkern, Baikonen und Türmen
überladenen Fassaden schwerlich durch ein verhältnis-
mäßig doch nur schmales grünes Band zu dämpfen
ist. Dazu bedarf es stärkerer Mittel.
In London findet man häufig folgende Anlage,
z. B. in der Nottingham Terrace an Marlybone Road,
wo ein 7 m breiter gemeinschaftlicher Vorgarten an
der Häuserreihe durch eine besondere private Vorfahrt-
straße (mit 5 m breitem Fahrdamm und 3 m breitem
Fußsteige) abgerückt ist und zwar, obwohl der Vor-
garten gegen die öffentliche Straße hin eingefriedigt
ist, ohne Torverschlüsse der Zufahrten. Aber auch
wirklich öffentliche Vorgärten als fortlaufende Garten-
streifen zwischen dem Fahrdamm und dem Bürgersteig
der Straße bezw. des Platzes verlegt, wie u. a. neuer-
dings auch in Berlin-Schöneberg in der Neuen Winter-
feldstraße (Abbildung Seite 94 oben). Übergänge führen
zu den Haustüren, wenn der sich anreihende, von einer
Futtermauer eingefaßte Bürgersteig höher als die Fahr-
straße liegt. Bei größerem Höhenunterschiede tritt
noch eine öffentliche Vorfahrtstraße hinzu, die natür-
lich nur schmal zu sein braucht, weil sie lediglich dem
Hausverkehre zu dienen hat. Bei der gärtnerischen
Behandlung der Straßen komme ich noch näher
auf diese so gänzlich außer Mode gekommene,
ehemals sehr beliebte Anlage von Vorfahrtstraßen
zurück.
Dieselbe Anordnung ist natürlich bei offener
Bauweise möglich, wenn auch nicht immer nötig,
denn hier bleibt nach Ablösung des Vorgartens
immer noch der Garten neben dem Hause, in der
Lücke zwischen benachbarten Gebäuden, im Bau-
wich übrig, der Bauwichgarten, wie ich ihn
kurz nennen möchte, eine andere im Straßenbilde
auch für sich allein wirksame, wenn auch wieder
private Gartenform, sobald ihn eine mehr oder
minder durchbrochene Mauer mit darüber hervor-
ragenden Baumkronen gegen die Straße abgrenzt,
und damit die sonst wie zerhackt aussehende Straßen-
wandung wieder schließt und fortsetzt (Abb. Seite 94
unten). Dieses Mittel bietet treffliche Gelegenheit
zur Anordnung erhöhter Sitzplätze oder von Garten-
häuschen auf der Mauer. Ja, meine Flerren, warum
machen wir dies nicht mehr? Unsere Vorfahren haben
es doch so gemacht und in der Vorstadt könnten wir
es auch heute noch so machen! Es klingt fast lächer-
lich, zu sagen, daß sich viele Verwaltungen eine offene
Bauweise gar nicht ohne Vorgarten mehr vorzustellen
vermögen.
Ein drittes Mittel, von dem Schema des bevor-
mundeten Vorgartens loszukommen, bietet die Art
der Bebauung in geschlossener Reihe durch hufeisen-
DIE GARTENKUNST.
X, 6
Neue Winterfeldstraße in Schoeneberg-Berlin.
die einzelnen trotz aller auf eine gleichmäßige Erschei-
nung abzielenden Vorschriften doch verschiedenen
Anlagen zu einem einheitlichen Gartenstreifen zu-
sammengezogen werden, nach den Vorschlägen von
Willy Lange, Fritz Zahn u. a. zu einem Teppiche
für die Bebauung, zur Umrahmung des ganzen Bau-
blocks, damit Ruhe, Ordnung, Übersichtlichkeit in die
Vielheit der Straßenwandung komme (Abb. Seite 92
und Seite 93). Dies wäre jedoch nur möglich, wenn
die Reihe aufeinanderfolgender Vorgärten sich in
einer Hand befindet — bekanntlich wird in Essen
a. d. Ruhr der Versuch gemacht, die Vorgärten in die
Pflege der Gemeinde zu übernehmen — und verspricht
auch nur Erfolg bei offener, allenfalls noch bei
niedriger Reihenbauweise, weil die bunte Unruhe der
hohen in geschlossener Wandung aneinandergereihten,
noch dazu meist mit Erkern, Baikonen und Türmen
überladenen Fassaden schwerlich durch ein verhältnis-
mäßig doch nur schmales grünes Band zu dämpfen
ist. Dazu bedarf es stärkerer Mittel.
In London findet man häufig folgende Anlage,
z. B. in der Nottingham Terrace an Marlybone Road,
wo ein 7 m breiter gemeinschaftlicher Vorgarten an
der Häuserreihe durch eine besondere private Vorfahrt-
straße (mit 5 m breitem Fahrdamm und 3 m breitem
Fußsteige) abgerückt ist und zwar, obwohl der Vor-
garten gegen die öffentliche Straße hin eingefriedigt
ist, ohne Torverschlüsse der Zufahrten. Aber auch
wirklich öffentliche Vorgärten als fortlaufende Garten-
streifen zwischen dem Fahrdamm und dem Bürgersteig
der Straße bezw. des Platzes verlegt, wie u. a. neuer-
dings auch in Berlin-Schöneberg in der Neuen Winter-
feldstraße (Abbildung Seite 94 oben). Übergänge führen
zu den Haustüren, wenn der sich anreihende, von einer
Futtermauer eingefaßte Bürgersteig höher als die Fahr-
straße liegt. Bei größerem Höhenunterschiede tritt
noch eine öffentliche Vorfahrtstraße hinzu, die natür-
lich nur schmal zu sein braucht, weil sie lediglich dem
Hausverkehre zu dienen hat. Bei der gärtnerischen
Behandlung der Straßen komme ich noch näher
auf diese so gänzlich außer Mode gekommene,
ehemals sehr beliebte Anlage von Vorfahrtstraßen
zurück.
Dieselbe Anordnung ist natürlich bei offener
Bauweise möglich, wenn auch nicht immer nötig,
denn hier bleibt nach Ablösung des Vorgartens
immer noch der Garten neben dem Hause, in der
Lücke zwischen benachbarten Gebäuden, im Bau-
wich übrig, der Bauwichgarten, wie ich ihn
kurz nennen möchte, eine andere im Straßenbilde
auch für sich allein wirksame, wenn auch wieder
private Gartenform, sobald ihn eine mehr oder
minder durchbrochene Mauer mit darüber hervor-
ragenden Baumkronen gegen die Straße abgrenzt,
und damit die sonst wie zerhackt aussehende Straßen-
wandung wieder schließt und fortsetzt (Abb. Seite 94
unten). Dieses Mittel bietet treffliche Gelegenheit
zur Anordnung erhöhter Sitzplätze oder von Garten-
häuschen auf der Mauer. Ja, meine Flerren, warum
machen wir dies nicht mehr? Unsere Vorfahren haben
es doch so gemacht und in der Vorstadt könnten wir
es auch heute noch so machen! Es klingt fast lächer-
lich, zu sagen, daß sich viele Verwaltungen eine offene
Bauweise gar nicht ohne Vorgarten mehr vorzustellen
vermögen.
Ein drittes Mittel, von dem Schema des bevor-
mundeten Vorgartens loszukommen, bietet die Art
der Bebauung in geschlossener Reihe durch hufeisen-