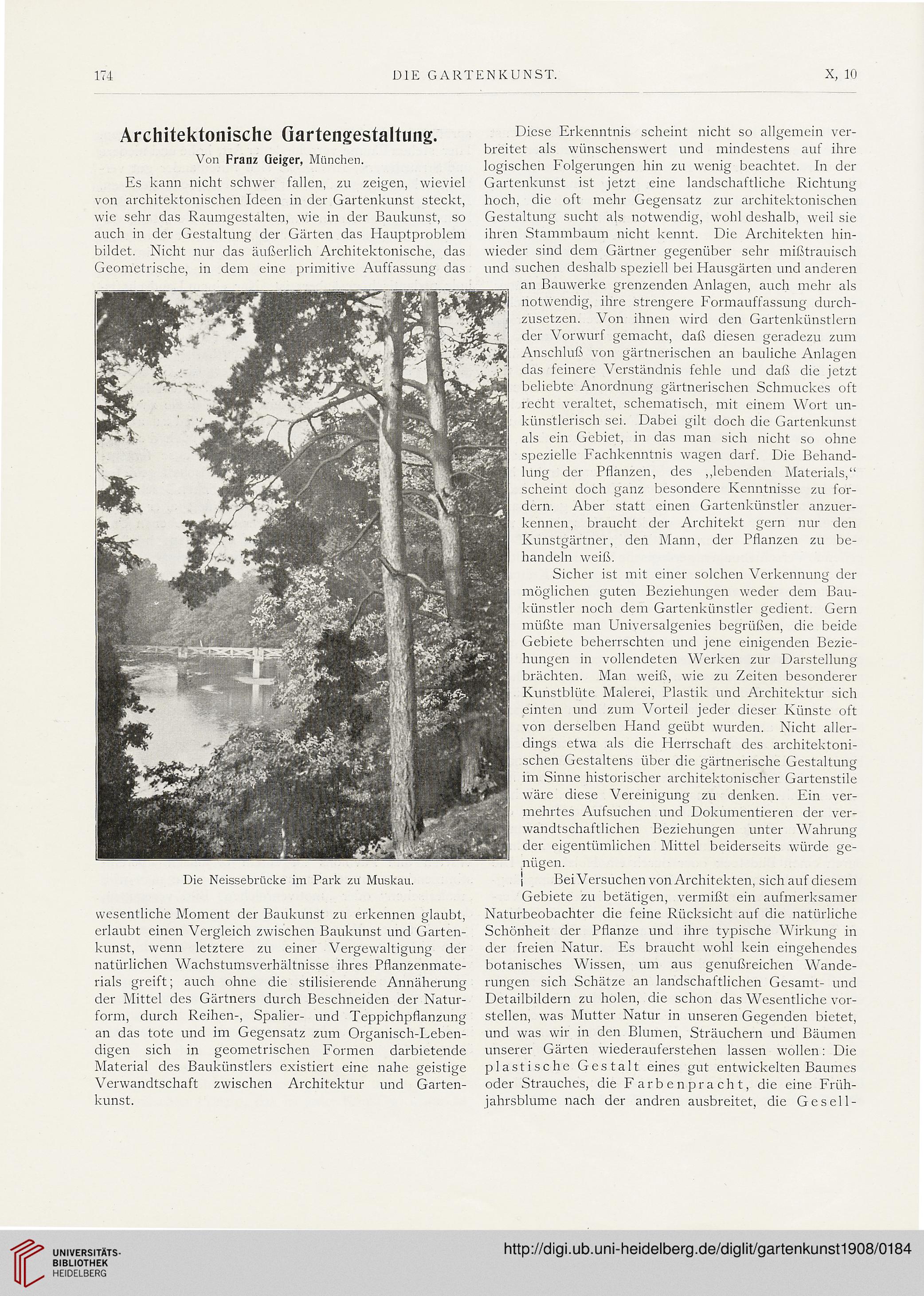174
DIE GARTENKUNST.
X, 10
Architektonische Gartengestaltung.
Von Franz Geiger, München.
Es kann nicht schwer fallen, zu zeigen, wieviel
von architektonischen Ideen in der Gartenkunst steckt,
wie sehr das Raumgestalten, wie in der Baukunst, so
auch in der Gestaltung der Gärten das Hauptproblem
bildet. Nicht nur das äußerlich Architektonische, das
Geometrische, in dem eine primitive Auffassung das
wesentliche Moment der Baukunst zu erkennen glaubt,
erlaubt einen Vergleich zwischen Baukunst und Garten-
kunst, wenn letztere zu einer Vergewaltigung der
natürlichen Wachstumsverhältnisse ihres Pflanzenmate-
rials greift; auch ohne die stilisierende Annäherung
der Mittel des Gärtners durch Beschneiden der Natur-
form, durch Reihen-, Spalier- und Teppichpflanzung
an das tote und im Gegensatz zum Organisch-Leben-
digen sich in geometrischen Formen darbietende
Material des Baukünstlers existiert eine nahe geistige
Verwandtschaft zwischen Architektur und Garten-
kunst.
Diese Erkenntnis scheint nicht so allgemein ver-
breitet als wünschenswert und mindestens auf ihre
logischen Folgerungen hin zu wenig beachtet. In der
Gartenkunst ist jetzt eine landschaftliche Richtung
hoch, die oft mehr Gegensatz zur architektonischen
Gestaltung sucht als notwendig, wohl deshalb, weil sie
ihren Stammbaum nicht kennt. Die Architekten hin-
wieder sind dem Gärtner gegenüber sehr mißtrauisch
und suchen deshalb speziell bei Hausgärten und anderen
an Bauwerke grenzenden Anlagen, auch mehr als
notwendig, ihre strengere Formauffassung durch-
zusetzen. Von ihnen wird den Gartenkünstlern
der Vorwurf gemacht, daß diesen geradezu zum
Anschluß von gärtnerischen an bauliche Anlagen
das feinere Verständnis fehle und daß die jetzt
beliebte Anordnung gärtnerischen Schmuckes oft
recht veraltet, schematisch, mit einem Wort un-
künstlerisch sei. Dabei gilt doch die Gartenkunst
als ein Gebiet, in das man sich nicht so ohne
spezielle Fachkenntnis wagen darf. Die Behand-
lung der Pflanzen, des „lebenden Materials,“
scheint doch ganz besondere Kenntnisse zu for-
dern. Aber statt einen Gartenkünstler anzuer-
kennen, braucht der Architekt gern nur den
Kunstgärtner, den Mann, der Pflanzen zu be-
handeln weiß.
Sicher ist mit einer solchen Verkennung der
möglichen guten Beziehungen weder dem Bau-
künstler noch dem Gartenkünstler gedient. Gern
müßte man Universalgenies begrüßen, die beide
Gebiete beherrschten und jene einigenden Bezie-
hungen in vollendeten Werken zur Darstellung
brächten. Man weiß, wie zu Zeiten besonderer
Kunstblüte Malerei, Plastik und Architektur sich
einten und zum Vorteil jeder dieser Künste oft
von derselben Hand geübt wurden. Nicht aller-
dings etwa als die Herrschaft des architektoni-
schen Gestaltens über die gärtnerische Gestaltung
im Sinne historischer architektonischer Gartenstile
wäre diese Vereinigung zu denken. Ein ver-
mehrtes Aufsuchen und Dokumentieren der ver-
wandtschaftlichen Beziehungen unter Wahrung
der eigentümlichen Mittel beiderseits würde ge-
nügen.
i Bei Versuchen von Architekten, sich auf diesem
Gebiete zu betätigen, vermißt ein aufmerksamer
Naturbeobachter die feine Rücksicht auf die natürliche
Schönheit der Pflanze und ihre typische Wirkung in
der freien Natur. Es braucht wohl kein eingehendes
botanisches Wissen, um aus genußreichen Wande-
rungen sich Schätze an landschaftlichen Gesamt- und
Detailbildern zu holen, die schon das Wesentliche vor-
stellen, was Mutter Natur in unseren Gegenden bietet,
und was wir in den Blumen, Sträuchern und Bäumen
unserer Gärten wiederauferstehen lassen wollen: Die
plastische Gestalt eines gut entwickelten Baumes
oder Strauches, die Farbenpracht, die eine Früh-
jahrsblume nach der andren ausbreitet, die Gesell-
Die Neissebrücke im Park zu Muskau.
DIE GARTENKUNST.
X, 10
Architektonische Gartengestaltung.
Von Franz Geiger, München.
Es kann nicht schwer fallen, zu zeigen, wieviel
von architektonischen Ideen in der Gartenkunst steckt,
wie sehr das Raumgestalten, wie in der Baukunst, so
auch in der Gestaltung der Gärten das Hauptproblem
bildet. Nicht nur das äußerlich Architektonische, das
Geometrische, in dem eine primitive Auffassung das
wesentliche Moment der Baukunst zu erkennen glaubt,
erlaubt einen Vergleich zwischen Baukunst und Garten-
kunst, wenn letztere zu einer Vergewaltigung der
natürlichen Wachstumsverhältnisse ihres Pflanzenmate-
rials greift; auch ohne die stilisierende Annäherung
der Mittel des Gärtners durch Beschneiden der Natur-
form, durch Reihen-, Spalier- und Teppichpflanzung
an das tote und im Gegensatz zum Organisch-Leben-
digen sich in geometrischen Formen darbietende
Material des Baukünstlers existiert eine nahe geistige
Verwandtschaft zwischen Architektur und Garten-
kunst.
Diese Erkenntnis scheint nicht so allgemein ver-
breitet als wünschenswert und mindestens auf ihre
logischen Folgerungen hin zu wenig beachtet. In der
Gartenkunst ist jetzt eine landschaftliche Richtung
hoch, die oft mehr Gegensatz zur architektonischen
Gestaltung sucht als notwendig, wohl deshalb, weil sie
ihren Stammbaum nicht kennt. Die Architekten hin-
wieder sind dem Gärtner gegenüber sehr mißtrauisch
und suchen deshalb speziell bei Hausgärten und anderen
an Bauwerke grenzenden Anlagen, auch mehr als
notwendig, ihre strengere Formauffassung durch-
zusetzen. Von ihnen wird den Gartenkünstlern
der Vorwurf gemacht, daß diesen geradezu zum
Anschluß von gärtnerischen an bauliche Anlagen
das feinere Verständnis fehle und daß die jetzt
beliebte Anordnung gärtnerischen Schmuckes oft
recht veraltet, schematisch, mit einem Wort un-
künstlerisch sei. Dabei gilt doch die Gartenkunst
als ein Gebiet, in das man sich nicht so ohne
spezielle Fachkenntnis wagen darf. Die Behand-
lung der Pflanzen, des „lebenden Materials,“
scheint doch ganz besondere Kenntnisse zu for-
dern. Aber statt einen Gartenkünstler anzuer-
kennen, braucht der Architekt gern nur den
Kunstgärtner, den Mann, der Pflanzen zu be-
handeln weiß.
Sicher ist mit einer solchen Verkennung der
möglichen guten Beziehungen weder dem Bau-
künstler noch dem Gartenkünstler gedient. Gern
müßte man Universalgenies begrüßen, die beide
Gebiete beherrschten und jene einigenden Bezie-
hungen in vollendeten Werken zur Darstellung
brächten. Man weiß, wie zu Zeiten besonderer
Kunstblüte Malerei, Plastik und Architektur sich
einten und zum Vorteil jeder dieser Künste oft
von derselben Hand geübt wurden. Nicht aller-
dings etwa als die Herrschaft des architektoni-
schen Gestaltens über die gärtnerische Gestaltung
im Sinne historischer architektonischer Gartenstile
wäre diese Vereinigung zu denken. Ein ver-
mehrtes Aufsuchen und Dokumentieren der ver-
wandtschaftlichen Beziehungen unter Wahrung
der eigentümlichen Mittel beiderseits würde ge-
nügen.
i Bei Versuchen von Architekten, sich auf diesem
Gebiete zu betätigen, vermißt ein aufmerksamer
Naturbeobachter die feine Rücksicht auf die natürliche
Schönheit der Pflanze und ihre typische Wirkung in
der freien Natur. Es braucht wohl kein eingehendes
botanisches Wissen, um aus genußreichen Wande-
rungen sich Schätze an landschaftlichen Gesamt- und
Detailbildern zu holen, die schon das Wesentliche vor-
stellen, was Mutter Natur in unseren Gegenden bietet,
und was wir in den Blumen, Sträuchern und Bäumen
unserer Gärten wiederauferstehen lassen wollen: Die
plastische Gestalt eines gut entwickelten Baumes
oder Strauches, die Farbenpracht, die eine Früh-
jahrsblume nach der andren ausbreitet, die Gesell-
Die Neissebrücke im Park zu Muskau.