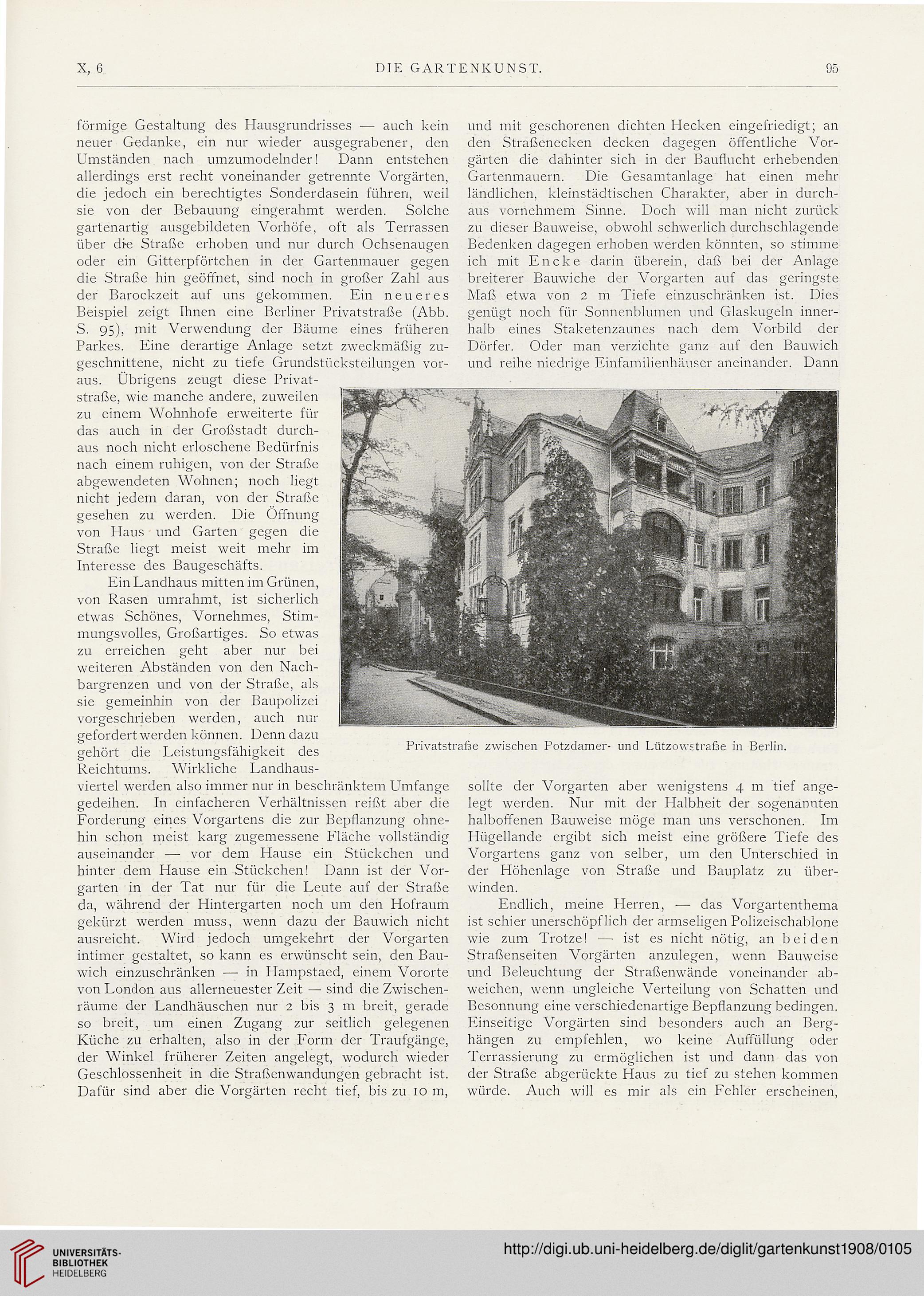X, 6
DIE GARTENKUNST.
95
förmige Gestaltung des Hausgrundrisses — auch kein
neuer Gedanke, ein nur wieder ausgegrabener, den
Umständen nach umzumodelnder! Dann entstehen
allerdings erst recht voneinander getrennte Vorgärten,
die jedoch ein berechtigtes Sonderdasein führen, weil
sie von der Bebauung eingerahmt werden. Solche
gartenartig ausgebildeten Vorhöfe, oft als Terrassen
über die Straße erhoben und nur durch Ochsenaugen
oder ein Gitterpförtchen in der Gartenmauer gegen
die Straße hin geöffnet, sind noch in großer Zahl aus
der Barockzeit auf uns gekommen. Ein neueres
Beispiel zeigt Ihnen eine Berliner Privatstraße (Abb.
S. 95), mit Verwendung der Bäume eines früheren
Parkes. Eine derartige Anlage setzt zweckmäßig zu-
geschnittene, nicht zu tiefe Grundstücksteilungen vor-
aus. Übrigens zeugt diese Privat-
straße, wie manche andere, zuweilen
zu einem Wohnhofe erweiterte für
das auch in der Großstadt durch-
aus noch nicht erloschene Bedürfnis
nach einem ruhigen, von der Straße
abgewendeten Wohnen; noch liegt
nicht jedem daran, von der Straße
gesehen zu werden. Die Öffnung
von Blaus und Garten gegen die
Straße liegt meist weit mehr im
Interesse des Baugeschäfts.
Ein Landhaus mitten im Grünen,
von Rasen umrahmt, ist sicherlich
etwas Schönes, Vornehmes, Stim-
mungsvolles, Großartiges. So etwas
zu erreichen geht aber nur bei
weiteren Abständen von den Nach-
bargrenzen und von der Straße, als
sie gemeinhin von der Baupolizei
vorgeschrieben werden, auch nur
gefordert werden können. Denn dazu
gehört die Leistungsfähigkeit des
Reichtums. Wirkliche Landhaus-
viertel werden also immer nur in beschränktem Umfange
gedeihen. In einfacheren Verhältnissen reißt aber die
Forderung eines Vorgartens die zur Bepflanzung ohne-
hin schon meist karg zugemessene Fläche vollständig
auseinander — vor dem Hause ein Stückchen und
hinter dem Hause ein Stückchen! Dann ist der Vor-
garten in der Tat nur für die Leute auf der Straße
da, während der Hintergarten noch um den Hofraum
gekürzt werden muss, wenn dazu der Bauwich nicht
ausreicht. Wird jedoch umgekehrt der Vorgarten
intimer gestaltet, so kann es erwünscht sein, den Bau-
wich einzuschränken — in Hampstaed, einem Vororte
von London aus allerneuester Zeit — sind die Zwischen-
räume der Landhäuschen nur 2 bis 3 m breit, gerade
so breit, um einen Zugang zur seitlich gelegenen
Küche zu erhalten, also in der Form der Traufgänge,
der Winkel früherer Zeiten angelegt, wodurch wieder
Geschlossenheit in die Straßenwandungen gebracht ist.
Dafür sind aber die Vorgärten recht tief, bis zu 10 m,
und mit geschorenen dichten Hecken eingefriedigt; an
den Straßenecken decken dagegen öffentliche Vor-
gärten die dahinter sich in der Bauflucht erhebenden
Gartenmauern. Die Gesamtanlage hat einen mehr
ländlichen, kleinstädtischen Charakter, aber in durch-
aus vornehmem Sinne. Doch will man nicht zurück
zu dieser Bauweise, obwohl schwerlich durchschlagende
Bedenken dagegen erhoben werden könnten, so stimme
ich mit Encke darin überein, daß bei der Anlage
breiterer Bauwiche der Vorgarten auf das geringste
Maß etwa von 2 m Tiefe einzuschränken ist. Dies
genügt noch für Sonnenblumen und Glaskugeln inner-
halb eines Staketenzaunes nach dem Vorbild der
Dörfer. Oder man verzichte ganz auf den Bauwich
und reihe niedrige Einfamilienhäuser aneinander. Dann
sollte der Vorgarten aber wenigstens 4 m tief ange-
legt werden. Nur mit der Halbheit der sogenannten
halboffenen Bauweise möge man uns verschonen. Im
Hügellande ergibt sich meist eine größere Tiefe des
Vorgartens ganz von selber, um den Unterschied in
der Höhenlage von Straße und Bauplatz zu über-
winden.
Endlich, meine Herren, — das Vorgartenthema
ist schier unerschöpflich der armseligen Polizeischablone
wie zum Trotze! —• ist es nicht nötig, an beiden
Straßenseiten Vorgärten anzulegen, wenn Bauweise
und Beleuchtung der Straßenwände voneinander ab-
weichen, wenn ungleiche Verteilung von Schatten und
Besonnung eine verschiedenartige Bepflanzung bedingen.
Einseitige Vorgärten sind besonders auch an Berg-
hängen zu empfehlen, wo keine Auffüllung oder
Terrassierung zu ermöglichen ist und dann das von
der Straße abgerückte Haus zu tief zu stehen kommen
würde. Auch will es mir als ein Fehler erscheinen,
Privatstrafie zwischen Potzdamer- und Lützowstrafie in Berlin.
DIE GARTENKUNST.
95
förmige Gestaltung des Hausgrundrisses — auch kein
neuer Gedanke, ein nur wieder ausgegrabener, den
Umständen nach umzumodelnder! Dann entstehen
allerdings erst recht voneinander getrennte Vorgärten,
die jedoch ein berechtigtes Sonderdasein führen, weil
sie von der Bebauung eingerahmt werden. Solche
gartenartig ausgebildeten Vorhöfe, oft als Terrassen
über die Straße erhoben und nur durch Ochsenaugen
oder ein Gitterpförtchen in der Gartenmauer gegen
die Straße hin geöffnet, sind noch in großer Zahl aus
der Barockzeit auf uns gekommen. Ein neueres
Beispiel zeigt Ihnen eine Berliner Privatstraße (Abb.
S. 95), mit Verwendung der Bäume eines früheren
Parkes. Eine derartige Anlage setzt zweckmäßig zu-
geschnittene, nicht zu tiefe Grundstücksteilungen vor-
aus. Übrigens zeugt diese Privat-
straße, wie manche andere, zuweilen
zu einem Wohnhofe erweiterte für
das auch in der Großstadt durch-
aus noch nicht erloschene Bedürfnis
nach einem ruhigen, von der Straße
abgewendeten Wohnen; noch liegt
nicht jedem daran, von der Straße
gesehen zu werden. Die Öffnung
von Blaus und Garten gegen die
Straße liegt meist weit mehr im
Interesse des Baugeschäfts.
Ein Landhaus mitten im Grünen,
von Rasen umrahmt, ist sicherlich
etwas Schönes, Vornehmes, Stim-
mungsvolles, Großartiges. So etwas
zu erreichen geht aber nur bei
weiteren Abständen von den Nach-
bargrenzen und von der Straße, als
sie gemeinhin von der Baupolizei
vorgeschrieben werden, auch nur
gefordert werden können. Denn dazu
gehört die Leistungsfähigkeit des
Reichtums. Wirkliche Landhaus-
viertel werden also immer nur in beschränktem Umfange
gedeihen. In einfacheren Verhältnissen reißt aber die
Forderung eines Vorgartens die zur Bepflanzung ohne-
hin schon meist karg zugemessene Fläche vollständig
auseinander — vor dem Hause ein Stückchen und
hinter dem Hause ein Stückchen! Dann ist der Vor-
garten in der Tat nur für die Leute auf der Straße
da, während der Hintergarten noch um den Hofraum
gekürzt werden muss, wenn dazu der Bauwich nicht
ausreicht. Wird jedoch umgekehrt der Vorgarten
intimer gestaltet, so kann es erwünscht sein, den Bau-
wich einzuschränken — in Hampstaed, einem Vororte
von London aus allerneuester Zeit — sind die Zwischen-
räume der Landhäuschen nur 2 bis 3 m breit, gerade
so breit, um einen Zugang zur seitlich gelegenen
Küche zu erhalten, also in der Form der Traufgänge,
der Winkel früherer Zeiten angelegt, wodurch wieder
Geschlossenheit in die Straßenwandungen gebracht ist.
Dafür sind aber die Vorgärten recht tief, bis zu 10 m,
und mit geschorenen dichten Hecken eingefriedigt; an
den Straßenecken decken dagegen öffentliche Vor-
gärten die dahinter sich in der Bauflucht erhebenden
Gartenmauern. Die Gesamtanlage hat einen mehr
ländlichen, kleinstädtischen Charakter, aber in durch-
aus vornehmem Sinne. Doch will man nicht zurück
zu dieser Bauweise, obwohl schwerlich durchschlagende
Bedenken dagegen erhoben werden könnten, so stimme
ich mit Encke darin überein, daß bei der Anlage
breiterer Bauwiche der Vorgarten auf das geringste
Maß etwa von 2 m Tiefe einzuschränken ist. Dies
genügt noch für Sonnenblumen und Glaskugeln inner-
halb eines Staketenzaunes nach dem Vorbild der
Dörfer. Oder man verzichte ganz auf den Bauwich
und reihe niedrige Einfamilienhäuser aneinander. Dann
sollte der Vorgarten aber wenigstens 4 m tief ange-
legt werden. Nur mit der Halbheit der sogenannten
halboffenen Bauweise möge man uns verschonen. Im
Hügellande ergibt sich meist eine größere Tiefe des
Vorgartens ganz von selber, um den Unterschied in
der Höhenlage von Straße und Bauplatz zu über-
winden.
Endlich, meine Herren, — das Vorgartenthema
ist schier unerschöpflich der armseligen Polizeischablone
wie zum Trotze! —• ist es nicht nötig, an beiden
Straßenseiten Vorgärten anzulegen, wenn Bauweise
und Beleuchtung der Straßenwände voneinander ab-
weichen, wenn ungleiche Verteilung von Schatten und
Besonnung eine verschiedenartige Bepflanzung bedingen.
Einseitige Vorgärten sind besonders auch an Berg-
hängen zu empfehlen, wo keine Auffüllung oder
Terrassierung zu ermöglichen ist und dann das von
der Straße abgerückte Haus zu tief zu stehen kommen
würde. Auch will es mir als ein Fehler erscheinen,
Privatstrafie zwischen Potzdamer- und Lützowstrafie in Berlin.